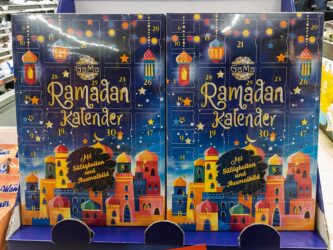Im September 2025 fand in Mexiko das Festival „Re-existe“ statt. Anson Samuel, der sich selbst als queeren, bikulturellen Katholiken beschreibt, gibt in seinem Beitrag persönliche Lernerfahrungen in der Begegnung mit 80 Teilnehmenden wieder; und die Erkenntnis der Notwendigkeit, dem (Heiligen) Geist, der Ruach, Raum zu geben, ihn/sie zu dekolonialisieren.
Glauben von den Peripherien her zu denken – das war die Einladung des Festivals Re-existe 2025 (22.-26.September 2025) in Mexiko. Dort begegnete ich einer Theologie, die nicht in Büchern beginnt, sondern im Atem von Körpern, Flüssen und Geschichten. Für mich, als queeren, bikulturellen Katholiken, wurde diese Erfahrung zu einem Ruf, den Geist zu dekolonisieren –die Ruach in mir selbst und in meinem Glauben erneut zu begegnen.
Glaube, gelesen durch den Körper und seine Ränder.
Die Luft stank selbst durch unsere Masken nach Chemikalien, als wir zögerlich tiefer in El Salto an die Randbezirke von Guadalajara traten — eine Gemeinde, die lange durch industrielle Abwässer von großen Konzernen aus dem Santiago-Fluss vergiftet wurde. Der Fluss, dick und braun, schäumte vor Toxinen, während er sich durch das Land schlängelte, in dem für viele sauberes Wasser und grundlegende Versorgungsgüter zunehmend zum Luxus wurden. Zwei Tage zuvor hatten wir beim Eröffnungsfest des Festivals Re-existe unsere gemeinsame Erinnerung an Wasser in Blau- und Grüntönen auf weißen Stoffen nachgezeichnet. Nun, am Fluss selbst, war der Gestank der Missachtung des Lebens in der Politik der Industrialisierung unvermeidlich. Ich fragte mich, ob diese Erstickung an eine unterdrückende Theologie erinnert, die ich — als queerer indischer katholischer Immigrant in Österreich — kenne, die Scham und Schuld um queere Körper, Begehren und Erfahrungen zentrierte. Vielleicht ein Kolonialismus, welcher Schöpfung und Begehren, Fluss und Körper, beides besetzt. Diese Reflexion entsteht aus der Schnittstelle zwischen autobiografischer Erzählung und dekolonialer Theologie – was Marcella Althaus-Reid als „unanständige Theologie” (Indecent Theology) bezeichnen würde: Glaube, gelesen durch den Körper und seine Ränder.
In diesen Begegnungen war der Geist spürbar, der die Peripherien miteinander verband.

durch das verletzliche Nacherzählen unserer Geschichten gegenseitig bereichern
Dieses Festival unterschied sich dadurch, dass es Menschen an den Peripherien ins Zentrum rückte. Nicht, um über uns zu sprechen, sondern uns aktiv beim Sprechen zuzuhören, wenn es um unsere gelebten Erfahrungen in marginalisierten Gemeinschaften geht. Täglich trafen wir uns in fünf Gruppen, sogenannten „Oasen“, in denen wir uns durch das verletzliche Nacherzählen unserer Geschichten gegenseitig bereichern konnten. Meine kleine Gruppe vereinte eine bemerkenswerte Vielfalt von Stimmen: Sabina Rifat, WAKE (Women and Kids Education) in Pakistan; Adelard Kananira von Gay Christian Africa; Dicky Senda, von Lakoat Kujawas in Timor; Cecelia Fire Thunder, Lakota-Elder aus South Dakota, USA, und mich selbst, der ich meine Arbeit bei The Upper Room in Indien und Österreich sowie mit der Katholischen Jugend OÖ vertrat. Moderiert wurde die Gruppe von Schwester Mūmbi Kīgūtha, CPPS, von Friends in Solidarity, und Watawa wa Taa. Romina Sapinoso von Sisters of Charity (Cincinnati) und Bernard Brady von der St. Thomas University Minnesota dienten als Zuhörende, deren Aufgabe es war, die geteilten Einsichten in den Gruppen zu empfangen und die Erkenntnisse und Erfahrungen miteinander zu verweben. Glenda Cabrera aus Kuba, Teil der Bewegung Bendita Mezcla, bewegte sich ebenfalls zwischen den Gruppen und achtete darauf, „Früchte“ aus unseren Gesprächen zu „ernten“, auf deren Basis die verkörperten Liturgien am Abend gestaltet wurden.
Zum ersten Mal sah ich Gott nicht als entfernten Vater, der mein Leiden beobachtet, sondern als das Göttliche, das aus Liebe die Tische umwirft.
Als queerer, bikultureller Katholik bedeutete Re-exist (Wiederexistieren), das Verständnis von der Ruach (hebr. den heiligen Geist) in meiner eigenen Glaubenserfahrung zu dekolonisieren und die Stärke der kreativen Vorstellungskraft im Nacherzählen von Geschichten zu nutzen. Es bedeutet, sowohl ihre disruptive als auch ihre schöpferische Kraft zu erkennen — ihr Handeln in den Ritzen unserer Gewissheiten zuzulassen. Ich erlebte diese Erschütterung erstmals, als mir eine liebe Freundin, die die Kosten von Ausgrenzung miterlebt hatte, schlicht sagte: „Genug.“ Ich konnte nicht sagen, ob der Geist mich tröstete oder aus der Komplizenschaft rief. Dieses Wort zerriss die fragile Theologie, mit der ich überlebt hatte. Zum ersten Mal sah ich Gott nicht als entfernten Vater, der mein Leiden beobachtet, sondern als das Göttliche, das aus Liebe die Tische umwirft. Ist das vielleicht die ‚negative Dimension des Geistes‘, von der Moltmann spricht: „Wenn die Freiheit nahe ist, beginnen die Ketten zu schmerzen“?[1]
Für Catherine Walsh ist Dekoloniale Praxis ist ‚die kontinuierliche Arbeit, eine andere Art des Seins, des Wieder-Seins, des Lebens zu pflanzen und zu kultivieren, trotz und innerhalb der Grenzen, Ränder und Risse … die untrennbar mit den neuen Konfigurationen der vorherrschenden Ordnung/Unordnung verbunden sind.‘[2] Die Ruach zu dekolonisieren bedeutet also, sie dort wieder atmen zu lassen, wo die Theologie sie erstickt hat — in Körpern, in Flüssen, in verbotener Liebe.
Um zu träumen, zu hoffen, wieder zu existieren, muss die kreative Vorstellungskraft Wurzeln schlagen
Beim erneuten Blick auf meine eigene Biografie konnte ich freier und mutiger benennen, wer ich bin und welche Erfahrungen mich geprägt haben. Innerhalb des Raums von Re-existe und in Resonanz mit Adelards Worten über die Erfahrung von Gottes bedingungsloser Liebe, selbst trotz schmerzhafter Erfahrungen mit den Nächsten, erkannte ich, wie sich göttliche Liebe jenseits enger Zugehörigkeitsdefinitionen entfaltet. Gemeinsam erkundeten wir, was Würde bedeutet — wo sie wohnt und ob sie in unseren Körpern, außerhalb von ihnen oder in der komplexen Spannung zwischen beidem lebt. Würde ist ein Geheimnis, das in beiden Orten zugleich gehalten werden muss: in uns als sakrale Gewissheit und außerhalb von uns als Erkennen durch andere. Um zu träumen, zu hoffen, wieder zu existieren, muss die kreative Vorstellungskraft Wurzeln schlagen — eine Vorstellungskraft, die nicht naiv, sondern transformativ ist, geboren aus dem Schmerz von Unterdrückung und dem Mut des Werdens.
Was ich beim Betreten des Festivals sah, traf mich wie ein Schlag. Auf der Bühne stand eine Galerie der Abwesenheit: Fotografien von Vermissten, deren Gesichter zu stummen Zeugen geworden waren. Der Bundestaat Jalisco (Hauptstadt Guadalajara) verzeichnet eine der höchsten Zahlen von Vermissten in Mexiko. Daneben lud eine künstlerische Installation dazu ein, ein kleines Werkzeug zu nehmen, wie es zum Entfernen von Schutt genutzt wird, und Schichten von Mörtel abzukratzen, der diese Bilder bedeckte. Es war eine einzige Handlung, schlicht und zugleich verstörend — das langsame Freilegen dessen, was begraben, ausgelöscht oder unsichtbar gemacht worden war. Mit jeder Bewegung beteiligten wir uns an einer kollektiven Suche: nach Körpern, nach Geschichten, nach Identitäten, die durch Gewalt, Vertreibung oder Gleichgültigkeit zum Schweigen gebracht worden waren.
In diesem taktilen, gemeinschaftlichen Akt des Abkratzens konnte man einen Geist der Erinnerung und Wiederexistenz erfahren.
Als queerer Mann fühlte ich, wie diese Einladung tief in mir widerhallte. Auch wenn meine eigene Suche nicht die gleiche physische Gefahr wie die der Verschwundenen barg, ist sie doch eine Reise durch Schichten — die Sedimente von Scham, Schweigen und kultureller Unterdrückung. Jede Geste des Freilegens wurde zu einer Metapher des Werdens: eine Bewegung hin zur eigenen Wahrheit, eine Rückkehr zu dem Selbst, das unter auferlegten Identitäten verborgen liegt. In diesem taktilen, gemeinschaftlichen Akt des Abkratzens konnte man einen Geist der Erinnerung und Wiederexistenz erfahren, der uns aufforderte, nicht nur das freizulegen, was in der Welt verloren gegangen war, sondern auch das, was in uns selbst begraben liegt.
Indem ich mich als Teil dieser Gemeinschaft bekannte, musste ich auch die Strukturen betrachten, die versucht hatten, die LGBTIQA+-Gemeinschaft zum Schweigen zu bringen — in beiden kulturellen Kontexten, denen ich angehöre. Meine Geschichte erneut zu betrachten, bedeutete, die kolonialen und patriarchalen Systeme zu konfrontieren, die unsere Theologien in Österreich und Indien weiterhin prägen. In Indien trägt unsere theologische Vorstellungskraft noch immer die Überreste kolonialen Denkens, insbesondere in Bezug auf Queerness. Ist es nicht ein Paradox? Ich stamme aus einem Land, das einst erotische und göttliche Pluralität feierte — von der Kama Sutra bis zu Tempelreliefs, die queeres Begehren als heilig darstellen — und doch bleibt unsere Theologie gefesselt zögerlich, ängstlich vor ihren eigenen befreienden Wurzeln (vgl. Ruth, Kidwai). Wir bleiben im Gefängnis einer kolonialen Mentalität, die sich als Orthodoxie tarnt, weil sie eine sanfte, falsche Macht vorgaukelt. Der Geist jedoch ruft uns weiterhin zu einem anderen Horizont — einem Horizont, in dem Befreiung keine Bedrohung des Glaubens ist, sondern dessen eigentlicher Atem.
So zeigt sich die Dekolonisierung des Geistes nicht in neuen Theorien, sondern in der Praxis einer solidarischen Imagination.

Auf dem Rückweg vom Santiago-Fluss überreichte mir Alexander Serpas, ein Künstler aus El Salvador, der Widerstandsbewegungen malt, eine wild wachsende Ringelblume: „Drück die Spitze und rieche daran“, sagte er. Als ich dies tat, strömte ein wunderschöner Duft hervor — der Duft von Hoffnung mitten in Räumen, die ihr Wachstum behindern. Selbst auf vergiftetem Boden findet der Geist Wege, zu atmen — manchmal durch eine Blume, die trotz Giftigkeit blüht, manchmal durch uns.
Literatur:
Walsh, Catherine (2019): Keynote-Vortrag, gehalten auf dem IX. Kongress der International Academy of Practical Theology, São Leopoldo, Brasilien, 5. April 2019. Übersetzt mit DeepL.
Moltmann, Jürgen. Der Geist des Lebens: eine ganzheitliche Pneumatologie, Chr. Kaiser, 1991.
Pattanaik, Devdutt. The Man Who Was a Woman: Stories from the Mahabharata. Harrington Park Press, 2002.
Vanita, Ruth, and Saleem Kidwai. Same-Sex Love in India: Readings from Literature and History. Palgrave Macmillan, 2000
[1] Jürgen Moltmann, Der Geist des Lebens, eine ganzheitliche Pneumatologie Chr. Kaiser, 1991. Ff. s. 88.
[2] Walsh, Catherine (2019): Keynote-Vortrag, gehalten auf dem IX. Kongress der International Academy of Practical Theology, São Leopoldo, Brasilien, 5. April 2019. Übersetzt mit DeepL.
Anson Samuel ist Initiator von The Upper Room, Stadtjugendreferent der Diözese Linz und geistlicher Assistent der Katholischen Jugend Oberösterreich. Als Theologe engagiert er sich in der Regenbogenpastoral und initiiert sowie unterstützt Projekte wie den Queeren Kreuzweg und die Queere Schöpfungsfeier.
(Autorenfoto: Thomas Gramm)
Alle Bilder: privat (Anson Samuel)