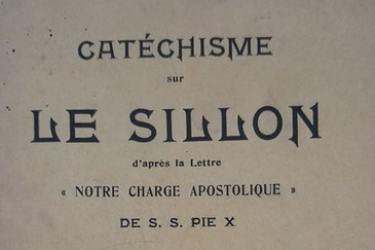Michael Haspel zu 500 Jahren Reformation in Weimar und Ereignissen, die das Ende der Gemeinde- bzw. Ratsreformation und den Beginn der Fürstenreformation markieren.
Es wird in der Schlosskirche wohl angenehmer als draußen in der Augusthitze gewesen sein, als sich am 17. August 1525 die Geistlichen des Amtes Weimar dort versammelten. Kurfürst Johann hatte sie eingeladen. Er wollte die kirchlichen Angelegenheiten ordnen, bevor er als Nachfolger seines Bruders Friedrich seine Residenz nach Torgau-Wittenberg verlegte. Zunächst predigten der Weimarer Pfarrer Johannes Grau und Schlossprediger Wolfgang Stein. Sie legten die Kernbotschaft des lutherisch verstandenen Evangeliums dar und forderten die Amtsbrüder auf, fortan „lauter und rein, ohne allen Zusatz und Einmischung menschlicher Lehre“ zu predigen. Dies richtete sich gegen die römisch-katholische Lehre und Liturgie.
Dann wurde der versammelten Geistlichkeit in Anwesenheit von Kurprinz Johann Friedrich ein Dekret verlesen, das nichts anderes bedeutete als die Einführung der Reformation durch die weltliche Herrschaft. Bislang hatten reformatorisch gesinnte Prediger in etlichen Thüringer Städten neben römisch-katholischen Priestern gewirkt. Johann ordnete an, dass nun überall evangelisch zu predigen und das Abendmahl in beiderlei Gestalt zu reichen sei. Das Messopfer und etliche andere Rituale wurden abgeschafft. Der Befehl wurde in Form eines Sendbriefes schnell verbreitet. Weimar wird ausdrücklich als Vorbild für die durchzuführenden Reformen genannt. Die exemplarisch im Amt Weimar durchgeführte Reformation wurde so Vorbild für das weitere ernestinische Territorium und wurde darüber hinaus nachgeahmt. Mit den vom Kurfürsten beauftragten Visitationen wurde die Durchführung in den folgenden Jahren kontrolliert.[1]
Die exemplarisch im Amt Weimar durchgeführte Reformation wurde Vorbild für das weitere ernestinische Territorium.
Damit wollte Johann die kirchlichen Angelegenheiten nach dem Bauernkrieg neu ordnen. Er und sein Hof hatten ja reformatorische Prediger im Thüringer Bereich ausdrücklich gefördert und Pluralität zunächst zugelassen – etwa mit Andreas Karlstadt in Orlamünde, Jakob Strauß in Eisenach, Thomas Müntzer in Allstedt und eben Wolfgang Stein in Weimar. Diese vertraten zum Teil abweichend von Luther durchaus eigenständige theologische Programme.[2] Allerdings wurden jetzt die von Luther und der Wittenberger Theologie abweichenden Positionen für den Aufstand des gemeinen Mannes (Bauernkrieg) verantwortlich gemacht. Luther schob die Schuld ganz Thomas Müntzer zu, um von den Vorwürfen gegen sich selbst abzulenken. Beriefen sich doch die Bauern in den 12 Artikeln auf Luther[3] und auch er wurde von altgläubiger Seite angegriffen.
Was wie ein Triumph der Reformation aussieht, ist in gewisser Hinsicht zugleich ihr Ende.
Was wie ein Triumph der Reformation aussieht, ist in gewisser Hinsicht zugleich ihr Ende.[4] Die in mehrfacher Hinsicht als befreiend empfundene evangelische Botschaft wird nun auf das individuelle Heil im Jenseits reduziert. Die Befreiung aus der Unterdrückung, die Zuwendung zu den Armen und Benachteiligten, das, was Ernst Bloch die Religion des Exodus nannte[5], wird zum Schweigen gebracht. In Melanchthons Unterricht der Visitatoren von 1528[6], der als Grundlage für die weitere Durchführung der Reformation diente, wird bei der Auslegung des 4. Gebots nicht nur der Gehorsam gegenüber der Obrigkeit betont und ausführlich dargelegt, sondern auch die Pflicht, die Obrigkeit zu ehren und pünktlich die Abgaben zu leisten. Dies solle in den Predigten vermittelt werden und mit möglichen Strafen Gottes gedroht werden. Die „Frohe Botschaft“ wird so zu einem moralischen Instrument der Sozialdisziplinierung, die auf den „regierbaren Untertanen“ zielt.[7] Dabei wurden wichtige Forderungen Luthers aus den frühen Jahren getilgt: Etwa die Wahl der Geistlichen durch die Gemeinde bzw. insgesamt eine stärkere Beteiligung der Gemeinde.
Die „Frohe Botschaft“ wird zu einem moralischen Instrument der Sozialdisziplinierung.
Frappierend ist, dass dies alles durch die Landesherrschaft veranlasst wird. Dies widerspricht klar Luthers eigener Unterscheidung von „weltlicher“ und „geistlicher“ Obrigkeit, wie er sie im Oktober 1522 ebenfalls in der Schlosskirche erstmals entfaltet hat.[8] Es ist nun der Kurfürst, der für seine Untertanen festsetzt, was zu glauben und zu predigen sei. Dies ging mit Intoleranz und Verfolgung gegenüber abweichenden reformatorischen Richtungen einher, etwa der Hinrichtung von vier Täufern 1530 in Reinhardsbrunn. Das könnte man auch als Ende der Reformation und Beginn der lutherischen Obrigkeits-, später Staatskirche ansehen,[9] wie sie bis 1918/19 bestand hatte und wiederum in Weimar mit der Weimarer Reichsverfassung von 1919 rechtlich abgelöst wurde.
Intoleranz und Verfolgung gegenüber abweichenden reformatorischen Richtungen
Seinen sichtbaren Ausdruck hat das in der Ikonographie des Cranach-Altars in der Weimarer Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche) von 1555 gefunden. Im Zentrum ist dominierend der gekreuzigte Christus dargestellt, von dem ein Blutstrahl in Richtung Lukas Cranach d. Ä. ausgeht. Dies verweist auf die von Luther betonte individuelle Erlösung durch den Glauben an Jesus Christus, durch dessen Tod die Sünde als überwunden angesehen wird. Die anderen Bildmotive verstärken diese Aussage noch, indem sie die Bedrohung durch den Teufel und die Notwendigkeit der Erlösung eindrücklich darstellen.
Dass Cranach und Luther neben und gleichwertig mit Johannes dem Täufer dargestellt werden, ist theologisch zumindest problematisch. Aber es passt in das theologisch-ikonographische Programm: Luther wird damit eine analoge Rolle zu Johannes dem Täufer zugeschrieben, als einer, der mit Vollmacht auf Christus verweist, und damit legitimiert ist, über den richtigen Glauben zu entscheiden. Diese Autoritätslegitimation wird durch die Seitenflügel fortgeführt, auf denen die herzogliche Familie dargestellt wird. Ihre Autorität wird durch die Darstellung als Wächter und Protektoren des wahren, lutherischen Glaubens legitimiert. Dieser Machtanspruch wird von der Tumba untermauert, die monumental vor dem Cranach-Altar platziert ist und so in der zentralen Blickachse liegt. Sie dient als Grablege für Herzog Johann Friedrich I., dem Sohn Kurfürst Johanns, und seiner Frau. Die Gemeinde schaut nun in jedem Gottesdienst auf den Herzog und seine Familie, der zusammen mit seinem Vater, nachdem sie anfänglich bereit waren, mit den Aufständischen zu verhandeln, nach der Schlacht von Frankenhausen in ihrem Territorium ein hartes Strafgericht gegen Aufständische und Verdächtige vollzog.[10] Das Bündnis von Thron und Altar kann nicht eindrücklicher demonstriert werden.
Die Gemeinde schaut nun in jedem Gottesdienst auf den Herzog und seine Familie.
Eine Woche nach der Versammlung in der Schlosskirche, am 24. August, hat Kurfürst Johann auch die materiellen kirchlichen Angelegenheiten geregelt. Er überließ dem städtischen Rat die Verwaltung der Pfarrgüter, also Immobilien, Vermögen und Abgabeneinnahmen, die nun in den Gemeinen Kasten flossen. Aus diesem sollten die Ausgaben für den Unterhalt der Kirchen, die Besoldung der Geistlichen sowie der Lehrer wie auch die Versorgung der Armen und Bedürftigen bezahlt werden.[11] Die Idee, die Einnahmen aus dem bisherigen Kloster- und Kirchenbesitz in so einem Gemeinen Kasten zu verwalten, war nicht neu. Dies gab es schon an anderen Orten. Aber dass dies von der Landesherrschaft angeordnet und dann sukzessive für das ganze Territorium eingeführt wurde, ist neu und entscheidend.[12] Zusammen mit der Abschaffung des Almosenwesens ist dies ein wesentlicher Faktor einer Sozialstaatskultur, welche die öffentliche Hand in der Verantwortung für Kultus, Bildung und Sozialfürsorge sieht, wie sie die Gesellschaften Mittel- und Nordeuropas bis heute prägt. Diese Tradition hört allerdings mit der Weimarer Reichsverfassung nicht auf, sondern in ihr werden sozialstaatliche Aufgaben festgeschrieben.[13]
… Faktor einer Sozialstaatskultur, welche die öffentliche Hand in der Verantwortung für Kultus, Bildung und Sozialfürsorge sieht.
Es ist wohl nicht zu viel gesagt, wenn man diesen Ereignissen im August 1525 weltgeschichtliche Bedeutung zumisst. Sie markieren das Ende der Gemeinde- bzw. Ratsreformation und den Beginn der Fürstenreformation in den reformatorischen Gebieten im Reich. Das von Johann entwickelte Modell wird von anderen Herrschaften übernommen. Dadurch wird einerseits die Reformation gesichert. Andererseits wird sie obrigkeitlich domestiziert. Die Beliebtheit Luthers und die Auflagenzahl seiner Schriften gehen drastisch zurück.[14] Diese Entwicklung trägt zur Festigung territorialer Herrschaft und der Ausbildung zentraler Staatlichkeit bei. So bedeutend diese Entwicklungen sein mögen, der Freiheits- und Gerechtigkeits-Impetus der frühen Reformation wurde unterdrückt und die bestehende feudale Herrschaft nicht nur stabilisiert, sondern noch gestärkt.
Der Freiheits- und Gerechtigkeits-Impetus der frühen Reformation wurde unterdrückt.
—
[1] Vgl. Blaha, Dagmar: „Das man das lauter rein Euangelion on menschliche zusatzunge predigen sol …“. Reformation in Weimar (Beiträge zur Reformationsgeschichte in Thüringen Band 13), Jena 2018, 37-41.
[2] Vgl. Bauer, Joachim; Michel, Stefan: Alternative Predigt? Beobachtungen zur kursächsischen Predigerlandschaft neben Luther, Karlstadt und Müntzer bis 1525 (Veröffentlichungen der Thomas-Müntzer-Gesellschaft e.V. Nr. 25), Mühlhausen: Thomas-Müntzer-Gesellschaft e.V 2018; Haspel, Michael; Bauer, Joachim (Hg.): Jakob Strauß und der reformatorische Wucherstreit. Die soziale Dimension der Reformation und ihre Wirkungen, Leipzig 2017.
[3] Vgl. Haspel, Michael: Ein bedeutender Impuls für die Freiheitsbewegung in Deutschland, 19.03.2025, https://www.uni-erfurt.de/forschung/aktuelles/forschungsblog-wortmelder/ein-bedeutender-impuls-fuer-die-freiheitsbewegung-in-deutschland#jump.
[4] Franz Lau weist zu Recht darauf hin, dass die Reformation „von unten“ in den norddeutschen Städten noch einige Jahre weiterging, aber kommt dann zu dem Ergebnis: „Die Tendenz zur Obrigkeitskirche hat sich schließlich auch in den norddeutschen Städten durchgesetzt[.]“ (Der Bauernkrieg und das angebliche Ende der lutherischen Reformation als spontane Volksbewegung, in: Lutherjahrbuch 26, 1959, 109-134, 132f.).
[5] Vgl. Bloch, Ernst: Atheismus im Christentum. Zur Religion des Exodus und des Reichs (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 563), Frankfurt a.M. 2. Aufl. 1977.
[6] Vgl. Bauer, Joachim; Blaha, Dagmar; Michel, Stefan: Der Unterricht der Visitatoren (1528). Kommentar – Entstehung – Quellen (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte Band 94), Gütersloh 2020.
[7] Vgl. Bauer, Joachim: Die ‚Weimarer Reformation‘ unter Johann dem Beständigen, in: Spehr, Christopher; Haspel, Michael; Holler, Wolfgang (Hg.): Weimar und die Reformation. Luthers Obrigkeitslehre und ihre Wirkungen, Leipzig 2016, pp. 59-82, hier 77; Blaha: Reformation in Weimar, 36.
[8] Vgl. Spehr, Christopher; Haspel, Michael; Holler, Wolfgang (Hg.): Weimar und die Reformation. Luthers Obrigkeitslehre und ihre Wirkungen, Leipzig 2016; Haspel, Michael: Luther, Kirche und der Staat, in: Glaube und Heimat, Nr. 44, 30. Oktober 2022, 1;
[9] Thomas Kaufmann spricht von einer „Verstaatlichung des Kirchenwesens“, ohne freilich die Ereignisse am 17. und 24. August zu erwähnen. Kaufmann, Thomas: Geschichte der Reformation, Frankfurt a. M. 2009, 510f.
[10] Vgl. Bauer, Joachim: „Den Anfang machte diese Wut“. Der Bauernkrieg in Thüringen 1525, Erfurt: (Landeszentrale für politische Bildung Thüringen) 2024, 83-86; Mandry, Julia: Die Reflexion der thüringischen, sächsischen und hessischen Fürsten über die Aufständischen im Bauernkrieg, in: Müller, Thomas T. (Hg.): Reformation und Bauernkrieg, Göttingen 2019, 149-171.
[11] Vgl. Blaha: Reformation in Weimar, 41-49.
[12] Vgl. Bauer, Joachim; [Blaha, Dagmar]: Gemeine Kästen in Kursachsen 1525 bis 1531, in: Akademie-Verlag (Hg.): Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus (12), Berlin 1989, 207-227; Mandry, Julia: Armenfürsorge, Hospitäler und Bettel in Thüringen in Spätmittelalter und Reformation (1300-1600) (Quellen und Forschungen zu Thüringen im Zeitalter der Reformation Band 10), Göttingen 2018; Oehmig, Stefan: Über Arme, Armenfürsorge und Gemeine Kästen mitteldeutscher Städte der frühen Reformationszeit, in: Oehmig, Stefan (Hg.): Medizin und Sozialwesen in Mitteldeutschland zur Reformationszeit (Schriften der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt 6), Leipzig 2007, 73-114.
[13] Vgl. Haspel, Michael: Weimar 1525 to Weimar 1919: From Reformation to Democracy. Online: https://www.europenowjournal.org/2018/04/16/from-weimar-1525-to-weimar-1919-from-reformation-to-democracy
[14] So schon der Paulskirchenabgeordnete Wilhelm Zimmermann noch vor der marxistischen Deutung (Zimmermann, Wilhelm: Geschichte des grossen Bauernkriegs, Essen o. J. (1841-43/1856), 427-430), mit einer interessanten theologischen Begründung von Freiheit und Gleichheit.

Apl. Prof. Dr. Michael Haspel lehrt Systematische Theologie an der Universität Erfurt und an der Friedrich Schiller-Universität Jena.
Bild: Miriam Lena Haspel
Beitragsbild: Altar der Herderkirche Weimar, Klaus Bärwinkel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=122128123