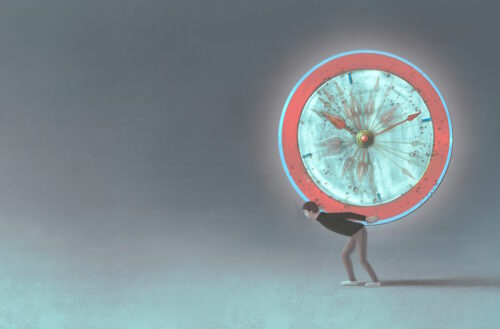Friederike Erichsen-Wendt skizziert Einsichten aus der Befragung des Predigerseminars Ratzeburg zu den Erwartungen, Pfarrer*in zu sein.
„So sind dann auch die Gemeinden gezwungen, genau zu beschreiben, was sie haben wollen. Momentan läuft das doch eh so ab: Sie wissen, sie kriegen eh eine PiP [d.h.: Pastorin im Probedienst] und fertig. So hätte man wenigstens gegenseitige (!) Bewerbungsgespräche und könnte schauen, ob es vor Ort passt.“
Theologiestudentin, Universität Rostock, Mai 2023[1]
Theologiestudierende heute unterscheiden sich grundlegend von früheren Generationen. Sie kennen die Kirche entweder sehr gut aus eigenem Erleben oder haben kaum Berührungspunkte mit ihr. In Zeiten eines ausgeprägten Fachkräftemangels werden sie stark umworben und zeigen nicht mehr die früher eher selbstverständliche Bereitschaft, ihr gesamtes Erwerbsleben durchgängig in einem Beruf zu verbringen. Das ist für Kirchen oft noch ungewohnt und herausfordernd, müssen sie doch oft unbewusste Zugangshindernisse identifizieren und abbauen, sich im Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte aktiv behaupten und so transparent wie möglich die unsichere Zukunft kirchlicher Berufe thematisieren.
Theologiestudierende in Zeiten eines ausgeprägten Fachkräftemangels
Die Befragung des Prediger- und Studienseminars der Nordkirche (2025, hier verlinkt), durchgeführt mit Unterstützung der Universität Kiel, liefert wichtige Erkenntnisse über die Sichtweise angehender Theologinnen und Theologen. Etwa 60% der befragten Studierenden streben den Pfarrberuf an, während 40% auch für andere berufliche Wege offen sind. Die große Zahl an Teilnehmenden (n=225) zeigt das Interesse der Studierenden, an einer besseren Passung zwischen Individuum und Organisation mitzuwirken. Doch diese Mitwirkung ist schlussendlich nur als echtes Zusammenwirken produktiv: Denn wie Kirchen den Rekrutierungs- und Einstellungsprozess gestalten, ist auch ausschlaggebend dafür, ob sich Menschen letztendlich für den Pfarrberuf entscheiden.
verbreitete Sorge vor einem Verlust persönlicher Autonomie
Ein zentrales Ergebnis der Befragung ist die verbreitete Sorge vor einem Verlust persönlicher Autonomie, die für viele Befragte eine große Hürde darstellt. Sie äußern Bedenken hinsichtlich unklarer Arbeitszeiten (60%), potenzieller Überforderung (70%), wachsender Verantwortungsbereiche (75%), fehlender klassischer Bewerbungsmöglichkeiten (70%) und der möglichen „Verschickung“ an unerwünschte Einsatzorte (75%). Weitere Sorgen betreffen die Abnahme von Ehrenamtlichen (65%), unklare Freizeitregelungen (58%), mangelnde Familienfreundlichkeit (58%), die sogenannte „Totalrolle“ als Pfarrperson (48%) und unzeitgemäße Erwartungen an die Einbindung der Pfarrfamilie (55%). All diese Faktoren haben aus Sicht der befragten Theologiestudierenden das Potenzial, als Einschränkung der persönlichen Selbstbestimmung wahrgenommen zu werden. Bemerkenswert ist hingegen, dass Fragen der Verbeamtung und des Pensionsalters nur für etwa 20% der Befragten aktuell bedenkenswert sind.
Trotz all dieser Bedenken verbinden die Studierenden auch viele positive Erwartungen mit dem Pfarrberuf. Sie schätzen besonders die sinnstiftende Tätigkeit (97%), die Abwechslung im Berufsalltag (95%), die Möglichkeit, eigene Akzente zu setzen (96%), und die Arbeit mit Menschen (93%). Diese Aspekte decken sich mit aktuellen gesellschaftlichen Trends bei der Berufswahl, bei der Sinnhaftigkeit und Selbstverwirklichung zunehmend im Vordergrund stehen. Erstaunlich ist, dass die Kirchen bisher den „Rückenwind“ dieser aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung kaum für ihre Kommunikation genutzt haben. Offensichtlich besteht auch hier eine gewisse Zurückhaltung, organisationale Anforderungen mit dem religiösen Gehalt kirchlicher Kommunikation zu bearbeiten.
Sinnhaftigkeit und Selbstverwirklichung bei der Berufswahl im Vordergrund
Interessant ist auch die Haltung zu traditionellen Aspekten des Pfarrberufs: Das Wohnen in einer Gemeinde stellt für 60% der Befragten keine relevante Hürde dar, während das Wohnen in einem Pfarrhaus für 65% nicht ausschlaggebend ist – wenn es denn eben nur am richtigen Ort steht. Dies zeigt eine Verschiebung in der Wahrnehmung des Berufsbildes, obwohl grundsätzlich ein eher „klassisches“ Bild des Pfarrdienstes vorherrscht, in dem persönliche Begabungen zum Ausdruck gebracht werden können.
Die Befragten legen großen Wert auf eine Arbeitsumgebung, die zu ihren eigenen Werten und Vorstellungen passt. Dazu gehört es, persönliche Stärken einzubringen und die Zukunft der Kirche aktiv mitzugestalten (80%). Gleichzeitig befürchten die Befragten Widerstände durch veränderungsresistente Gemeinden oder Kolleg*innen (jeweils bei 80%) . Die Frage, inwieweit die sinkende gesellschaftliche Bedeutung christlicher Kirchen sowie anhaltend hohe Austrittszahlen für das eigene Berufsverständnis relevant sind, wird von den Befragten nicht eindeutig bewertet (48%/55%), was berufsbiografisch betrachtet durchaus plausibel erscheint. Pfarrer*innen werden zukünftig viel Aufmerksamkeit darauf verwenden, Veränderungswünsche und ‑hindernisse auszutarieren – bei sich selbst und in ihren Verantwortungsbereichen.
Die Befragten befürchten Widerstände durch veränderungsresistente Gemeinden oder Kolleg*innen.
Vor diesem Hintergrund wird die Einarbeitung in den Pfarrberuf künftig sowohl für die Organisation als auch für die Berufsanfänger*innen auch jenseits theologischer Expertise im engeren Sinne anspruchsvoll sein. Konflikte zwischen institutionellen Anforderungen und individuellen Erwartungen sind unvermeidlich, sollten jedoch als sehr ernstgemeinte Lernchancen für beide Seiten begriffen werden. Ein wesentliches Problem ist dabei die mangelnde Transparenz kirchlicher Strukturen, die von 75% der Befragten kritisiert wird.
Konflikte zwischen institutionellen Anforderungen und individuellen Erwartungen sind unvermeidlich.
Der Wunsch nach wechselseitiger Annäherung würde davon profitieren, wenn bereits Studierende Erfahrungen mit Autonomie innerhalb des Berufsfeldes machen könnten. Deshalb sollten mehr Gelegenheiten geschaffen werden, um Studierende frühzeitig – auch in reflektierender Form – mit dem Beruf in Kontakt zu bringen. Die Befragung deutet an, dass diese Theorie-Praxis-Verbindung im Studium oft zu kurz kommt, was durch die hohe Zustimmung zum „mangelnden Praxisbezug“ des Studiums (knapp 60%) bestätigt wird.
gut, wenn bereits Studierende Erfahrungen mit Autonomie innerhalb des Berufsfeldes machen könnten
Ein weiterer Spannungsbereich betrifft das Verhältnis zwischen Beruf und Privatleben. Studierende lehnen Eingriffe in ihre persönliche Lebensgestaltung entschieden ab und erwarten, dass sich die Kirche auf den beruflichen Charakter des Arbeitsverhältnisses konzentriert. Konflikte entstehen besonders dort, wo die Organisation berufliche Anforderungen stellt, die mit der persönlichen Lebensgestaltung potenzieller Berufsrollenträger:innen kollidieren, etwa bei Tätigkeiten, die zeitlich oder räumlich schwer einzugrenzen sind. Große Hoffnungen liegen mancherorts deshalb auch auf der Rekrutierung neuer Personalgruppen mit anderen Lebensstilen, was allerdings den integrativen Aufwand der Organisation erhöht. Alternativ könnten bestehende Mitarbeitende stärker in die Entwicklung neuer Lösungen eingebunden werden, etwa zu Themen wie mobile Arbeit, digitale religiöse Praxis oder die Entwicklung von Anreizen, die auf Flexibilität einzahlen. Dazu ist eine klare Entscheidung nötig, diese Pfarrer*innen von regelhaften Routinetätigkeiten angemessen zu entlasten.
bestehende Mitarbeitende stärker in die Entwicklung neuer Lösungen einbinden
Die Erwartungen an die kirchliche Organisation sind seitens der Befragten klar definiert: Sie soll berufliche und finanzielle Sicherheit bieten, ohne dass dafür unbedingt ein Beamtenstatus mit seinen typischen Dienstpflichten erforderlich ist (ca. 80%). Zudem besteht ein großer Wunsch nach einer gabenorientierten Personalplanung, die individuelle Stärken und Talente berücksichtigt. Kirchliche Personalarbeit wird diesen Erwartungen nicht einfach entsprechen können, könnte aber durch transparente Kommunikation Glaubwürdigkeit gewinnen: Was sind „Gaben“? Wie werden sie besprechbar und ggf. auch vergleichbar gemacht? Inwiefern geht es nicht nur um die Stärkung von Stärken, sondern auch um das Schwächen von Schwächen? Kirchliche Organisationen können die Spannungen zwischen Autonomiebedürfnissen und beruflichen Anforderungen nicht auflösen. Sie tun aber gut daran, sie zu thematisieren, um sie auf diese Weise bearbeitbar zu machen.
Spannungen zwischen Autonomiebedürfnissen und beruflichen Anforderungen thematisieren
Hier zeigt sich ein grundlegendes Spannungsverhältnis: Berufsanfänger:innen wünschen sich Flexibilität bei gleichzeitiger organisatorischer Verlässlichkeit, während die Kirche als Organisation Flexibilität benötigt, aber auf verlässliche Mitarbeitende angewiesen ist. Hohe wechselseitige Ansprüche lösen beidseitig Befremden aus – seitens der Organisation vor allem durch die hohen Ansprüche Einzelner sowie den Grad an Sorge, der zum Ausdruck kommt.
hohe wechselseitige Ansprüche an Flexibilität und Verlässlichkeit
Beides ist nicht nur eine Frage der persönlichen Disposition oder Generationszugehörigkeit, sondern auch Folge fortschreitender Säkularisierung: Kirchliche Beruflichkeit erscheint zunehmend „unselbstverständlich“ und wird gleichzeitig in die Logik anderer Erwerbstätigkeiten eingeordnet. In einer religiösen Organisation bleibt dabei immer ein „diffuser Rest“.
Angehende Pfarrer*innen sind sich sehr wohl bewusst, dass sie auch berufsbiografisch in eine offene Situation eintreten. Sie treffen diese Entscheidung freiwillig und im Bewusstsein der Herausforderungen. Hilfreich ist, wenn Kirchen dann sagen können, welche Kompetenzen und personalen Einstellungen sie benötigen, um den tiefgreifenden Wandel kirchlichen Lebens so mitzugestalten, dass das Evangelium weiterhin unter den Menschen in Bewegung sein kann.
Schlüsselmomente sind Kontaktgelegenheiten während des Studiums sowie die Übergänge in Vikariat und Probedienst
Der Einstieg in den Pfarrberuf gestaltet sich heute voraussetzungsreich. Menschen kommen nicht „von selbst“. Schlüsselmomente sind Kontaktgelegenheiten während des Studiums sowie die Übergänge in Vikariat und Probedienst. An diesen Punkten können positive Begegnungen mit kirchlichen Personen sowie schlüssige organisationale Prozesse die Berufsentscheidung maßgeblich fördern.
die mit der Berufsrolle verbundene Symbolpolitik als zentrale Kontaktgelegenheit in die Gesellschaft
Auch weiterhin bleibt der Pfarrberuf von zentraler Bedeutung, um Menschen mit dem christlichen Glauben in Berührung zu bringen und kirchliches Leben unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen lebendig zu halten: Die mit der Berufsrolle verbundene Symbolpolitik ist inmitten der ausdifferenzierten kirchlichen Landschaft von Berufen, Ämtern und Diensten weiterhin eine zentrale Kontaktgelegenheit in die Gesellschaft hinein.

Dr. Friederike Erichsen-Wendt, Theologin und Organisationsentwicklerin, beschäftigt sich seit vielen Jahren in Forschung und Praxis mit pastoraltheologischen und kirchentheoretischen Fragestellungen.
Bild: Getty Images / Unsplash
Transparenzhinweis: Eine erste Entwurffassung dieses Textes entstand mit Hilfe eines LLM. Eine Langversion des Textes finden Sie auf der Seite des Predigerseminars der Nordkirche.
[1] Das Zitat steht im Kontext einer Diskussion, ob die Entsendungspraxis von Pastor*innen zukünftig eher in Gestalt eines gegenseitigen Bewerbungsverfahrens gedacht werden könnte.