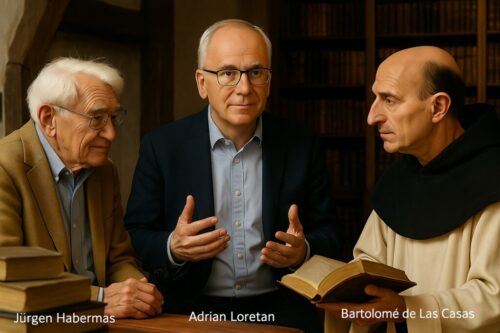Die Rechtswissenschaft der Kirche hat Europas Rechtskultur geprägt. Sie ist gefordert, auch für die heutige Infragestellung von Rechtsstaat, Demokratie und Menschenrechten Lösungen zu bieten. Zudem gilt es, in den eigenen Reihen Machtmissbrauch zu überwinden und die subjektiven Personen- und Mitentscheidungsrechte aller Getauften im Kirchenrecht zu verankern. Adrian Loretan im Gespräch mit Daniel Kosch.
Nach rund 30-jährigem Wirken als Professor für Kirchenrecht und Staatskirchenrecht sowie als Co-Direktor des interfakultären Zentrums für Religionsverfassungsrecht an der Universität Luzern wird Adrian Loretan emeritiert. Er hat sich mit Fragen der Menschenrechte, der Gleichstellung der Gläubigen in der Kirche und der Mitwirkung der Laien in Seelsorge und Kirchenleitung befasst. Er fragte nach den strukturellen Ursachen von Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt von Amtsträgern. Vor dem Hintergrund der direkt-demokratischen Rechtskultur des Schweizer Staatskirchenrechts stellten sich ihm zudem Fragen des Verhältnisses von kirchlichem und staatlichem Rechtsdenken. Dabei kam er zum Schluss, dass die modernen staatlichen Verfassungen ohne die Menschenrechtsentwicklung und die Demokratietheorie der Spanischen Klassiker des Naturrechtes im 16. Jh. nicht denkbar sind. Die Kirche solle diese eigene demokratische Rechtstradition vor ihren Mitgliedern nicht verstecken.
Freiheit und Anerkennung subjektiver Rechte spielen schon in der mittelalterlichen Rechtswissenschaft eine zentrale Rolle.
DK: Dein neues, umfangreiches Buch trägt den Titel «Der demokratische Rechtsstaat – eine Ideengeschichte» (Link). Und Deine Abschiedsvorlesung in Luzern (Link) widmest Du «dem demokratischen Rechtsstaat und der Rechtskultur des Westens und der Westkirche». Warum misst Du als Professor für Kirchenrecht und Staatskirchenrecht diesen Themen eine so grosse Bedeutung zu?
AL: Mit dem Begriff «Kirchenrecht» verbinden viele Stichworte wie «hierarchisch», «vormodern», «undemokratisch». Von anderen Wissenschaften habe ich gelernt, dass der freiheitliche Verfassungsstaat und die Menschenrechte auf Grundlagen beruhen, die von Kirchenrechtlern im Mittelalter und in der frühen Neuzeit entwickelt wurden. Denn die Freiheit und die Anerkennung subjektiver Rechte jedes Menschen spielen schon in der mittelalterlichen Rechtswissenschaft der Kirche eine zentrale Rolle. Insofern kann das Recht der mittelalterlichen Kirche, wie es die Spanischen Klassiker des Naturrechts im 16. Jh. dann ausbuchstabierten, als «liberal» bezeichnet werden. Allen voran ist dabei der Kirchenrechtler Bartolomé de Las Casas (1484-1566) zu erwähnen, der als «Kant avant la lettre» gelten kann.
Die im kirchlichen Kontext entstandene demokratische
Tradition aus der Zeit vor der Französischen Revolution
wurde verdrängt.
DK: Verstehe ich Dich richtig, wenn ich daraus –zugespitzt – folgende zwei Thesen ableite? 1. Die kirchliche Rechtskultur war entscheidend für die Entstehung der Rechtskultur des Westens, die Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und Demokratie umfasst. 2. Nach der Französischen Revolution hat die römisch-katholische Kirche diese Rechtstradition jedoch verdrängt und verweigert ihren eigenen Mitgliedern die Freiheitsrechte, weil sie nur so an ihrem vom Absolutismus geprägten Amtsverständnis festhalten kann.
AL: Die der absoluten Monarchie Louis XIV. nachgebildete Lehre von der Kirche (Ekklesiologie), welche das Kirchenrecht seit dem Ersten Vatikanischen Konzil (1870) prägt, lässt uns glauben, dass Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung nichts mit der Rechtsgeschichte der Kirche zu tun hätten. Es waren Autorinnen und Autoren aus der Politikwissenschaft, Soziologie, Humanistic Studies, Rechtsgeschichte, Philosophiegeschichte, Profangeschichte, wie Anna Grzymala-Busse (Standford), Harold Berman, Tine Stein, die mich auf die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit im kanonischen Recht aufmerksam machten. Der Westen als Rechtsgemeinschaft wurzelt in der Rechtskultur der Westkirche (Link). Aber diese im kirchlichen Kontext entstandene demokratische Rechtstradition wird seit der Französischen Revolution verdrängt: Die einen reklamierten sie als Errungenschaft von Aufklärung und Revolution, für die anderen war sie unvereinbar mit dem hierarchischen Selbstverständnis der Kirche nach dem Vatikanum I.
DK: Um den Dialog zwischen der Rechtswissenschaft der Kirche und jener des Staates wieder aufnehmen zu können, plädierst Du dafür, die freiheitliche Denktradition des mittelalterlichen Naturrechts bzw. Vernunftrechts neu zu entdecken. Auf dieser Basis könnte einerseits die Rechtwissenschaft der Kirche wieder anschlussfähig werden, anderseits würde damit auch die Legitimation des weltweit unter Druck stehenden Rechtsstaates gestärkt. Wie könnte das Deines Erachtens konkret geschehen?
AL: Im Mittelalter wurde der griechische Philosoph Aristoteles (384-322 v. Chr.) für Westeuropa entdeckt. Das hatte für das Rechtsverständnis einschneidende Folgen. Staatliche Macht wurde nicht mehr auf der Basis der Erbsündenlehre von Augustinus (354-430 n. Chr.) begründet. Sie basiert nicht auf dem Auftrag, dem Unrecht und dem Bösen zu wehren, sondern hat ihr Fundament im Wesen des Menschen als politischem Lebewesen. Eine Schlüsselgestalt für diese Wende war Thomas von Aquin (1225-1274), der nicht nur als Theologe und Kirchenlehrer, sondern auch als Rechtsphilosoph wirkte und ein in der Vernunft verankertes Rechtsverständnis vertrat. Der italienische Historiker Paolo Prodi (1932-2016) bezeichnet dies als «einen der grössten Wendepunkte überhaupt in der Geschichte des abendländischen politischen Denkens», der den Weg hin zur Lehre von der demokratischen Partizipation und zur Freiheit eröffnete.
Die auf den Rechten des Einzelnen und auf geteilter
Verantwortung basierende liberale Rechtstradition
überlebte an den Rändern der Institution.
Obwohl die Kirche eine theologische Zielsetzung hatte, entwickelte die Westkirche als erste Rechtsinstitution die meisten Merkmale des späteren säkularen Rechtsstaates. Sie verstand sich schon zu Beginn des zweiten Jahrtausends als unabhängige, öffentliche Gewalt und übte gesetzgebende, ausführende und rechtsprechende Gewalt eines modernen Staates aus. Dank dieses kirchlichen Rechts entstanden demokratische Institutionen wie die Universitäten im Bildungsbereich, die Zünfte im Wirtschaftsbereich, die Korporationen im Bereich der Landwirtschaft oder das öffentliche Recht im staatlichen Bereich. Diese Rechtkultur der Westkirche ist entscheidend für die Rechtsentwicklung des Westens als Gemeinschaft von demokratischen Rechtsstaaten.
Zwar drängte die Papst- und Bischofskirche diese demokratische Rechtskultur schon im Vorfeld des Vatikanum I zurück und stärkte einseitig das hierarchische und monarchische Prinzip. Aber die auf den subjektiven Rechten des Einzelnen und auf geteilter Verantwortung basierende liberale Rechtstradition überlebte an den Rändern der Institution, beispielsweise in Ordensgemeinschaften, ortskirchlichen Bischofswahlrechten oder staatskirchenrechtlichen Körperschaften in der Schweiz bis heute.
DK: «Synodalität» ist derzeit das meistverwendete «Zauberwort» für die Kirche der Zukunft. Es geht einher mit der Forderung nach der Überwindung von Klerikalismus und Zentralismus, nach mehr «Partizipation» und «gemeinsamem Beraten und Entscheiden» und knüpft damit an diese Rechtstradition an. Weil mit Papst Leo XIV. nun ein Kirchenrechtler an der Spitze der Weltkirche steht, besteht die Hoffnung, dass er das synodale Prinzip stärker im Kirchenrecht verankert. Hast Du Ideen oder Vorschläge für kirchenrechtliche Bestimmungen, die dafür sorgen, dass sich wirklich etwas ändert?
Kirchliche ‘Demokratie’ erwächst aus der inneren Struktur der kirchlichen Ordnung selbst (Joseph Ratzinger).
AL: Synode heisst vom Wortsinn her «gemeinsamer Weg». Synodalität bedeutet also: Das Volk (griech. demos) geht den Weg gemeinsam und hat Teil an der beratenden, beschliessenden und gesetzgebenden Versammlung der Bischöfe, also am Herrschen (griech. kratein) oder Leiten der Kirche. Diese Beteiligung umfasst zuerst das Mitreden, dann aber auch das Mitentscheiden. Beide Formen der Beteiligung des Kirchenvolkes an der Leitung der Kirche müssen nach der Bischofssynode von 2024 rechtlich geregelt werden.
Das ist nicht – wie oft behauptet – eine theologisch unzulässige Übernahme von demokratischen Mechanismen aus dem staatlichen Bereich, sondern entspricht der ureigenen demokratischen Rechtstradition der Kirche. Kein Geringerer als der spätere Kardinal und Papst Joseph Ratzinger sprach 1970 von Formen der synodalen Mitverantwortung als «klassischem Modell kirchlicher ‘Demokratie’, die nicht aus einer sinnlosen Übertragung kirchenfremder Modelle, sondern aus der inneren Struktur der kirchlichen Ordnung selbst erwächst». Diese Überzeugung bestätigte er dreissig Jahre später als Präfekt der Glaubenskongregation ausdrücklich.
DK: Bevor Du 1996 in Luzern die Professur für Kirchenrecht und Staatskirchenrecht übernahmst, standen in der Schweiz lokale Probleme in deinen Arbeiten im Vordergrund. Angesichts von Diskussionen über die «Trennung von Kirche und Staat» gabst Du damals das viel beachtete Buch «Kirche und Staat im Umbruch» (1995) heraus, kurz zuvor war Deine Dissertation zu «Laien im pastoralen Dienst. Ein Amt in der kirchlichen Gesetzgebung» erschienen (1994). Weitere Themen waren der Kirchenaustritt oder das Verhältnis zwischen Kirchgemeinde und Pfarrei. Wie blickst Du auf diese Zeit zurück?
AL: Hinter diesen Auseinandersetzungen stand die Frage: Widerspricht die demokratische Tradition des Staatskirchenrechts in vielen Kantonen der Schweiz der kirchenrechtlichen Tradition? Einflussreiche Kirchenrechtler haben dies bejaht. Also musste ich für meine Gegenpositionen entsprechende rechtshistorische Belege liefern. Denn in der Kirche hat das Traditionsargument grosses Gewicht. Im neuesten Buch «Der demokratische Rechtsstaat – eine Ideengeschichte» zeige ich, dass die demokratischen Institutionen im Staatskirchenrecht die Hüter der mittelalterlichen Kirchenrechtstradition sind.
DK: Wie kam es dazu, dass sich der Schwerpunkt Deiner Arbeit so stark in Richtung sehr grundsätzlicher rechtsphilosophischer Fragen verlagert hat?
AL: Das Recht rechtspositiv zu interpretieren ist eine Sache. Die rechtsphilosophische Frage, ob das positive Recht legitim ist, liegt auf einer ganz anderen Ebene, wie mir Immanuel Kant (1724-1804) in bester naturrechtlicher Tradition beibrachte. Es genügt nicht, die Frage zu klären, wie etwas rechtlich geregelt ist. Sondern es muss auch geklärt werden, ob die rechtliche Regelung tatsächlich für Gerechtigkeit sorgt.
Die Forderung nach Gerechtigkeit ist in der Moderne öffentlich nur zu legitimieren,
wenn auf die Autonomie des Einzelnen
Bezug genommen werden kann.
Das kritische Nachdenken darüber, welches Recht legitim ist und welches nicht, wird seit Aristoteles (384-322 v. Chr.) unter dem Begriff Naturrecht verhandelt. Seit der Aufklärung spricht man von Rechtsphilosophie. Es ging mir um die rechtshistorische Entwicklung dieser über die Jahrhunderte sich verändernden Ideen von Gerechtigkeit. Mein Verständnis von Naturrecht unterscheidet sich daher grundsätzlich vom statischen Naturrechtsbegriff der Neuscholastik.
„Euch muss es zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gehen“ (Mt 6,33). Wie dieses Wort aus der Bergpredigt konkret zu verstehen ist, darüber haben die Rechtswissenschaftler der Kirche naturrechtlich bzw. rechtsphilosophisch nachgedacht, immer zeitbedingt. Diese Zeitbedingtheit wird erst aufhören im Jüngsten Gericht, wenn wir realisieren, was Gerechtigkeit wirklich ist! So lange bleiben wir Suchende.
Das Decretum Gratiani (1140), ein Gründungsdokument der Rechtswissenschaft der Kirche, stellt die naturrechtliche bzw. rechtsphilosophische Frage direkt an den Anfang. Es geht aus von der «Goldenen Regel», die nicht nur in der Bibel (Mt 7,12), sondern auch in anderen religiösen und philosophischen Traditionen überliefert ist. Gratian hält fest: «Das Naturrecht […] weist jeden an, andere so zu behandeln, wie er selbst behandelt sein will, und verbietet andere zu behandeln, wie man selbst nicht behandelt werden will». Damit wird erstmals ein Recht formuliert, das prinzipiell für jeden Menschen gilt, und zwar für alle gleichermassen, und das die menschliche Freiheit in den Blickpunkt rückt. Dieser Ansatz ist deshalb zentral, weil die Forderung nach Gerechtigkeit in der Moderne öffentlich nur zu legitimieren ist, wenn auf die Autonomie des Einzelnen Bezug genommen werden kann (Axel Honneth).
Allerdings war es ein sehr langer Lernprozess, bis die römisch-katholische Kirche diese Autonomie des Rechtssubjektes für alle anerkannte, namentlich auch für Andersgläubige. Sie wehrte sich dagegen bis zur Erklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Religionsfreiheit (1965).
Was, wenn Papst Leo Dich um drei konkrete Vorschläge für die Reform des Kirchenrechts bitten würde?
DK: Zum Abschluss eine zukunftsgerichtete Frage: Was würdest Du antworten, wenn Papst Leo Dich als frisch emeritierten Professor mit mehr freier Zeit bitten würde, ihm drei konkrete Vorschläge für eine Reform des geltenden Kirchenrechts zu unterbreiten, dank denen das verdrängte kirchenrechtliche Erbe wieder zur Geltung käme?
AL: Der Theologe Thomas von Aquin (1225-1274) betont, dass die Vorschriften, die der Kirche von Christus vorgegeben sind, «äusserst wenige» sind (Thomas, STh, I–II, q. 107, a. 4). Daraus hat Papst Franziskus geschlossen, dass wir keine Angst haben sollten, kirchliche Normen zu revidieren, selbst wenn sie tief in der Geschichte verwurzelt sind (Evangelii gaudium Nr. 43). Die Freiräume der Rechtsgestaltung sind also bedeutend grösser als oft angenommen.
Mein erster Vorschlag lautet: In einer absoluten Monarchie sind Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt von Amtsträgern schwierig zu bekämpfen. Deshalb sollte die Rechtskirche gemäss ihrer eigenen mittelalterlichen Rechtstradition die Gewaltenteilung einführen. Dies hat kürzlich auch Bischof Charles Morerod, Präsident der Schweizer Bischofskonferenz, in einem Interview in der Neuen Zürcher Zeitung gefordert.
«Wo keine wahre Gerechtigkeit ist, gibt’s auch kein Recht»
(Augustinus).
Zweitens: In der Moderne wird die Freiheit jeder Person durch die Menschenrechte geschützt. Eine Rechtsinstitution, die diese subjektiven Rechte ignoriert, verliert die Legitimität vor den eigenen Mitgliedern, weil ihre Gesetzgebung die Standards einer gerechten Rechtsordnung unterbieten. Eine Rechtsordnung, welche die Rechte der Personen nicht schützt, kaschiert die Diktatur der Machtträger mit ungerechtem, nicht legitimem Recht. Schon Augustinus (354-430) hält fest: «Wo keine wahre Gerechtigkeit ist, gibt’s auch kein Recht. Denn was rechtmäßig ist, das ist auch gerecht, und was ungerecht ist, kann nicht rechtmäßig sein. Ungerechte menschliche Anordnungen kann man nicht Recht nennen oder für Recht halten», falsch sei auch die Ansicht, «Recht sei, was dem Stärkeren nützt. Wo demnach keine wahre Gerechtigkeit ist, kann es auch keine durch Rechtsgleichheit verbundene Menschengemeinschaft geben».
Und drittens: Das mittelalterliche Papsttum formulierte erstmals im öffentlichen Recht der Kirche den Grundsatz: «Was alle angeht, muss von allen behandelt und entschieden werden.» Diese mittelalterliche Rechtsregel des kanonischen Rechts veranschaulicht sehr präzise, wie Demokratisierung der Kirche verstanden wird.
DK: Vielen Dank für das Gespräch. Ich beschliesse es mit einem Satz aus dem letzten Abschnitt Deines neuen Buches, dem ich gerne zustimme: «Gerade in Zeiten der Krise und des Staats- und Kirchenversagens angesichts der sexualisierten Gewalt von Amtsträgern kann es inspirierend und ermutigend sein, zu den Wurzeln dieser Rechtskultur des Westens zurückzukehren».

Daniel Kosch, Dr. theol., leitete von 1992-2001 die Bibelpastorale Arbeitsstelle SKB und war von 2001-2022 Generalsekretär der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ) . Seit 2023 ist er Präsident des Schweizerischen Katholischen Bibelwerks.
Jüngste Publikation: «Synodal und demokratisch. Katholische Kirchenreform in schweizerischen Kirchenstrukturen» (Edition Exodus, Luzern 2023).

Adrian Loretan, Luzern (Schweiz), geb. 1959, Ordinarius für Kirchenrecht und Staatskirchenrecht; Co-Direktor des interfakultären Zentrums für Religionsverfassungsrecht, Universität Luzern. Herausgeber der Reihen: ReligionsRecht im Dialog (38 Bde.) und Religionsrechtliche Studien (7 Bde.).
Wichtige Veröffentlichungen: Der demokratische Rechtsstaat – eine Ideengeschichte. Zur Rechtskultur des Westens und der Westkirche, Zürich 2025; Kanonistik – Rechtswissenschaft oder Theologie? (QD 336), Freiburg 2024 (gemeinsam mit Judith Hahn), Machtmissbrauch und sexuelle Gewalt in der Kirche, Zürich 2023 (als Herausgeber); Wahrheitsansprüche im Kontext der Freiheitsrechte, Zürich 2017.
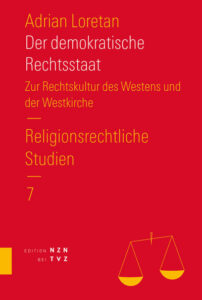
Die Abschiedsvorlesung von Adrian Loretan, Der demokratische Rechtsstaat – Zur Rechtskultur der Westkirche, findet am 1. Oktober 2025 um 16.00 Uhr in der Jesuitenkirche Luzern statt.
(Beitragsbild: erstellt mit Hilfe von ChatGPT)