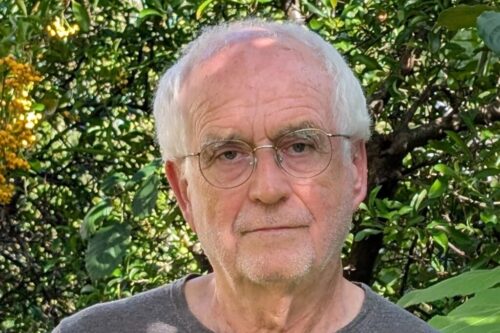Wissenschaftliche, religiöse und alternative Wahrheiten und ihr jeweiliger Handlungsbezug. Von Bernhard Laux[1]
Wahrheit ist – ähnlich wie Gerechtigkeit – ein Begriff, bei dem der Plural Unbehagen bereitet. Erhoben wird nämlich ein universalistischer Geltungsanspruch: Wer für eine Feststellung Wahrheit beansprucht, will ja nicht sagen, dass sie für ihn wahr ist, sondern dass sie überhaupt und für alle wahr ist.
Darf man also von Wahrheiten sprechen, muss es vielleicht sogar? Unproblematisch ist der Plural dort, wo er auf die Vielzahl der Sachverhalte Bezug nimmt, über die wahre Aussagen möglich sind. Beispielsweise sprechen wir von der Wahrheit des Glaubens und von Glaubenswahrheiten. Aber vielleicht ist der Begriff der Wahrheit darüber hinaus ein Polysem, der auf unterschiedliche Phänomene abhebt, die einerseits erhebliche Ähnlichkeiten, andererseits aber auch deutliche Unterschiede aufweisen.[2] Davon geht der Beitrag aus. Sein Interesse richtet sich dabei besonders auf den Handlungsbezug, also auf den Zusammenhang zwischen Wahrheitsannahmen und Praxisfolgerungen, der für die Ethik besonders relevant ist.
1. Wissenschaftliche Wahrheit und Wirksamkeit des Handelns
Wissenschaftliche Aussagen über das, was der Fall ist, erheben den Anspruch universaler Geltung. Wenn die methodologischen Regeln eingehalten sind und die einzelnen Schritte im Erkenntnisprozess dem kritischen Diskurs in der scientific community standgehalten haben, kann dieser Anspruch das Sigel der Gültigkeit erhalten. Der kritische Diskurs in der scientific community ist die entscheidende Prüfinstanz und fungiert als Wahrheitskriterium. Die zugesprochene Gültigkeit ist immer vorläufig, fallibel und durch weitere wissenschaftliche Arbeit überholbar. Damit ist auch ein Zeitindex gesetzt – der in die Unendlichkeit weist.
Als wahr anerkanntes wissenschaftliches Wissen kann handlungsbedeutsam sein, wenn es als Grundlage für erfolgversprechendes Handeln bzw. für wirksame Techniken der Intervention in die Welt genutzt werden kann. Es nimmt instrumentellen Charakter an, so dass sich– hypothetische – Imperative gewinnen lassen: Wenn dieses Ziel verfolgt wird, dann ist jenes zu tun.[3]
Einige erläuternde Stichpunkte hierzu:
- Die Perspektive der Wirksamkeit verwickelt Wissenschaft in gesellschaftliche Verhältnisse und Wertsetzungen. Wirksamkeit ist notwendig auf ein Ziel bezogen, das aber von der Wissenschaft nicht selbst ausgewiesen werden kann. Die Bewertung der Wünschbarkeit und Relevanz von Zielen sowie die Bewertung von Chancen und Risiken der Nutzung in gesellschaftlichen Handlungsfeldern kann nur als kooperatives Geschehen von wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Akteuren gelingen.
Der wissenschaftliche Impetus, durch Erkenntnis – um mit Francis Bacon zu sprechen – zugleich die „Lage der Menschheit zu verbessern“ [4], der Gedanke, dass Wissenschaft zu einer gesteigerten Handlungsrationalität in gesellschaftlicher Praxis beitragen kann und soll, verweist darin zugleich auf die Grenzen der Wissenschaft, auf die unausweichliche Verbindung mit anderen Rationalitätsdimensionen sowie mit gesellschaftlichen Gruppen und politischen Akteuren, wenn Wissenschaft Handlungsbezug gewinnen soll. - Die Frage, ob Wissenschaft mit dieser Grenze angemessen umgeht oder mehr Handlungsfähigkeit beansprucht, als sie kann und darf, wird unter verschiedenen Begriffen thematisiert: Mit Szientismus und Technizismus wird die Hybris der Vorstellung benannt und kritisiert, dass Wissenschaft und Technik die gesellschaftlichen Herausforderungen und Menschheitsprobleme lösen, damit unter der Hand die Ziel- und Wertefragen entscheiden und vielleicht sogar die großen Menschheitsfragen des Woher und Wohin von Mensch, Welt und Geschichte beantworten könnte. In den Debatten um das Konzept einer transformativen Wissenschaft im Blick auf die großen Herausforderungen ist die Frage solcher Grenzüberschreitung virulent.[5]
- Auf die Schnittstelle von Wissenschaft und Politik bezieht sich die These der „Epistemisierung des Politischen“[6] und stellt die Frage, ob Politik sich bei ihrer Aufgabe gesellschaftlich verbindlichen Entscheidens, die immer auch Interessen- und Wertkonflikten moderieren muss, nicht hinter einer als interessen- und wertfrei vorgestellten Wissenschaft und deren Autorität versteckt, um politische Entscheidungen als wissenschaftlich induzierte alternativlose Lösungen darstellen zu können.
Die Wahrheitsorientierung der Wissenschaft hat einen nicht nur nachfolgenden Handlungsbezug, sondern auch einen vorausgehenden. Wissenschaft ist kein Katalog gesicherter Erkenntnisse, vielmehr selbst eine soziale Praxis. An die Ausgestaltung dieser sozialen Praxis richten sich im Interesse der Wahrheitserkenntnis bestimmte normative Anforderungen. Diese epistemische Normativität zielt auf die Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und richtet sich dabei auf die Haltungen der Forschenden, auf die Regeln und Verfahrensweisen in der wissenschaftlichen Arbeit, auf die Steuerungsstrukturen des Wissenschaftssystems und verweist schließlich auch auf gesellschaftliche und politische Bedingungen, die einem universalistischem Wahrheitsanspruch verpflichtete Wissenschaft erst möglich machen.[7] Wissenschaftsfreiheit ist offensichtlich eine gesellschaftliche Bedingung, aber genauso Wissenschaftsgerechtigkeit, die einen offenen Zugang zur Wissenschaft und zu ihren Ergebnissen verlangt, der nicht nach Geschlecht, Ethnie, sozialer und regionaler Herkunft selektiert, also Gleichheit, Diversität und Gerechtigkeit achtet.[8] Die mit der Wahrheitsorientierung der Wissenschaft verbundenen Anforderungen an die Struktur der Wissenschaft und an die gesellschaftlichen Bedingungen einer wissenschaftsverträglichen Gesellschaft betreffen auch politische Bedingungen und haben politische Qualität, die nicht jedem gefallen – Donald Trump jedenfalls nicht.
2. Religiöse Wahrheit im Heilsbezug
Angesichts der Schwierigkeiten eines allgemeinen Religionsbegriffs, die hier nicht thematisiert werden können, beschränken sich die Ausführungen auf das Christentum – und da, wo es eine Differenz ausmacht, auf die katholische Konfession.
Mit dem christlichen Glauben sind propositionale Gehalte verbunden: Die Aussagen „es gibt Gott“ und „es gibt das Higgs-Boson[9]“ scheinen in ihrer sprachlichen Form gleich und unterscheiden sich doch in ihrem Sinn und in der Art und Weise, in der der Wahrheitsanspruch erhoben und hinterlegt wird. Für die Argumentation will ich wenige Punkte festhalten:
- Im Glauben wird eine bestimmte Konstitution der Wirklichkeit nicht behauptet, sondern bekannt. Das Glaubensbekenntnis ist die entsprechende charakteristische Form. Es ist ein individueller Akt – credo/ich glaube –, der sich zugleich dem in der Glaubensgemeinschaft kollektiv geteilten und auf Schrift und Tradition gestützten Bekenntnis anschließt und sich darin einfügt. Schließlich wird es in seiner liturgischen Form von jedem Einzelnen gemeinsam in einer Gemeinschaft von Glaubenden vor Gott vollzogen. Diejenigen, die so ihren Glauben bekennen, vergewissern sich dabei zugleich ihrer spezifischen kollektiven Verbundenheit in ihrem Gottesverhältnis.[10]
- Das Bekenntnis des Glaubens geht ersichtlich nicht in der Konstatierung einer transzendenten Welt auf, sondern bezieht sich auf eine Heilsgeschichte, eine Heilswirklichkeit. Eröffnet wird ein nicht allein individualistisch, sondern auch und besonders kollektiv zu verstehender Heilsweg, der mit einer ethischen Lebenspraxis eng verwoben ist. Kognitive und praktische Dimension, Orthodoxie und Orthopraxie sind eng aneinander gekoppelt.
- Christinnen und Christen bekennen den einen Gott, der Gott der ganzen Welt und aller Menschen ist, und dessen Heilswille sich auf die ganze Menschheit richtet. Dieser universale Heilsbezug ist der Gemeinschaft der Glaubenden eingeschrieben. Zugleich ist sichtbar, dass diese eine partikulare Größe ist: Weder global noch regional noch lokal umfasst sie alle Menschen. Und der christliche Glaube bestimmt und überwölbt – im Sinne eines „heiligen Baldachins“[11] – kaum mehr die kulturelle Deutungs- und Orientierungsebene von Gesellschaften. Die Spannung zwischen universalem Anspruch und faktischer Partikularität muss also ausgehalten werden und in einer Weise interpretiert und gestaltet werden, die die Differenz nicht auslöscht oder überspielt oder gar gewaltsam zu überwinden trachtet. Als Partikularität von universaler Bedeutsamkeit ist sie theologisch (u.a. sakramental, eschatologisch, diakonisch) und ethisch auszubuchstabieren.[12]
- Der Wahrheitsanspruch des Glaubens ist zwar universal, aber er ist nicht universalisierbar: Er kann nicht streng rational so „anargumentiert“ werden, dass jede vernünftige Person in einem rationalen Diskurs die Wahrheit des Glaubens einsehen müsste, also seine Ablehnung unvernünftig wäre. Sein Wahrheitsanspruch ist nicht im strengen Sinn verifizierbar bzw. falsifizierbar und damit universalisierbar. Das betrifft sowohl seine kognitive als auch seine praktische bzw. normative Dimension.
Hinsichtlich des Handlungsbezugs ergibt sich somit ein komplexes Konglomerat. Es ist zum einen durch die enge Korrespondenz der Handlungsorientierungen mit im Glauben fundierter Deutung der Welt, des Menschen und der Geschichte gekennzeichnet, zum anderen durch die Spannung zwischen partikularer Realität und universalem Anspruch bestimmt.
Aus der Sicht der Ethik und vor allem der Sozialethik, die den gesellschaftlichen und insbesondere den politischen und rechtlichen Bezug reflektiert, lassen sich Herausforderungen und Chancen benennen. Herausfordernd bleibt die Frage, wie und ob überhaupt in Gesellschaften, die nicht allein aus Christinnen und Christen bestehen, aus Handlungsorientierungen, die in einen geglaubten Heilsweg eingelassen sind, Normen oder gar zwangsbewehrtes Recht entwickelt werden können, die für alle gültig sein sollen. Das betrifft die säkulare Begründungsfähigkeit und Rechtfertigungspflicht im Glaubenskontext beheimateter Handlungsorientierungen und Lebensformen. Gültigkeit können nur jene normativen Vorgaben beanspruchen, die im argumentativen Diskurs mit allen Normbetroffenen überzeugungsfähig sind. Damit dringt aber die Unterscheidung von universalisierbaren normativen Konzeptionen – also solchen, die über unterschiedliche Deutungs- und Glaubenskontexte hinweg Gültigkeit beanspruchen können – und nicht universalisierbaren, die mit spezifischen Deutungskontexten verwoben sind, auch in die Glaubensethik ein. Einem Heilsweg ist diese Unterscheidung, die mit der Differenzierung von ethischen Fragen eines guten, gelingenden Lebens und moralischen Fragen der Gerechtigkeit verbunden ist, von innen her fremd; unter den Bedingungen moderner Pluralität ist sie zugleich unhintergehbar.
Die Chancen einer religiös eingebunden Handlungsorientierung sollen auch angedeutet werden.[13] Von der Handlungsseite her lässt sich als Kernargument – im Anschluss an Charles Taylor[14] – formulieren, dass moralisches Handeln auf eine moralische Ontologie, auf eine „Ontologie des Menschlichen“ verweist, in der das „Gut-Tun“ von einem „Gut-Sehen“ der Wirklichkeit ermöglicht wird. Der eröffnete Hoffnungs- und Sinnhorizont kann trotz der Erfahrungen der Vergeblichkeit dann auch Quelle der Motivation dafür sein, nicht nur das als richtig Erkannte auch zu tun, sondern sogar unter Bedingungen, die von Unrecht und Gewalt gekennzeichnet sind, den vertrauensvollen Vorausgriff auf eine Gerechtigkeitspraxis zu wagen, die sich in der gegebenen Realität dem Risiko der Ausbeutung und des Scheiterns aussetzt. Für ein Gelingen gibt es keinen zwingenden Grund, wohl aber christliche Hoffnung auf die rettende Gerechtigkeit Gottes.
3. Alternative Wahrheiten als Funktion von Handlungsinteressen
Das Copyright auf den Begriff Alternative Fakten hat wohl die Trump Beraterin Conway, die ihn im Streit um die Teilnehmerzahlen bei Trumps erster Amtseinführung 2017 geprägt hat.
Ich steige mit der Grundthese ein, die an der Klimawandeldebatte verdeutlicht wird: Anders als in der Wissenschaft, bei der das – instrumentelle – Handeln der Wahrheitserkenntnis folgt und darauf beruht, anders als in der Religion, in der Wahrheitsbekenntnis und Handlungsbezug, Orthodoxie und Orthopraxie eine Einheit bilden, ist bei den alternativen Fakten oder Wahrheiten das Handeln vorgängig und primär. Es geht um eine bestimmte Praxis, die angestrebt bzw. abgelehnt wird. Die aus dem Klimawandel und seinen Folgen sich ergebenden – politischen und privaten – Handlungsveränderungen werden nicht gewollt. Damit dieses Handlungsinteresse nicht völlig irrational erscheint, muss der wissenschaftliche Erkenntnisstand zum Klimawandel, seinen Ursachen und Folgen in Frage gestellt werden. Die Wirklichkeit muss dem Handlungsinteresse gefügig gemacht werden.
Schaut man sich die wissenschaftsbezogenen Aktivitäten der Akteure an, die den Klimawandel leugnen oder in Frage stellen, dass er menschengemacht ist, so stellt man fest, dass die wissenschaftlichen Ambitionen allerdings sehr gering sind: Es gibt kaum ernsthafte Bemühungen, in die Wissenschaft selbst hineinzuwirken, tragfähige andere Erklärungsansätze zu entwickeln und im wissenschaftlichen Diskurs zu verteidigen – was in der Sache auch schwierig sein dürfte. Nils Kumkar nennt die dabei verfolgte Strategie „unbestimmte Negation“: Es geht gar nicht um eine Tatsachenbehauptung, wie alternative Wahrheiten oder Fakten eigentlich suggerieren. Der Feststellung x wird nicht die Behauptung y entgegengesetzt; „vielmehr wird behauptet ‚Zu sagen, dass x der Fall ist, ist unzulässig, denn es ist (vielleicht) anders‘, wobei ‚anders‘ wirklich in diesem abstrakten Sinne als Verweis auf die leere, letztendlich unbestimmte Alterität verstanden werden sollte.“[15]
Es geht also nicht ernsthaft darum, ein anderes wissenschaftliches Modell zu entwickeln, in den wissenschaftlichen Diskurs einzuspielen und dort zu verteidigen. Die Argumentation zielt gar nicht auf die Wissenschaft, sondern auf die politische Kommunikation. Die Strategien und Argumentationsmuster sind weitgehend aus früheren Kampagnen von Interessenverbänden und Lobbygruppen bekannt – etwa der Tabakindustrie bezüglich des Krebsrisikos oder der chemischen Industrie bezüglich der Regulierung oder dem Verbot von bestimmten Stoffgruppen und Pestiziden: Es reicht den Grad der Gewissheit des gegenwärtigen Forschungsstandes abzuwerten, weitere Forschung einzufordern (und zugleich nach Möglichkeit zu verhindern), geforderte Maßnahmen in ihrer Wirksamkeit oder Leistbarkeit in Frage zu stellen, negative Folgen der Maßnahmen zu behaupten oder herauszustellen und schließlich der Wissenschaft eine politische Programmatik und Interessegeleitetheit zu unterstellen.
Für die politische Zielsetzung ist es also nicht notwendig, ein konsistentes wissenschaftliches Alternativparadigma anzubieten. Es reicht Konfusion zu erzeugen, Nebelkerzen zu zünden, Zweifel zu ermöglichen, um politische Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen ablehnen zu können, ohne völlig irrational und wirklichkeitsblind zu erscheinen. Der einleitende Absatz zum Klimaabschnitt im Bundestagswahlprogramm der AfD verdeutlich die kommunikative Zielrichtung in aller Kürze: „Klimawandel gab es zu allen Zeiten. Er ist ein komplexes Phänomen, verursacht durch eine Vielzahl von Faktoren. Die Frage nach dem Anteil des Menschen an diesem ist wissenschaftlich ungeklärt. Darauf lässt sich keine tausende Milliarden Euro kostende sogenannte Energiewende aufbauen.“[16]
Wissenschaftliche Kommunikation hat gegenüber dieser politischen Kommunikation einen Nachteil. Wissenschaft geht von der Fallibilität oder Überbietbarkeit ihres gegenwärtigen Erkenntnisstandes aus und ist als „organisierter Skeptizismus“[17] auch gegenüber ihrem je gegenwärtigen Wissensstand kritisch. Sie ist insofern vorsichtiger in ihren Aussagen.
Gravierender ist: Die Auseinandersetzung mit alternativen Fakten hebt deren Status. Mit einem Zitat von Oreskes und Conway in „Defeating the merchants of doubt“ gesprochen: „Es funktioniert auch nicht, ihre Argumente zu debattieren, weil das auf die Rahmung ‚Kontroverse‘ einzahlt: Die Skeptiker sagen, es gibt eine Debatte, du sagst, es gibt keine – voilà, sie haben ihren Standpunkt bewiesen.“[18]
Deutlich wird, dass die Infragestellung des Klimawandels keine wissenschaftliche Herausforderung darstellt, sondern die politische Kommunikation betrifft. Zeitreihen zum Wissenschaftsvertrauen zeigen, dass es hoch war und ist. Es gibt keine generelle gesellschaftliche Wissenschaftsskepsis.[19] Sie ist selbst bei „Querdenkern“ und Klimawandel-Bestreitern situationsbezogen. Und schließlich zeigt die Notwendigkeit, die Ablehnung der Klimapolitik doch irgendwie wissenschaftlich – und sei es in pseudowissenschaftlich – zu plausibilisieren, gerade die Anerkennung der Wissenschaft in ihrer Kompetenz und Zuständigkeit, zu ergründen, was der Fall und was wirksam ist.
Alternative Wahrheiten zielen vielmehr auf die Schnittstelle von Wissenschaft und Politik. „Wenn Expertise die Funktion hat, Entscheidungsgrundlagenwissen bereitzustellen, der Bezug auf dieses Entscheidungsgrundlagenwissen aber in der Politik und damit in einem System erfolgt, in dem nicht nach ‚wahr/unwahr‘[,] sondern nach ‚überlegen/unterlegen‘ codiert wird, dann steht jede Bezugnahme konstitutiv unter dem Verdacht, ‚in Wirklichkeit‘ durch Machtfragen motiviert zu sein. Weil, mit anderen Worten, die Ergebnisse der Wissenschaft hinzugezogen werden, um einen politischen Punkt zu machen, steht immer die Frage im Raum, ob sie nicht genau zu diesem Zweck ausgesucht und damit zumindest künstlich vereindeutigt wurden.“[20] Und es kommt hinzu: „In Situationen höchster politischer Dringlichkeit der wissenschaftlichen Politikberatung werden auch Wissenschaftler:innen immer wieder die ,Abkürzung‘ nehmen, die politischen Entscheidungen, die ihrer Meinung nach aus ihren Erkenntnissen folgen sollten, als Ergebnis ihrer Forschung darzustellen“[21].
Was folgt daraus? Die Konsequenz der Schnittstellenherausforderung kann nicht sein, dass Wissenschaft sich von der Politik fernhalten und politisch abstinent sein soll. Wohl aber muss Wissenschaft penibel und sensibel mit der Unterscheidung von Faktizität und Normativität umgehen sowie ihre normativen Positionierungen reflektieren und markieren. Angesicht der aktuellen Wertfreiheitsdebatte, die die Eliminierung sozialer Standortgebundenheit und Perspektivität für illusorisch hält, ist Vielfalt der Wissenschaft im Sinne von Diversität der Forschenden und von Methoden- und Disziplinenvielfalt wichtig, die den wissenschaftsinternen kritischen Blick auf Wertsetzungen im Rahmen des wissenschaftlichen Diskurses befördert. Für die politische Öffentlichkeit ist ein skeptisches und kritisches Wissenschaftsvertrauen die angemessene Haltung, die von wissenschaftlicher Bildung, qualifizierter Wissenschaftskommunikation und einem öffentlichen Wissenschaftsdiskurs profitieren kann.
4. Resümee
Im Beitrag konnten Unterschiede im Gegenstandsbereich, der beanspruchten Reichweite und der Fundierung der drei betrachteten Wahrheitsansprüche angedeutet werden. Der Fokus lag jedoch auf den Handlungsbezügen.
Wissenschaft bietet keine vollständige Handlungsorientierung. Zwar zielen ihre Erkenntnisse auch auf die Wirksamkeit von Handlungen und (technischen) Verfahren zur Erreichung von Zielen. Deren Bestimmung liegt allerdings nicht in ihrem Kompetenzbereich, sondern ist gesellschaftlichen und politischen Klärungsprozessen aufgegeben. In diese fließen neben wissenschaftlicher Expertise auch anderen Kriterien, nicht zuletzt auch ethische und moralische Urteile, ein.
Die im Glauben gegebene Deutung des menschlichen In-der-Welt-Seins unter der Perspektive des umfassenden Heilswillens Gottes ist mit Handlungsorientierungen verbunden, die individuell und kollektiv Wege eines heilen Lebens aufzeigen. Die gerade im Christentum vielfach als grundlegende Perspektiven oder – wenn man so will – als Prinzipien fassbaren Handlungsorientierungen bedürfen allerdings der Aktualisierung und Konkretisierung im Hinblick auf den sozialen und kulturellen Kontext und die konkrete Handlungskonstellation. Welche Regeln etwa dem Zentralgebot der Liebe in bestimmten Handlungskonstellationen entsprechen, ist in diskursiver Reflexion innerhalb der – selbst vielfältigen – Glaubensgemeinschaft jeweils zu bestimmen. Die Handlungsorientierungen stoßen allerdings dort auf eine systematische Grenze, wo sie sich auf Handlungszusammenhänge beziehen, in die Glaubende sowie Nicht- und Andersglaubende einbezogen sind. Die geglaubte Universalität von Handlungsorientierungen und Regeln muss sich dann der Bewährung im gesellschaftlichen Diskurs aussetzen. Wird sie mit Gründen zurückgewiesen, bedürfen die Regeln auch der kritischen Prüfung innerhalb der Glaubensgemeinschaft, ob sie als partikulare Regeln (beispielsweise bezüglich der Formen intimer Partnerschaft) fortbestehen können oder illegitim sind, also Unrecht darstellen.
Alternative Wahrheiten sind handlungsinduziert. Handlungsinteressen erfordern es, eine bestimmte Konstitution der Wirklichkeit zu behaupten bzw. zu bestreiten, damit die Handlungsinteressen begründet erscheinen. Auch wenn sie oft negativ auf wissenschaftliche Wahrheitsansprüche bezogen sind, zielen sie zielen nicht auf die Wissenschaft, sondern auf die heikle und schwierige Schnittstelle von Wissenschaft und Politik, mithin auf die politische Kommunikation.
Hinsichtlich des Verhältnisses von Wahrheit und Praxis lässt sich im Blick auf alle drei Formen als Folgerung festhalten, dass ein Kurzschluss von Wahrheit und gesellschaftlicher bzw. politischer Praxis zu vermeiden ist. Wissenschaft, die gesellschaftlich-politische Praxis bestimmen zu können meint, würde szientistisch und technizistisch und bemächtigte sich weiterer Rationalitätsaspekte, insbesondere der moralischen Dimension. Religion, die Glaubensüberzeugungen unmittelbar in Politik umsetzen will, würde theokratisch und missachtete die Freiheit der Andersdenkenden und -lebenden. Bei alternativen Wahrheiten schließlich werden Wahrheitsansprüche zu einer Funktion von Handlungsinteressen; sie zeigen eine Post-Truth-Konstellation, in der Interessen, Wille und Macht bestimmend sind. Darin zeigt sich, dass nicht nur der Kurzschluss zwischen Wahrheitsansprüchen und Praxis problematisch ist, sondern auch eine Praxis ohne Rekurs auf Wahrheit. Wenn wissenschaftlicher Erkenntnisstand ausgeblendet wird, fehlen der Praxis Potentiale kognitiver und instrumenteller Vernunft. Und die Reflexion, was ein gelingendes Leben ausmacht, ist von – als wahr angenommenen – Deutungen von Welt, Mensch und Geschichte abhängig.
________________________________
Dr. Bernhard Laux, Diplom-Soziologe, -Theologe und -Pädagoge, war bis zum Ruhestand (2021) Professor für Theologische Sozialethik an der Universität Regensburg und arbeitet derzeit vor allem an Fragen der Wissenschaftsethik. Eine Online-Übersicht der Veröffentlichungen, teilweise auch mit Volltexten, findet sich hier: Publikationsserver der Universität Regensburg
Photo: privat
[1] Vortrag beim Symposium „Wahrheit(en). Wahrheitskonzepte und Wahrheitsansprüche in theologischen und ethischen Diskursen“ am 3.7.2025 an der Universität Regensburg.
[2] Die Assoziation mit religiösen Wahrheitsansprüchen ist wohl der Grund dafür, dass man mit der Feststellung, dass es Wissenschaft um Wahrheit geht, tagungssprengende Debatten auslösen kann.
[3] Vgl. J. Habermas, Vom pragmatischen, ethischen und moralischen Gebrauch der praktischen Vernunft, in: Erläuterungen zur Diskursethik, Frankfurt a. M. 1991, 100–118.
[4] F. Bacon, The Works of Francis Bacon. Band I, London 1879, 221 f.
[5] Vgl. U. Schneidewind/M. Singer-Brodowski, Transformative Wissenschaft. Klimawandel im deutschen Wissenschafts- und Hochschulsystem, Marburg 22014; P. Strohschneider, Zur Politik der Transformativen Wissenschaft, in: A. Brodocz u.a. (Hg.), Die Verfassung des Politischen. Wiesbaden 2014, 175–192.
[6] Vgl. A. Bogner, Die Epistemisierung des Politischen. Wie die Macht des Wissens die Demokratie gefährdet, Ditzingen 2021.
[7] Vgl. bahnbrechend R. K. Merton, Die normative Struktur der Wissenschaft, in: Entwicklung und Wandel von Forschungsinteressen. Aufsätze zur Wissenschaftssoziologie, Frankfurt a. M. 1985 [1942], 86–99; Merton entwickelt die Bedingungen in Abgrenzung zur nationalsozialistischen Wissenschaft.
[8] Vgl. S. Goldberg, Social epistemology and epistemic injustice, 213-222 sowie H. Grasswick, Epistemic Injustice in Science, 313-323, beide in: I. J. Kidd/J. Medina/G. Pohlhaus (Hg.), The Routledge handbook of epistemic injustice, London/New York 2019.
[9] Elementarteilchen, dessen Existenz lange nicht experimentell bestätigt war.
[10] Vgl. J. Habermas, Auch eine Geschichte der Philosophie. Band 1: Die okzidentale Konstellation von Glauben und Wissen, Frankfurt a.M. 2019, 209.
[11] Vgl. Peter L. Berger, Zur Dialektik von Religion und Gesellschaft. Elemente einer soziologischen Theorie, Frankfurt a.M. 1973 (engl. Originaltitel: The Sacred Canopy).
[12] Vgl. M. Möhring-Hesse, Der unser aller Heil „ist“. Theologisch-ethischer Versuch, von Gott als dem Ziel gesollten Handelns zu reden, in: John, Ottmar/Möhring-Hesse, Matthias (Hrsg.): Heil -Gerechtigkeit – Wahrheit. Eine Trias der christlichen Gottesrede, Münster 2006, 15–42.
[13] Vgl. B. Laux, Exzentrische Sozialethik. Zur Präsenz und Wirksamkeit christlichen Glaubens in der modernen Gesellschaft, Berlin 2007, 172–202.
[14] Vgl. C. Taylor, Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität, Frankfurt a.M. 1996, 891–895.
[15] N.-C. Kumkar, Alternative Fakten. Zur Praxis der kommunikativen Erkenntnisverweigerung, Berlin 2022, 278 f.
[16] AfD Bundesverband, Wahlprogramm der AfD zur Bundestagswahl 2025. Beschlossen auf dem Bundesparteitag in Riesa am 11. und 12. Januar 2025, Berlin 2025, 77.
[17] Vgl. Merton, Normative Struktur, 99.
[18] N. Oreskes/E. M. Conway, Defeating the Merchants of Doubt, in: Nature 465, 2010, 686–687, 687 (Übersetzung BL).
[19] Vgl. Wissenschaft im Dialog, Wissenschaftsbarometer 2024, Berlin 2024; Österreichische Akademie der Wissenschaften, ÖAW Wissenschaftsbarometer 2024, Wien 2024.
[20] N. C. Kumkar, Science ist Meins? Wissenschaftsskepsis als Problem der politischen Öffentlichkeit, in: Österreichische Zeitschrift für Soziologie 50 (2025), 12. https://doi.org/10.1007/s11614-025-00602-9
[21] Ebd. 14.