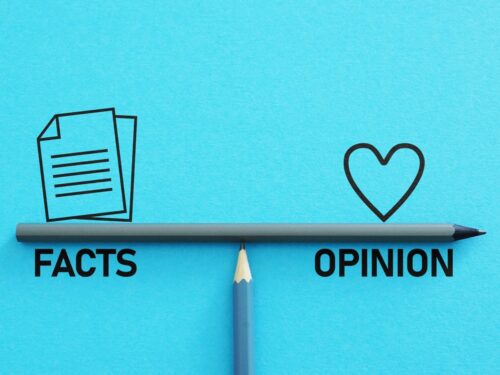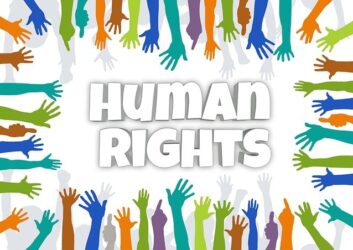Was kann religiöse Bildung angesichts einer sich verschärfenden Demokratiekrise zur Demokratiebildung beitragen? Dieser Frage stellt sich David Novakovits und plädiert dabei für eine positive Bewertung von Meinungen.
Wir sind aufgewacht – aus der „unheilvolle[n] Illusion, wonach Demokratie ewig währe“[1], so beschreibt es der italienische Schriftsteller Antonio Scurati. Dieses „Aufwachen“ mag manchen Zeitgenoss:innen als längst überfällig erscheinen – so viele Diskurse der letzten Jahre weisen auf die Gefährdungen jener Lebens- und Regierungsform hin, die vielen von uns als etwas nahezu Natürliches vorgekommen ist, als ‚zweite Haut‘ unseres zivilisierten Daseins. Dass wir in starker Dringlichkeit darüber nachdenken (müssen), wie Faschismus oder Populismus funktioniert, zeigt, dass uns dieses Erwachen ‚unter die Haut‘ gegangen ist. Vielen mag es gerade richtig bewusst werden, dass wir – als Gesellschaft der Singularitäten – auseinanderzubröseln scheinen „wie die Sandkörner einer ausgetrockneten Sandburg“[2], wie es Bea Davies in einem treffendem Bild zum Ausdruck bringt. Populistische Strategien tragen zu diesen Zerbröselungsprozessen bei, indem sie täglich Angst vor der pluralen Heterogenität schüren; wie Martha Nussbaum feststellt, führt diese Angst dazu, dass Menschen zunehmend nur an sich selbst denken.[3]
Demokratie als ‚zweite Haut‘ unseres zivilisierten Daseins
Das Aufwachen aus der Selbstverständlichkeit der Demokratie zwingt danach, die nicht sehr sympathische, weil anstrengende Grundfrage zu stellen: Wie kann uns demokratisches Zusammenleben, das auf viele Gespräche, komplizierte Verständigungsprozesse und sogar offen bleibende Konflikte angewiesen ist, gelingen – wo wir uns in vielen Milieus auf das friedliche Nebeneinanderherleben gewöhnt haben, das lange Zeit ohne diese anstrengenden Nebenwirkungen auszukommen schien?
Dieser Frage inhärent ist auch eine Bildungsdimension: Bildung – als question of being together verstanden[4] – ist nie ein nur individuelles Projekt, sondern dem Begriff eignet eine soziale Dimension; Bildung ist immer ein gemeinsames Projekt. Die soziale Institution Schule ist für junge Menschen jener Ort, an welchem ganz wesentlich ihre Selbst- und Weltbeziehungen (mit-)geformt werden. Schulen können daher, bei aller Ambivalenz dieser Institutionen, ein Ort sein, an dem essenzielle Fähigkeiten für ein demokratisches Zusammenleben erarbeitet werden. Zugleich mahnt der Religionspädagoge Dietrich Zilleßen, dass Werte und Überzeugungen – und damit auch ein demokratischer Habitus! – nicht einfach „vermittelt“ werden können. „Wir können pädagogisch weniger ausrichten, als wir meinen“[5], so die These Zilleßens, die ich nicht resignativ lese, sondern die irgendwie auch – bei aller Dringlichkeit – Gelassenheit vermittelt und vor pädagogischem Aktionismus warnt. Vielleicht ist es eher die Frage, ob Schüler:innen (noch? wieder?) Erfahrungen in unseren Schulklassen machen können, die sie motivieren und befähigen, so etwas wie eine Leidenschaft für die gemeinsame Welt zu entwickeln. Zugegeben: Das ist etwas pathetisch gesprochen. Demokratien benötigen in der Zeit nach ihrer Selbstverständlichkeit jedoch eine affektive Zustimmung; sie ist auf Menschen angewiesen, welche die Erfahrung gemacht haben, dass es einen Sinn hat, sich in ‚anstrengende Gespräche‘ mit anderen Menschen zu begeben. Ich möchte im Folgenden den Fokus auf lediglich eine Ressource legen, die für diesen Zielhorizont von entscheidender Bedeutung ist: die Meinungs- und Urteilsbildung.
Demokratiebildung im Dienst einer Leidenschaft für die gemeinsame Welt
Dieser Fokus mag zunächst etwas altmodisch erscheinen, und auf den ersten Blick muss man diesem Einwand recht geben: Meinungen scheinen in einem Post-Truth Age eher eine unsichere Sache zu sein. Angesicht des neuen Strukturwandels der Öffentlichkeit – der Erfindung ‚alternativer Fakten‘, der gesteuerten Manipulation der öffentlichen Meinung und der regelrechten Schaffung affektiver (angst- und hassbesetzer) Stimmungslagen – ist man eher geneigt, den pädagogischen Schwerpunkt im Kontext von Demokratiebildung auf die (notwendige!) Strategie des ‚Faktenchecks‘ zu legen: Es soll zur Wahrheit der Tatsachen zurückgekehrt werden; demokratiepolitisch relevant scheint daher die Aufklärung darüber zu sein, wie es wirklich um die Dinge steht.
Der Politikwissenschaftler Frank Nullmeier sieht in dieser Entwicklung jedoch auch eine Gefährdung für das demokratische Zusammenleben, wenn es auf die Opposition alternative Fakten oder Tatsachenwahrheit hinausläuft. Denn: Die Meinungen der Menschen werden in dieser Entwicklung indirekt abgewertet, da sie keine überprüften Fakten, sondern – eben – ‚bloße Meinung‘ sind. „Wo bislang von Meinung als zu schützendem Gut die Rede war, wird diese nun als ‚bloße Meinung‘ (…) herabgesetzt und unter Verdacht gestellt.“[6] Die Relevanz von Meinungsbildung, die für das Demokratische bislang von so fundamentaler Bedeutung war, steht nun plötzlich von zwei Seiten her unter Verdacht. Pointiert zugespitzt: Meinungsbildung scheint nutzlos geworden zu sein.
Meinungsbildungsprozesse unter Verdacht
Sichtbar wird hier die unglaublich gefährliche Dimension der populistisch-demagogischen Strategie, die mit dem Übertritt in ein postfaktisches Zeitalter verbunden ist: Sie zielt indirekt darauf ab, Meinungsbildungsprozesse und damit demokratische Prozesse überhaupt unnötig zu machen. Der nicht zu übersehende Subtext, den der decision-making-business-man ständig vor sich her trägt, lautet in etwa: ‚Warum muss alles so kompliziert sein? Die Zeit nutzloser (demokratischer) Diskussionen ist vorbei. Ab jetzt übernehme ich (für uns).‘ Perfide ist diese Strategie nicht deshalb, weil diese alternativen ‚Fakten‘ schwer zu widerlegen wären (das sind sie gerade nicht), sondern weil es egal zu sein scheint, was die anderen über den zu verhandelnden Gegenstand denken und meinen. Skandalös ist von daher nicht die falsche Wahrheit, sondern, dass die Notwendigkeit eines Streits um die Wahrheit überhaupt bestritten wird. Was hier erfolgt, ist nichts weniger als die grundsätzliche „Abkehr von jenem Raum des Gebens und Nehmens von Gründen, an dem jeder Wahrheitsanspruch seinen Prüfstein findet“[7] und damit die Entwertung der anderen als anzuerkennendes Gegenüber in einem Meinungsstreit.
Notwendigkeit eines Streits um die Wahrheit
Demokratie ist aber – etwas salopp – darauf angewiesen, dass nicht nur einer spricht, sondern dass mehrere miteinander sprechen, und zwar darüber, was im Streit zwischen post-truth oder truth ein wenig unterzugehen droht: Über ihre Meinungen. Demokratieorientierte Lernprozesse müssen daher den Leitspruch mit sich führen, dass Meinungen nicht einfach als Gegenüber zur Wahrheit zu verstehen sind; sie besitzen eine eigene Qualität, die „nicht durch wissenschaftliche Aussagen“ einfach übertrumpft werden kann: „Erfahrungen, Wahrnehmungen, Empfindungen und Erlebnisse besitzen gegenüber wissenschaftlichen Aussagen eine eigenständige Qualität und behalten ihre Berechtigung, auch wenn sie zu diesen in Kontrast stehen.“[8]
die eigenständige Qualität von Meinungen in Abgrenzung zu Fakten wertschätzen
Gerade in religiösen Lernprozessen gibt es wichtige Möglichkeiten, auf diese anti-demokratischen Entwicklungen zu reagieren. In Auseinandersetzen mit pluralen religiösen und säkularen Weltanschauungen, Menschenbildern, großen Fragen usw. können darüber hinaus jene Meinungsbildungsprozesse geübt werden, auf die Demokratien so angewiesen sind. Pädagogisch kann der Schwerpunkt darauf gelegt werden, dass solche Meinungsprozesse als Bildungsprozesse immer auf die Perspektiven anderer angewiesen sind. Gerade im Zuhören der Meinungen anderer, im Nachgehen der Genese bestimmter (eigener und fremder) Erfahrungen und in der Argumentation von Standpunkten kann ein Raum zwischen Menschen entstehen, der den Wert gemeinsamer Nachdenk- und Meinungsbildungsprozesse verdeutlicht – und wo möglicherweise sogar die in bzw. hinter den Meinungen stehenden Überzeugungen und Glaubensformen deutlich werden und zur Sprache kommen können. Der Beitrag religiöser Bildung zu demokratisch orientierten Lebensformen könnte gerade darin liegen: Das oft anstrengende Gespräch zwischen Menschen wieder zu rehabilitieren und jungen Menschen die (dann wieder beglückende) Erfahrung zu ermöglichen, sich selbst und andere besser zu verstehen. Dieses fortwährende Gespräch, das nicht auf das Finden der einen richtigen Wahrheit abzielt, sondern darauf, die eigenen Meinungen an den Urteilen anderer zu prüfen, leistet – so scheint mir – einen bedeutenden Beitrag zur Unterstützung der Demokratie.
—
[1] Antonio Scurati, Faschismus und Populismus, 1st ed (Stuttgart: Klett-Cotta, 2024).
[2] Bea Davies, Super-Gau, Originalausgabe, 1. Aufl, Carlsen Comic (Hamburg: Carlsen Verlag, 2025).
[3] vgl. Martha Nussbaum, Königreich der Angst: Gedanken zur aktuellen politischen Krise, übers. von Manfred Weltecke, 1. Auflage, genehmigte Taschenbuchausgabe (München: btb, 2020).
[4] vgl. Jan Masschelein und Norbert Ricken, „Do We (Still) Need the Concept of Bildung?“, Educational Philosophy and Theory 35, Nr. 2 (Januar 2003): 139–54, https://doi.org/10.1111/1469-5812.00015.
[5] Dietrich Zilleßen, Gegenreligion: über religiöse Bildung und experimentelle Didaktik, 2. Auflage, Profane Religionspädagogik, Band 1 (Berlin Münster: LIT, 2019), 179.
[6] Frank Nullmeier, „‚Bloße Meinung‘. Über Demokratie, Öffentlichkeit und die Abwertung der Meinung als Gegenteil von Wahrheit“, Soziopolis vom 28.05.2019, 2019, 1.
[7] Juliane Rebentisch, Der Streit um Pluralität: Auseinandersetzungen mit Hannah Arendt (Berlin: Suhrkamp, 2022), 19.
[8] Frank Nullmeier, „‚Bloße Meinung‘. Über Demokratie, Öffentlichkeit und die Abwertung der Meinung als Gegenteil von Wahrheit“, 12.
Beitragsbild: Jack the sparrow via Shutterstock

David Novakovits ist Universitätsassistent („post-doc“) am Institut für Praktische Theologie der Universität Wien. In seiner Arbeit beschäftigt er sich v.a. mit Phänomenen von Negativität und ihr transformatives Potential im Kontext religiöser Bildung: Unvermögen, Scheitern, Angst, Konflikt, Unverfügbarkeit.