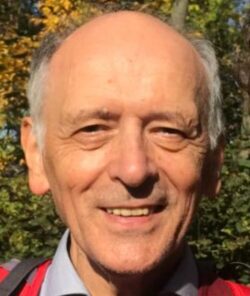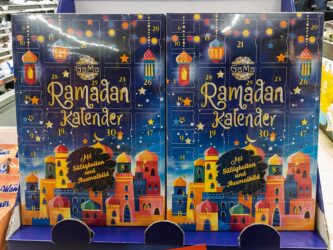In diesen Tagen feiern Jüdinnen und Juden den Beginn eines neuen Jahres. Martin Jäggle führt mit Hilfe einiger Texte von Bella Chagall in die spirituelle Dimension von Rosch-Haschana, dem Fest des Neujahrs nach dem heute gültigen jüdischen Kalender, und die daran anschließenden Tage ein.
„Die Bußtage sind gekommen, unser ganzes Haus ist verstört. Jeder Feiertag hat seine eigene Stimmung. Eine klare reine Luft wie nach dem Regen – das ist die Luft von Rosch-Haschana.“ So erinnert Bella Chagall, die kongeniale Frau des Malers Marc Chagall, ihre Kindheit im damals russischen Witebsk. „Mir ist, als habe der Himmel selbst sich gesenkt und eile mit mir in die Synagoge.“ An diesem Tag wird am Ende des Morgengebets in der Synagoge ein Widderhorn, Schofar genannt, in klar definierten Tonfolgen geblasen; ebenso während und am Ende des darauf folgenden Mussaf-(d.h. Zusatz-)Gebets.
Bella Chagall erzählt: „Plötzlich erklingt ein reiner, voller Ton. (…) Der Ton schwillt an, berührt die Wände, nähert sich mir, dem Geländer vor mir, steigt zur Decke empor, vertreibt die dicke Luft, breitet sich aus, erfüllt den ganzen Raum. Er dringt in meine Ohren, in meinem Mund, so tief, dass er mir im Magen weh tut. Wann wird der Schofar verstummen? Was will das neue Jahr von uns?“ Der Klang des Schofar will erschüttern und erinnern. Bella Chagall: „Ich erinnere mich an all meine Sünden. Weiß Gott, was mit mir geschehen wird, im Laufe des Jahres hat sich so viel angesammelt.“
Reine Luft wie nach dem Regen und ein voller Ton, so tief, dass er mir im Magen weh tut.
Rosch-Haschana (Kopf des Jahres), wie dieses jüdische Neujahrsfest heute genannt und zwei Tage gefeiert wird, ist gemäß der Tora ein Tag des Hornblasens: „Am ersten Tag des siebten Monats sollt ihr eine heilige Versammlung abhalten; an diesem Tag dürft ihr keine schöpferische und konstruktive Arbeit verrichten. Es wird für euch ein Tag des Schofar-Blasens sein.“ (Num 29,1). Der Klang des Schofar als Symbol erinnert an die „Bindung Isaaks“, als Abraham einen Widder, der „sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hat“ (Gen 22) anstelle Isaaks opfert. Er erinnert auch an die Erschaffung der Welt, die nach jüdischer Tradition am 1. Tag des 7. Monats (Tischri) abgeschlossen wurde, sowie an den Bund Gottes mit seinem Volk. Vor dem König der Schöpfung müssen sich die Menschen verantworten. So ist der Festtag ein Tag der Introspektion. Jüdinnen und Juden wünschen einander: „Mögest du für ein gutes Jahr (implizit: im Buch des Lebens) eingeschrieben und besiegelt werden.“
Sünden abschütteln
Das „Sündenwegwerfen (Taschlich)“ gehört zu den alten Bräuchen von Rosch-Haschana. Bella Chagall erzählt: „Ich kann kaum den Nachmittag erwarten, um mit Mama zum Reinigungsgebet zu gehen, meine Sünden abzuschütteln und in den großen Fluss zu werfen. Mutter spricht mir die Gebete vor, und mit den Gebeten zusammen fallen die Sünden aus meinem Mund ins Wasser. Mir ist, als schwelle der Fluss von all unseren Sünden an, als seien seine Wasser plötzlich schwarz geworden.“ In unmittelbarer Nähe des Wiener Stadttempels aufgewachsen ist es für mich berührend und stets Anlass zur Freude, seit dieser Brauch – symbolisiert mit Steinen – wieder öffentlich am Fuß der Salztorbrücke über dem Donaukanal praktiziert wird.
Hoffnung, die man schmeckt
Ein weiterer Brauch hat seinen Platz an diesem Tag: Apfelstücke werden in Honig getaucht verbunden mit dem Wunsch: „Schana Towa uMetuka!“ (Möge es ein gutes und süßes Jahr werden!). Nach den Herausforderungen des vergangenen Jahres wird so der Blick auf das neue Jahr gelenkt voll Hoffnung, die man schmeckt.
Zehn „ehrfurchtsvolle Tage (Jamim Noarim)“ von Rosch-HaSchana bis zum großen Versöhnungstag (Jom Kippur) sind eine Zeit für persönliche Umkehr. Sie dienen der Besinnung, dem Nachdenken, dem Gebet, der Wohltätigkeit sowie der Bereinigung von verursachtem Unrecht und Bitten um Vergebung. Am Versöhnungstag, dem höchsten jüdischen Feiertag, wird 25 Stunden gefastet und in der Synagoge gebetet. Am Ende dieses Tages soll die Gemeinde nach dem Gottesdienst freudig aufbrechen – begleitet durch einen einzelnen Ton des Schofars.
Ein Zeichen der Verbundenheit wäre, wenn Christinnen und Christen in ihren Gottesdiensten an einem der letzten Sonntage im September gemeinsam beten: „Am Beginn des jüdischen neuen Jahres, am Fest Rosch ha-Schana, bitten wir Dich Allmächtiger/Gütiger/Herr, segne die Juden und Jüdinnen, wo immer sie sich aufhalten. Möge das Jahr 5786 gut und süß sein. Denke an uns alle, damit wir leben, und schreibe uns (für ein gutes Leben) ins Buch des Lebens ein.“
—
Quelle: Bella Chagall, Brennende Lichter. Erste Begegnung. Mit Zeichnungen von Marc Chagall, Reinbeck b. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 2001 (rororo 22963).
Ich danke Dr. Willy Weisz, Vizepräsident des Koordinierungsausschusses für christlich-jüdische Zusammenarbeit, für die hilfreiche Durchsicht des Manuskriptes und die Bibelübersetzung.
Beitragsbild: cstpdx via Pixabay