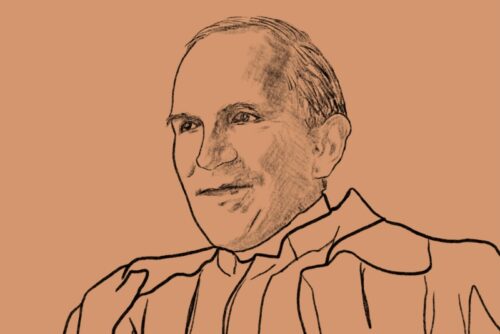Vor fünf Jahrzehnten starb der Schweizer Theologe Maurice Zundel. Seinem mit der eigenen Biografie und mit mystischen Komponenten verwobenen theologischen Arbeiten geht Claude Bachmann nach.
Am 10. August 2025 jährt sich der Todestag des Westschweizer Theologen und Mystikers Maurice Zundel (1897–1975) zum 50. Mal. Anlass genug, einige Schlaglichter auf einen geistesgeschichtlich bedeutenden Schweizer Denker des 20. Jahrhunderts zu werfen, der im französischen Sprachraum sowohl pastoral als auch wissenschaftlich rezipiert wird, während er im deutschen Sprachraum weitgehend unbekannt geblieben ist.

Zundel wuchs in einer katholischen Familie im protestantisch geprägten Neuenburg in der Schweiz auf.[1] Nach dem Theologiestudium in Fribourg von 1915 bis 1919 und der Priesterweihe war er bis 1925 sechs Jahre lang Vikar in Genf. Aufgrund seiner «Eigentümlichkeit» (singularité) – Zundel benutzte beispielsweise im Religionsunterricht statt des Katechismus weltliche Literatur oder diskutierte mit den Jugendlichen offen über gesellschaftliche Fragen – vom damaligen Bischof der Diözese Lausanne, Genf und Fribourg als «Sonderling und Freischärler» (original et franc-tireur) diskreditiert, verwehrte ihm dieser von 1925 bis 1946 eine seelsorgerliche Anstellung in der Schweiz. Eine Ausnahme bildete die Zeit von 1930 bis 1933, in der er als Seelsorger und Religions- sowie Philosophielehrer im Mädchenpensionat Bon Rivage in La-Tour-de-Peilz bei Vevey (VD) tätig war. Erst nach seinem Doktoratsstudium in Philosophie an der Hochschule Angelicum des Dominikanerordens in Rom (1925–1927) und Stationen als Spiritual und Schulseelsorger in Paris (1927–1929; 1933–1937; 1938–1939), London (1929–1930), Jerusalem (1937–1938) und Kairo (1939–1946) sowie dem Tod des Bischofs erhielt er wieder eine Anstellung in seinem Heimatbistum – allerdings nicht als Pfarrer, was zeitlebens sein grösster Wunsch gewesen war, sondern als «Hilfspriester» in Lausanne-Ouchy, wo er 1975 starb.
Ablehnung, Exil
und Bewunderung
Schon dieser kurze Blick auf seine Biografie macht deutlich, dass Zundels Werdegang weder dem eines klassischen Pfarrers noch dem eines klassischen theologischen Akademikers des 20. Jahrhunderts entsprach. Trotz der Umstände der bischöflichen Ablehnung und des damit verbundenen 21-jährigen Exils – oder gerade deswegen? – hinterliess sein Wirken als Seelsorger, Autor von insgesamt 21 Büchern sowie zahlreichen Artikeln, Redner an Konferenzen und Exerzitienleiter im In- und Ausland tiefe spirituelle sowie intellektuelle Spuren. Davon zeugen einerseits eine reichhaltige Korrespondenz mit vielen ehemaligen Schüler:innen sowie Weggefährt:innen und andererseits die Bewunderung für sein Denken, die ihm von vielen Menschen zuteilwurde. So würdigte ihn beispielsweise Papst Paul VI. (Montini und Zundel lernten sich in den 1920er Jahren in Paris kennen ) als «Mystiker, Dichter, Philosoph, Theologe, Liturgiker» und erkannte in seinen Schriften «Erleuchtungen, ich möchte sagen, Wetterleuchten (fulgurations)»[2]. Montini war es auch, der bereits in den 1930er Jahren die Übersetzung eines der bekanntesten Werke Zundels (Le Poème de la Sainte Liturgie) ins Italienische veranlasste und ihn 1972 als Papst Paul VI. einlud, die Fastenexerzitien des Vatikans zu predigen.[3] Damit erfuhr Zundel nach langer und leidvoller bischöflicher Ablehnung doch noch kirchliche Anerkennung.
Die radikale Transformation des Menschen
Zundels Denken ist von einer doppelten Fragestellung geprägt: «Von welchem Gott sprechen wir und von welchem Menschen?»[4] In der Auseinandersetzung mit der Philosophie sowie den Naturwissenschaften, der Literatur und der Theologie suchte er zeitlebens nach Antworten auf die «grundlegende Ambiguität von Gott und Mensch»[5]. Der neuralgische Punkt lag für Zundel in der Tatsache, dass der Mensch nicht mehr an den Menschen glaube und sich selbst negiere. Anlass für seine gesellschaftskritischen Analyse war vor allem der Kontext seiner Zeit, die gekennzeichnet war von zwei Weltkriegen, dem atomaren Wettrüsten im Kontext des Kalten Krieges, dem Fortschritt der Naturwissenschaften, dem aufkommenden Kapitalismus und dem Elend der Arbeiter:innenklasse. Vor diesem Hintergrund klagte Zundel die angeborenen egoistischen, narzisstischen und besitzergreifenden Haltungen des Menschen an, die es zu überwinden gelte: in einem fortwährenden Prozess, um sein eigentliches Menschsein zu erlangen. Erst dann sei der Mensch zu wirklich menschlichen Handlungen fähig. Diese «radikale Transformation» des Menschen war für Zundel entscheidend, denn der Ausgangspunkt seiner Reflexionen war immer der konkrete Mensch mit seinen Erfahrungen.
Theologisch höchst interessant, insbesondere für einen Theologen seiner Zeit, ist Zundels Gottesverständnis. Dieses fusst zunächst in den Erfahrungen seiner Kindheit, in denen er Gottes Gegenwart in der gelebten Hingabe und im Evangelium erfuhr. Vor allem die Generosität und Fürsorge seiner (protestantischen) Grossmutter mütterlicherseits gegenüber obdachlosen und armutsbetroffenen Menschen prägten den jungen Zundel nachhaltig. Aber auch ein Schulkamerad, der ihm aus der Bergpredigt vorlas, prägte ihn:
«Er war dieses bewundernswerte Sprachrohr, durch das mir bewusst wurde,
dass das Evangelium nicht eine Ansammlung von Reden war,
sondern eine Gegenwart, die ich allein in der Art und Weise wahrnahm,
wie er die Bergpredigt las.»[6]
Darum war für Zundel das Theologiestudium an der stark (neo-)thomistisch geprägten Fakultät in Fribourg eine schwere Prüfung:
«Das Wort Gottes wurde zum Prüfungsgegenstand. […]
Man lernte die Häresien auswendig,
bewies die Wahrheit mit Argumenten und wiederholte ‹ad quid ergo, ad quid ergo› von morgens bis abends. […]
In der Theologie ging es nicht darum, sich für die Trinität oder die Gnade zu begeistern,
man musste Prüfungen über die Trinität und die Gnade ablegen,
und das ist etwas anderes als Kontemplation.»[7]
Die Systematisierung und Objektivierung des Göttlichen durch die Theologie war für Zundel unverständlich, denn dadurch wurde aus Gottes Gegenwart ein dem Menschen radikal äusserliches Objekt, ein «in Brokat und Diamanten gehüllter Pharao»[8]. Vor diesem Hintergrund teilte er die Kritik des Atheismus an einem «transzendenten Despotismus»[9], der ihnen zufolge ein Nebeneinander von Mensch und Gott unmöglich macht. Selbstkritisch merkt Zundel dabei an, dass nicht zuletzt Christ:innen selbst mit ihrem Glauben zu diesem menschenfernen Gott beigetragen haben.
Gott als Wirklichkeit
Der entscheidende Punkt für Zundel ist, dass es einen solchen Gott aus christlicher Sicht nie gegeben hat. Gott habe sich gerade in Jesus offenbart, der «kein System vorschlägt» und «keine Lehre erfindet»[10], sondern lediglich von dem Zeugnis ablegt, wie und was er lebt: Er begegnet den Menschen in ihrer Würde und Freiheit, wäscht ihnen die Füsse und lädt im Gespräch mit der Samaritanerin alle Menschen dazu ein, dem Göttlichen in sich selbst als lebendige Quelle auf die Spur zu kommen und zu begegnen. Diese radikale Hingabe und Generosität Jesu, die in der Trinität grundgelegte Relationalität menschlichen Lebens und das damit einhergehende jedem Menschen «innere Evangelium» gilt es zu entdecken. Deshalb zitierte Zundel gerne den französischen katholischen Islamwissenschaftler Louis Massignon: «Gott ist keine Erfindung, er ist eine Entdeckung.»[11]
So vermied es Zundel, von einem klassisch theistischen Gottesbild zu sprechen. Vielmehr dachte er Gott als Présence; nicht als ein in dogmatische Lehrsätze verpacktes System, sondern als Wirklichkeit, als Gegenwart oder als Gegenwärtigkeit, die immer eine Begegnung impliziert: mit sich selbst und mit der gegenwärtigen Wirklichkeit Gottes. Beide Arten der Begegnung sind für ihn ein und dasselbe, denn Gott ist «eine uns innerliche Gegenwart, die immer schon da ist»[12]. Das französische Wort Présence geht allerdings über die Bedeutung von Gegenwart oder Wirklichkeit hinaus und meint ebenfalls Ausstrahlung oder Aura. Zundel verwendet diesen Begriff bewusst, denn es geht ihm nicht zuletzt auch darum, dass der Mensch von der Ausstrahlung dieser Wirklichkeit oder Gegenwart ergriffen wird. In dieser Ergriffenheit kommt der Mensch in seinem Innersten jenem Geheimnis auf die Spur, worauf es letztlich ankommt: Liebe. Und weil es für Zundel nicht darauf ankommt, nur von der Liebe zu wissen, sondern gerade Liebe zu sein und zu leben, konnte er sagen: «Ich glaube nicht an Gott, ich lebe ihn.»
Aufgrund seiner lebensnahen Spiritualität und seiner poetischen Mystik wurde Zundel von Menschen mit unterschiedlichen religiösen Sozialisierungen geschätzt. Seine Texte werden bis heute gelesen, z.B. in zahlreichen pfarreilichen Lesekreisen in der Westschweiz, in Frankreich, in Belgien oder in Kanada. Die zentralen Texte Zundels sind in der Gesamtausgabe gesammelt[13], deren neunter und letzter Band im September 2025 erscheint. Seine Gedanken sind auch 50 Jahre nach seinem Tod erstaunlich aktuell und lohnen sich umso mehr, gelesen zu werden.
___
Claude Bachmann ist wissenschaftlicher Assistent und Doktorand am Lehrstuhl für Dogmatik und Fundamentaltheologie der Theologischen Hochschule Chur. Im Rahmen seines Dissertationsprojekts forscht er zu Maurice Zundel, insbesondere zu dessen Anthropologie. Er ist gemeinsam mit Dr. phil. Alois Odermatt Herausgeber der Anthologie «Ich ist ein anderer», die erstmals ausgewählte Texte Zundels in deutscher Sprache enthält. Die Anthologie erscheint im Dezember 2025 im Theologischen Verlag Zürich. 
[1] Alle biografischen Angaben sind der massgeblichen Zundel-Biografie entnommen: Boissière, Bernard de/Chauvelot, France-Marie: Maurice Zundel. Nouvelle édition revue et augmentée. Paris: Presses de la Renaissance, 2009.
[2] Guitton, Jean. Dialog mit Paul VI. Wien: Fritz Molden, 1967, 119.
[3] Die insgesamt 22 Vorträge vor der Kurie wurden 1976 veröffentlicht: Zundel, Maurice: Quel homme et quel Dieu ? Retraite au Vatican. Préface du R.P. Carré de l’Académie Française. Saint-Maurice: Saint-Augustin, 42008.
[4] Zundel, Maurice: Quel homme? Quel Dieu? Conférence de Maurice Zundel donnée au Cénacle de Paris le 22 janvier 1966 (22.01.1966): https://mauricezundel.com/27-01-au-05-02-2013-conference-paris-1966-quel-homme-et-quel-dieu/ (abgerufen am: 07.06.2025).
[5] Zundel, Maurice: Je est un autre. Montréal: Anne Sigier, 1997, 24.
[6] Zundel, Maurice: La clé du Royaume. In: Zundel, Maurice: À la découverte de Dieu. Écrits catéchétiques et philosophiques, rassemblés, présentés et édités par Marc Donzé. Paris: Parole et Silence, 2020 (Œuvres complètes Tome III), 505. Übersetzung: Claude Bachmann.
[7] Zundel, Maurice: Un autre regard sur l’homme. Paroles choisies par Paul Debains. Paris: Le Sarment-Fayard, 1996, 21–22. Übersetzung: Claude Bachmann.
[8] Zundel, Maurice: Émerveillement et pauvreté. Retraite à des oblates bénédictines. Saint-Maurice: Saint-Augustin, 32009, 26.
[9] Zundel, Maurice: Dialogue avec la Vérité. In: Zundel, Maurice: Vérité et Personne. Écrits et documents sur la vérité et la connaissance, rassemblés, présentés et édités par Marc Donzé. Paris: Parole et Silence, 2022 (Œuvres complètes, tome V), 386–387.
[10] Zundel, Dialogue 410.
[11] Z.B. Zundel, Maurice: L’Évangile intérieur. In: Zundel, Maurice: Harmonique. Écrits de décembre 1935 à 1939, rassemblés, présentés et édités par Marc Donzé. Paris: Parole et Silence, 2019 (Œuvres complètes, tome II), 127.
[12] Zundel, Émerveillement 50.
[13] Herausgeber der Gesamtausgabe ist Marc Donzé. Er ist ein weltweit anerkannter Zundel-Experte, Präsident der Fondation Maurice Zundelund ehemaliger Professor für Pastoraltheologie an der Universität Freiburg.
Bilderrechte Titelbild: Fondation Maurice Zundel // Illustration: Iris Bachmann»