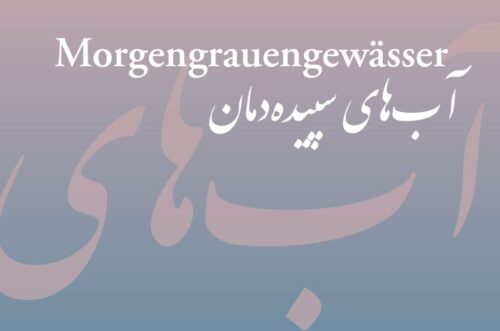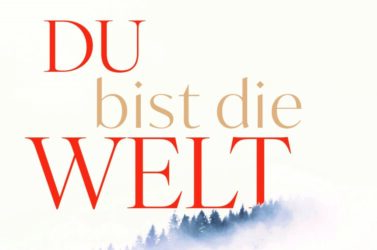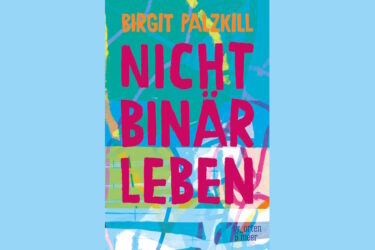Der afghanische Exilautor Izizullah Ima und der Deutschschweizer Schriftsteller Andreas Neeser haben im Rahmen von «Weiter Schreiben» ein «Gespräch in literarischen Miniaturen» verfasst: höchst aufschlussreich im Blick auf Migration, Religion, Literatur und Interkulturalität. Christoph Gellner stellt das Buch vor.
«Wenn der Wind dein Haar verweht / trotz Gottes Verbot – was will man tun? / In Kabuls Straßen vermisst man das Liebesgeflüster, / und es singt auch niemand mehr des Nachts». In seinem Text «Ich spreche vom Hier und Jetzt» verdichtet der 62-jährige afghanische Exilautor Izizullah Ima die Situation in seinem Heimatland nach Abzug der westlichen Truppen 2021. In Kabul hat er Pädagogik studiert und war Chefredakteur der Tageszeitung Dariz, als 1996 die Taliban ihre Schreckensherrschaft begannen – in keinem Land wurde die Scharia strenger ausgelegt –, verliess Izizullah Ima Afghanistan, seit 1999 lebt er in der Schweiz. Auf Persisch wurden von ihm mehrere Romane, Erzählungen und Gedichte publiziert. 2021 übernahmen die Taliban erneut die Macht:
«Die Kommandos turbanumhüllter Köpfe, / der Hall von Peitschenknall und Schuss, / von Wirrwarr, gemurmelten Versen, und Stuss, / tragen die Klagelaute / in Schreckensträume unter fernen Dächern», schreibt Izizullah Ima. Dank religiösem Fanatismus und radikalislamistischem Horror ist «das Land der Verlierer von ‘Allahu-Akbar’-Gebrüll erfüllt». Das Taliban-Regime 1994–2001 wurde durch die Unterdrückung von Frauen bekannt, die gezwungen wurden, Burka zu tragen. Wieder trifft es insbesondere «Frauen, die aus ihren Stoffkäfigen starren, / herumirrende Schatten, fürchten die Regierung eines Gottes, der dem Sterben zusieht, ohne Partei zu ergreifen, / Ein Gott der das fortwährende Bitten und Flehen von Kindern in blutgetränkten Gräben / ohne Antwort lässt», bilanziert Imas Gedicht: «Kabul sagt der Freiheit Lebewohl – / ‘Adieu, Kabul!’» Bedrückt vom «Kummer der Freiheit» betrauert der Sprecher «all die ungemalten Bilder unserer Schreie, / bittere Lieder des schwersten Exils.»
Zwei Dichter im Duett
Durch den Schweizer Ableger des Projekts Weiter Schreiben.jetzt, das aus Kriegs- und Krisengebieten geflüchtete Autor:innen mit hiesigen Literaturszenen vernetzt und ihnen durch Publikationsmöglichkeiten das Weiterschreiben erleichtern soll, bildete Izizullah Ima mit dem Aargauer Schriftsteller Andreas Neeser (*1964) ein literarisches Tandem. Ähnlich wie «Untold Narratives» literarische Wortwechsel zwischen afghanischen und deutschen Autor:innen publik macht, ist jetzt im Zürcher Rotpunktverlag das poetische Dialogbuch Morgengrauengewässer erschienen, in dem Ima und Neeser «ein dichterisches Zwiegespräch» führen: «Zwei Sprachen treffen im interkulturellen Dialog aufeinander, Persisch und Deutsch, aber auch zwei Lebenswelten», was Manfred Papst in seinem erhellenden Vorwort mit dem vergleicht, was im modernen Jazz «Interplay» heißt: «Das ist mehr als Zusammenspiel und etwas anderes als Improvisation. ‘Interplay’ meint einen Dialog in gespannter Aufmerksamkeit, aus dem Moment heraus, auf jede Gefahr hin.» Izizullah Imas Texte sind dabei im Original und zugleich in der Übersetzung aus dem afghanischen Farsi von Sarah Rauchfuß abgedruckt.
«Mal sind sie rote Linien, die Erblasten toter Tyrannen, / mal Mauern menschlicher Freude und Trauer», streicht Imas erste literarische Miniatur «Grenzen» heraus. «Während des Übergangs sah ich die Menschen gefangen / in Geografie und Gewohnheit. / Gefangene, die über irdisches Wünschen hinaus / selbst Gott und den Himmel unterteilen / für die Träume nach dem Tod», lautet die religionskritische Einsicht des afghanischen Exilautors. Gerade indem er Grenzen überschreiten musste, erkannte er, «wie bedeutungslos sie sind, die diktierten Trennlinien». In einer weiteren Miniatur verdeutlicht Ima: «Jedes Land ist ein Gefängnis der Gewohnheiten, / wenn du über das Passieren einer Grenze nicht nachdenkst, / das Vordringen zu unmöglichen Orten. / Liebe ist das Erklimmen jener Anhöhe, / von der aus sich anders sehen und der Andere sehen lässt.» Auf diese «Eroberung» antwortet Andreas Neeser, der mit Gedichten, Romanen, Erzählungen und Theaterstücken hervorgetreten ist, in seinem Korrespondenzgedicht «Flaches Gelände»: «Das Schmerzliche an der Gewöhnung ist die Schmerzlosigkeit.»
So sehr die beiden Autoren ihre eigenen Akzente setzen, treten sie mit ihren Miniaturen nicht nur sprachkünstlerisch-thematisch, sondern auch menschlich-emotional in einen Dialog: Auf Imas Aufschrei «Oh, des Gerüchts Schwerter, wie sind sie gewetzt! Fünf verwundete ein Mann erst gestern in Paris für Gottes Wohlgefallen, für das größte Gerücht des Menschengeschlechts» repliziert Neeser: «jedes Gerücht ist ein Vorwand für Faulheit». Des afghanischen Kollegen Furcht «vor den Echos, die man für okkulte, heilige Gesänge hält. Wie die himmlischen Verse, die spalten, erlassen sie eine Fatwa, die Liebe zu vergessen für eine Rückkehr in den Krieg, für eine Rückkehr in den Urwald toter Götter, die an Rachsucht erstickten», verlängert Neeser zur «Geburt» des Ich: «So werde ich täglich im Dunklen, erwachse / durch all mein Leben zur Kenntlichkeit / bis ich mir selber ans Licht komme. / Dann aber sage ich einfach nur / ich.»
Evoziert Ima inmitten «der blutigen Gotteskämpfe» erleuchteter Gläubiger sein «Vernunftstück», buchstabiert sein Aargauer Kollege dies dahingehend: «Solange noch Licht brennt / ist keine Erleuchtung zu fürchten.» Und auf die Klage seines afghanischen Gegenübers: «Meine frischen Wunden / tragen die Spuren von Schwertern, / ausgestellt in heiligen Museen. / Hier und jetzt / reichen die Worte uralter Bücher, / die zu Kugeln werden und töten, / niemals heran an die wahren Visionen / in den Tiefen der Jahrhunderte», respondiert Neeser mit dem «Appell»: «Die Bilder zuinnerst – wir müssen sie schreiben / bevor sich das Blatt wieder wendet.»
Dialogisch-polyphon statt monologisch-homogen
Trotz unterschiedlicher Erfahrungen und Prägungen der beiden Dichter entstanden literarische Miniaturen, die bewusst zwischen Lyrik und Prosa changieren. Weil das im persischsprachigen Raum nicht sehr ausgeprägt ist, bedeutete dies für Ima Neuland. Seine von Krieg, Vertreibung und Exil bestimmte «krasse Biografie» konfrontierte den Schweizer, gestand Neeser im SRF-Kulturplatztalk, mit einer ganz anderen Welt. «Die Tode kommen stiller hier, und menschlicher, mag sein», sinniert er in «Das Klima des Todes». «Abend- und Morgenrot ist nichts als Wetter, zweifellos, und nichts als das. Allein, da hängen überm Hügelzug Gebete im Gewölk; sie suchen ihren Gott – und wissen nicht, wohin. Ich glaube, das ist Klima. Hoffnung oder Angst.»
«Man kann ihm Glauben schenken, / zuweilen, / dem Zauber des Erwachens, / dem Gang mit Herzensbeinen / und dem Flug mit Seelenflügeln / aus dem Erdreich, / aus dem Blau der Morgengrauengewässer/ in die Farbenvielfalt ferner Horizonte»: Der Buchtitel ist ein Beispiel für die orientalische Metaphorik von Imas Herkunftskultur, auf die Neeser in «Maulwurf» dezidiert nüchtern antwortet: «Ich schaufle und grabe und baue, ich lege die Gänge zur eigenen Mitte hin […] Alles hier unten ist Aufgabe. Mehr bin ich nicht.» Sarah Rauchfuss betont: Die in Azizulla Imas Sprachwelt fortlebenden alten Mythen erhalten «eine humanistische Wendung ins Heute, sind die Propheten, Engel, Bestien und Hünen dieser Welt doch die Menschen selbst».
Im Verlauf ihres literarischen Austauschs vermochte sich Ima über seine traumatischen Verwundungen und Verletzungen hinaus zu öffnen, durch beiden wichtige Themen wie Sprache, Reisen und Träume nahm das Buch inhaltlich eine nicht planbare Entwicklung. Imas Miniatur «Verbannung», die in Umkehr von Joh 1,1 die Silbenklänge für ursprünglicher als das Wort erklärt:
Die Silben,
wie Kinderklänge,
unverbunden und schön,
sind Melodien aufrichtiger Emotionen
im Bühnenstück der Liebe,
in Bildern und Illusionen über Gott und die Welt,
bevor man sie verbannt
an den Ort,
der anfangs nicht war –
ins Wort
empfand Neeser zunächst als Sackgasse, aus der er sich nur durch die Erfindung einer Sprache ohne Worte herauszuwinden vermochte: «In den stilleren Winkeln am Abend ist Reden wie Rauschen […] Solche Stunden der Demut sind manchmal ein Anfang von Glück. Denn in hellwachen Träumen befährt mich ganz grundlos die Sprache aus Haut oder Haar.» Doch ist auch dem literarisch vielseitigen Autor aus dem Aargau bewusst:
Wie wohl oder weh ich auch werde
Ich lebe von rückwärts, bin
Immer nur der, der ich war
eine Sammlung von alten Geschichten –
ich schreibe sie auf
bis ich weiß, wer ich bin.
Gedankenzimmer, deren Türen offen stehen
Durch Subjektivität, Authentizität, Expressivität und Reflexivität, Perspektivität und Alterität belegt Imas und Neesers «Interplay» den Mehrwert literarisch vermittelten interkulturellen Begegnungslernens wie das Verständigungs- und Humanisierungspotential der Poesie.1 Im Wissen, «dass / die Liebeslieder der Menschen / noch die fernsten Stürme befrieden», setzt Ima den «Festungen der Macht» seine Liebe entgegen für «die schlichten Häuser der Freundlichkeit / mit Gedankenzimmern, deren Fenster offen stehen / zu neuen Horizonten.» Imas Stoßseufzer über «starre Mauern der Wahrheit» bestätigt Neeser mit dem Impuls: «Wenn wir wieder lernten, wie Kinder / in Fragen zu leben. Denn mit Antworten / bauen wir Mauern und niemals / ein wohnliches Haus.» Ja, am Ende schenkt Azizullah Ima «den liebevollen Liedern der Ruhe, die der einzigartige Gott der kindlichen Fantasie mir ins Ohr meiner Seele zu flüstern scheint, meinen Glauben auf ewig.» Und Andreas Neeser beschließt das Buch mit einem resonanten «Ausklang»:
Wenn die uralten Kinder
im Spiel nicht mehr singen
erfind ich uns Reime
für leichtere Lieder
im innersten Winter
verton ich die Ruhe
und hör, überhör uns
hinein
in den offenen Ton.
___

Christoph Gellner, Dr. theol., ist Experte für Literatur und (Welt-) Religion(en), Mitglied der Gesellschaft für die Erforschung der Deutschschweizer Literatur G.E.D.L. und arbeitet u.a. über Islamdiskurse in der Gegenwartsliteratur.
Beitragsbild: Buchcover
- Dazu eingehend Christoph Gellner/Georg Langenhorst: Blickwinkel öffnen. Interreligiöses Lernen mit literarischen Texten, Patmos: Ostfildern 2013. ↩