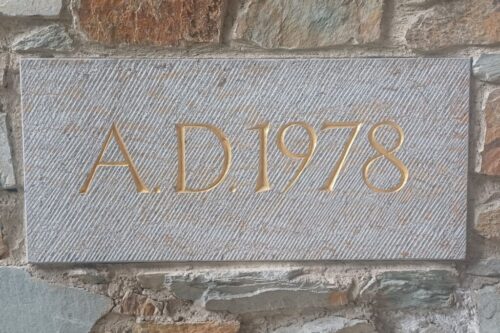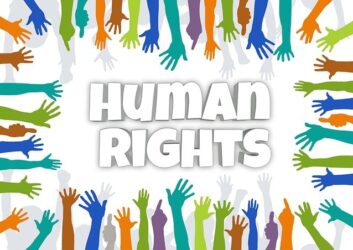Sebastian Holzbrecher (Hamburg) ergänzt in seinem Leserbrief Florian Bocks Beitrag zur „Zeitenwende‘ für den westdeutschen Kaholizismus“ um eine ostdeutsche Perspektive.
Florian Bock hat jüngst gefragt, wann „jene Gegenwart der (west)deutschen katholischen Kirche, in der sie aktuell immer noch steckt“[1] begonnen hat. Die dabei vertretene These, dass sich eine Zeitenwende für den westdeutschen Katholizismus nicht 1968, sondern erst ab Mitte der 1970er Jahren vollzogen habe, lohnt einer eingehenden Diskussion. An dieser Stelle soll die Perspektive auf den westdeutschen Katholizismus um den Blick auf die ostdeutsche Kirche und Theologie erweitert werden. Hat es im ostdeutschen Katholizismus vergleichbare Entwicklungen zur bundesdeutschen „Zeitenwende“ ab Mitte der 70er Jahren gegeben?
Wer den Begriff der „Zeitenwende“ verwendet, setzt sich nicht erst in jüngster Zeit der Kritik aus, dass der Terminus inflationär gebraucht und politisch instrumentalisiert werde. Begrifflich fasst „Zeitenwende“ eine Schwelle des Übergangs, das Ende eine Ära und den Beginn einer neuen Epoche. Dies setzt methodologisch voraus, dass es einen klar identifizierbaren Kipppunkt gibt, an dem sich etwas grundlegend verändert hat. Ob es sinnvoll ist, Zeitenwenden als Zeitgenosse zu postulieren, kann dabei offenbleiben. Eine allzu punktuelle Betrachtung von Geschichte steht allerdings vor der Herausforderung, nicht in schwarz-weiß-Darstellungen abzugleiten. Mit Thomas Nipperdey wäre insofern kritisch einzuwenden: „die Grundfarbe der Geschichte ist grau, in unendlichen Schattierungen.“[2] Zeitenwenden sollten nicht inflationär ausgerufen werden und fallen nicht vom Himmel. Sie haben mindestens einen retrospektiv darstellbaren Vorlauf und der Umschlagpunkt sollte zuvor Vertrautes in einem deutlich veränderten Horizont erkennbar werden lassen.
Mit Blick auf Ostdeutschland ließe sich festhalten, dass mit dem Bau der innerdeutschen Mauer am 13. August 1961 und der „friedlichen Revolution“ am 9. November 1989 durchaus einschneidende Ereignisse greifbar sind, die auch für die Kirche grundlegende Veränderungen im Sinne einer „Zeitenwende“ herbeigeführt haben. Strittig scheint mir dabei allerdings zu sein, ob 1989/90 tatsächlich für Gesamtdeutschland eine Epochenwende darstellt, oder nur für den östlichen Beitrittsteil. Muss man Florian Bocks These von der letzten Zeitenwende in den 1970er Jahren, in der die „katholische Kirche […] aktuell immer noch steckt“, in diese Richtung interpretieren oder melden sich hier nur die „gewohnten Erregungs- und Zuschreibungslogiken“[3] zum Stand der deutschen Einheit?
In der Erforschung der kirchlichen Zeitgeschichte Ostdeutschlands darf seit einigen Jahren als Konsens gelten, dass es zu Beginn der 1980er Jahre zu einem grundlegenden „Paradigmenwechsel“[4] gekommen ist. Josef Pilvousek hat bereits 2006 darauf hingewiesen, dass sich eine neue Bischofsgeneration in Berlin, Erfurt und später in Dresden-Meißen von der kirchenpolitischen Fixierung ihrer Vorgänger auf den SED-Staat gelöst hat, zugunsten einer stärker pastoral orientierten Hinwendung zu den Menschen in der DDR-Gesellschaft. Eine Zeitenwende? Durchaus! 1979 endete mit dem Tod des Berliner Erzbischofs eine nach ihm benannte „Ära Bengsch“ im ostdeutschen Katholizismus und während der französische Philosoph Jean-François Lyotard im gleichen Jahr das Ende der großen Erzählungen ausrief, begann durch die Wahl des Krakauer Erzbischofs Karol Wojtyla zum römischen Papst eine neue Ära, die gerade für die Christen und Kirchen im sozialistischen Ostblock einen Hoffnungsschimmer darstellte.
Der genannte Paradigmenwechsel in der DDR wurde auf unterschiedlichen Ebenen des kirchlichen Lebens flankiert, wofür vier Beispiele genannt seien. 1) Ab 1980 nahm die Zahl der Eintritte ins Erfurter Priesterseminar, der einzigen Ausbildungsstätte für den ostdeutschen Klerus, signifikant gegenüber den vorherigen Jahren zu. 2) In zahlreichen ostdeutschen Gemeinden ließ sich etwa zeitgleich ein verstärktes Interesse an einer intensiveren ökumenischen Zusammenarbeit feststellen. Die Aufrufe des Stadt-Ökumenekreises Dresden mündeten 1988/89 in die „Ökumenische Versammlung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“. Diese Versammlung aller christlichen Kirchen in der DDR stellt mit ihren weitreichenden Forderungen für manche das Präludium für der friedlichen Revolution im Herbst 1989 dar. 3) Die durch die ostdeutschen Synoden in Meißen (1969-1971) und Dresden (1973-1975) eher zum Versanden gebrachten Bemühungen zur Konzilsrezeption in der DDR, nahmen wieder an Fahrt auf und das nicht nur in den katholischen Studierendengemeinden. Die vom Berliner Bischof Alfred Bengsch nach dem Konzil beklagte „Dialogbesoffenheit“ war in der DDR seit 1975 einer weit verbreiteten Ernüchterung gewichen. Auch das teilte man offenbar dies- und jenseits der innerdeutschen Mauer. 4) Die Zurückhaltung, mit der weite Kreise der katholischen Kirche in der DDR einen kritischen Dialog mit dem Sozialismus und der ihn stützenden marxistischen Philosophie abgelehnt haben, wurde Mitte der 1980er Jahre aufgegeben. Besonders der Erfurter Philosoph Konrad Feiereis setzte sich auf internationalen Tagungen konstruktiv mit jüngeren Entwicklungen in der marxistisch-leninistischen Philosophie der DDR auseinander und suchte nach Wegen der Annäherung. Das politische Tauwetter und die innere Auszehrung des SED-Staates im letzten Jahrzehnt seines Bestehens haben diese Entwicklungen sicher mit ermöglicht und beeinflusst.
Meines Erachtens lässt sich für den ostdeutschen Katholizismus von einem Paradigmenwechsel, einer Zeitenwende sprechen, die allerdings erst in den 1980er Jahren greifbar wird. Die unterschiedlichen politischen, gesellschaftlichen und kirchlich-pastoralen Verhältnisse in der DDR sprechen nicht dafür, dass es sich um eine zeitversetzte Übernahme bundesdeutscher Entwicklungen handelte. Dies legen auch Florian Bocks Referenzpunkte nicht nahe. Das Narrativ – in Ostdeutschland wurden nur die „alten Latschen“ des westdeutschen Katholizismus aufgetragen (Erwin Iserloh) – müsste daher eingehender untersucht werden.
Ein zweiter Gedanke drängt sich mit einer komparativen Perspektive auf. Der Berliner Soziologe Steffen Mau hat in seiner Studie „Lütten Klein“[5] u.a. die These vertreten, dass Ostdeutschland eine „frakturierte Gesellschaft“ sei. Mau beschreibt dabei zwei Arten von gesellschaftlichen Brüchen: diejenigen, die offen zu Tage treten und klar nachvollziehbar sind sowie jene, die unter der Haut verborgen und äußerlich nicht erkennbar sind. Vor allem letztere müssten dabei mehr Beachtung finden. Denn durch verborgene Fehlstellungen würden sie die Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit einer Gesellschaft reduzieren, ohne dass man sie selbst, ihre Ursachen und Folgewirkungen einwandfrei identifizieren könne.
Ließe sich nicht auch manche Entwicklung in der katholischen Kirche des 19. und 20. Jahrhunderts – in Ost und West – als Leben mit verborgenen Brüchen beschreiben, die zwar weitgehend unbehandelt unter der Haut verheilt sind, aufgrund von Fehlstellungen aber Funktionseinschränkungen zurückbleiben? Auch wenn oberflächlich alles in Ordnung scheint, büßt eine derart „frakturierte Kirche“ womöglich ihre Vitalität, Authentizität und Attraktivität ein. Der kirchliche Umgang mit der Moderne, die Auseinandersetzungen mit den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts und der Umgang mit sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche könnten diesbezüglich untersucht werden. Ich plädiere dafür, diesen Fragen im ostdeutschen und westdeutschen Katholizismus stärker komparativ nachzugehen und danach zu fragen, welchen Mehrwert das Ausrufen von immer neuen Zeitenwenden tatsächlich in sich birgt, wenn zu 1918, 1933, 1949, 1968, 1989 nun noch 1976-78 hinzukommt. Zudem dürfte es lohnen, die Breiten- und Tiefendimensionen dieser „Zeitenwenden“ intensiver zu analysieren, in Ost und West.
[1] https://www.feinschwarz.net/die-spaeten-1970er/ [letzter Zugriff 30.10.2025]
[2] Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866–1918. Machtstaat vor der Demokratie, Bd. 2 München 1992, S. 905.
[3] Christina Morina, Tausend Aufbrüche, Die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren, München 2023, 302.
[4] Josef Pilvousek, Ein geistlich-geistiges Leitbild für die katholische Kirche in der DDR. Kirche als „theologische Basiswirklichkeit“, in: J. Freitag/ C.-P. März (Hg.), Christi Spuren im Umbruch der Zeiten. Festschrift für Bischof Joachim Wanke zum 65. Geburtstag, (=Erfurter Theologische Studien Bd. 88), Leipzig 2006, 301–318, 311.
[5] Vgl. Stefen Mau, Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft, Berlin 2019, S. 244–249.
Originalbeitrag:
Die späten 1970er – eine „Zeitenwende“ für den westdeutschen Katholizismus?
Beitragsbild: privat