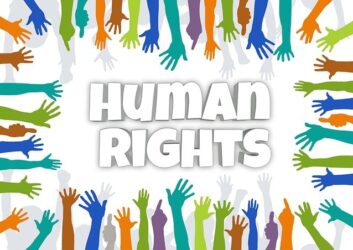Papst Franziskus ist verstorben. Er war ein großer Reformpapst, der die römisch-katholische Kirche synodal geöffnet hat. Seine historische Tragik ist, dass das wohl bei weitem nicht genug war – meint Christian Bauer in seinem Nachruf.
„Der meint ja uns! Ich glaube, der mag Menschen… “ – diese Worte meines Sohnes unmittelbar nach der Wahl von Papst Franziskus werde ich wohl nie vergessen. Was für eine Überraschung, welch eine Befreiung. Ein Papst vom anderen Ende der Welt. Der erste aus dem globalen Süden. Der erste Jesuit. Ratzingers Gegenkandidat im letzten Konklave. Und dann dieser Name. Vor dem Segen die Bitte um das Gebet der Leute, inklusive einer tiefen Verneigung vor ihnen. Kein Klimbim, kein Firlefanz, kein Brimborium. Der Karneval ist vorbei. Die bereitgelegte Mozetta mit Hermelinbesatz verschwindet in der Mottenkiste. Stattdessen einfach nur: Buona sera. Und die Weigerung, in den Apostolischen Palast zu ziehen. Neue Bescheidenheit im Geist des Evangeliums.
Tauwetter nach dem Kirchenwinter
Das Pontifikat von Papst Franziskus habe ich selbst zunächst als eine Befreiung erlebt. Nach der bleiernen Zeit des schier endlosen Doppelpontifikats von Johannes Paul II. und Benedikt XVI. (1978-2013) hatten ich und andere Theolog:innen meiner Generation plötzlich ein ganz neues Kirchengefühl. Nach einer langen Phase des kirchlichen Überwinterns spürte ich im Tauwetter des neuen Papstes erstmals so etwas wie römischen Rückenwind für meine Art von Theologie. Viele Erinnerungen, die mir Franziskus damals sofort sympathisch (und viele römische Monsignori seither nervös) machten, berühren mich noch heute. Sein Tod macht mich traurig – so wie viele Menschen weltweit.
Großer Schritt für die Weltkirche
Was Franziskus in den zwölf Jahren seines Pontifikats an Kirchenreform geleistet hat, war für viele nur ein kleiner Schritt – zugleich aber ein großer für die Weltkirche. Insbesondere seine conversión pastoral hin zu mehr Synodalität wird bleiben und kann die Kirche nachhaltig verändern. Manchen ist er dabei zu weit gegangen. Für viele andere aber noch längst nicht weit genug. Insofern hätte Franziskus eigentlich auch Johannes Paul III. heißen können. Denn er hat zunächst wie ein zweiter Johannes XXIII. begonnen (auch wenn dieser konservativer war als viele denken) und endete dann aber als ein zweiter Paul VI. (auch wenn dieser progressiver war als viele meinen): auf einen verheißungsvollen Kirchenfrühling folgte eine spürbare Reformernüchterung.
Aufbruch, Umkehr und Ernüchterung
Rückblickend lässt sich Amtszeit von Papst Franziskus in drei Phasen strukturieren, die eher sich überlappende Schwerpunkte als aufeinander folgende Zeitabschnitte darstellen. Jede dieser Phasen hat auch mein persönliches Verhältnis zu ihm verändert. Auf das befreite Aufbrechen am Beginn des Pontifikats folgten ein engagiertes Mitgehen in dessen Mitte und schließlich kritische Rückfragen gegen Ende:
- Barmherzigkeit als Signal zu pastoralem Aufbruch (von der Papstwahl 2013 bis Amoris laetitia 2016),
- Missbrauchskrise als Impuls zu synodaler Umkehr (von der Einrichtung der Kinderschutzkommission 2014 bis zur Weltsynode ab 2021),
- Reformstau als Quelle theologischer Ernüchterung (von Querida Amazonia 2019 bis zu seinem Tod 2025).
1. Barmherzigkeit – pastoraler Aufbruch zwischen Biografie und Peripherien
Ausschlaggebend für die überraschende Wahl von Papst Franziskus war wohl seine Rede im Vorkonklave, mit der er nach dem Rücktritt von Papst Benedikt der anstehenden Kirchenreform eine inhaltliche Richtung gab:
„Die Kirche ist dazu berufen, sich selbst zu überschreiten und nicht nur an die geographischen Peripherien zu gehen, sondern auch an die existenziellen […]. […] Es gibt, vereinfacht gesprochen, zwei Kirchenbilder: eine evangelisierende Kirche, die aus sich herausgeht […] und eine mondäne Kirche, die in sich selbst, aus sich selbst und für sich selbst lebt. Unter diesem Licht sind alle denkbaren Veränderungen und Reformen zu sehen, die zum Heil der Seelen anzugehen sind.“[1]
Feldlazarett des Lebens
Aus dieser Grundoption für eine extrovertierte Kirche, die sich in die Peripherien des Menschlichen wagt, ergab sich das Leitbild einer „verbeulte Kirche“[2], die auf dem „Feldlazarett des Lebens“[3] heilsam präsent ist. Während der ersten Pontifikatsjahre kulminierte dieses in dem Begriff der Barmherzigkeit. In der römischen Kirche San Luigi dei Francesi hängt ein Caravaggio („Berufung des Apostels Matthäus“), der den biographischen Kontext dieses pastoralen Leitmotivs erschließt. Kardinal Bergoglio besuchte dieses Bild immer, wenn er in einem nahen Priesterkolleg logierte: „Dieser Finger Jesu, der auf Matthäus weist – so bin ich, so fühle ich mich, wie Matthäus.“[4]
Ein verhasster Kollaborateur
Als Zöllner war dieser ein verhasster Kollaborateur, der an seiner Zusammenarbeit mit den Römern nicht schlecht verdiente. Man kann sich gut vorstellen, wie Bergoglio sich in ihm als autoritär agierender Jesuitenprovinzial wiedererkannte, der während der argentinischen Militärdiktatur äußerst vorsichtig taktierte. Wie der Zöllner Matthäus folgte er dann jedoch dem Umkehrruf Jesu. Dieser erschloss ihm beim Beichtehören während seines ‚Exils‘ in Córdoba die Barmherzigkeit Gottes und ermöglichte eine pastorale Konversion. Miserando atque eligendo – so lautet denn auch sein bischöflicher und päpstlicher Wahlspruch. Frei übersetzt: Aus Barmherzigkeit erwählt.
Zollwächter der Gnade
Weltkirchliche Folgen zeitigte diese persönliche Gnadenerfahrung dann nicht nur im Hl. Jahr der Barmherzigkeit, das Franziskus 2015 anlässlich des 50. Jahrestags des Konzilsabschusses ausrief, sondern ebenso in der wohl berühmtesten Anmerkung der jüngeren Lehrgeschichte: Fußnote 351 des nachsynodalen Schreibens Amoris laetitia. Denn auch mit Blick auf ‚irreguläre‘ Partnerschaften wie z. B. wiederverheirate Geschiedene wollte Papst Franziskus kein rigider „Zollwächter der Gnade“[5] mehr sein – was am rechten Kirchenrand sogleich einschlägige ‚Dubia‘ provozierte. Mit dieser pastoralen Entgrenzung im Zeichen einer größeren Barmherzigkeit war zugleich auch eine geographische verbunden.
Geographische Entgrenzung
Papst Franziskus war nämlich der Überzeugung, dass sich die Kirche von ihren Rändern her erneuern müsse. Weshalb ihn seine erste Reise dann auch programmatischer Weise nach Lampedusa führte, um an den Grenzen Europas an das Schicksal tausender Geflüchteter zu erinnern. Weshalb er das erwähnte Hl. Jahr der Barmherzigkeit nicht wie üblich in Rom eröffnete, sondern am 29. November 2015 in Bangui in der Zentralafrikanischen Republik. Und weshalb er in den Kardinalserhebungen der vergangenen zwölf Jahre immer wieder unbekannte Bischöfe von den Rändern der Weltkirche in deren Zentrum holte – und dabei auch klassische Kardinalssitze überging.
Das gemeinsame Haus
Eine von ihren Rändern her erneuerte Kirche hört nicht ‚nur‘ den „Schrei der Armen“[6], sondern – in der Gesamtökologie eines ‚gemeinsamen Hauses‘ aller Menschen (quer durch die Kulturen und Religionen, bis hin zum Dialogdokument von Abu Dhabi 2019) und Geschöpfe – auch die „Klage der Erde“[7]: Fratelli tutti. E sorelle tutte. Franziskus war daher ein eminent politischer Papst, der nicht nur in prophetischem Freimut Missstände anprangerte („Diese Wirtschaft tötet“), sondern 2015 mit seiner Umweltenzyklika Laudato sí auch höchst wirksam auf dem Pariser Weltklimagipfel intervenierte.
Keine Sofakirche
Sofa oder Boots – vor diese Entscheidungsfrage stellte Franziskus daher nicht nur die Jugendlichen auf dem Krakauer Weltjugendtag 2016, sondern auch die gesamte Kirche. Denn auch sie darf keine selbstzufriedene couch potatoe sein, sondern muss sich in einem pastoralen Aufbruch auf die Socken machen:
„Liebe junge Freunde, wir sind nicht auf die Welt gekommen, um […] aus dem Leben ein Sofa zu machen […]. […] Um Jesus zu folgen, […] muss […] das Sofa gegen ein Paar Schuhe austauschen, die […] Wege zu gehen helfen […], die neue Horizonte eröffnen […]. […] Die Zeit, die wir heute erleben, braucht keine Sofa-Jugendlichen, sondern junge Menschen mit Schuhen, noch besser: mit ‚Boots’ an den Füßen. […] Darum, lieber Freund, liebe Freundin, lädt Jesus dich heute ein, […] deine Spur im Leben zu hinterlassen […]. […] Der Herr segne eure Träume.“[8]
Pathologien des eigenen Innen
Dieser frische, neue Ton wäre unter Franziskus‘ Vorgänger noch undenkbar gewesen. Ebenso spontane Selfies mit dem Papst. All das begeisterte mich in den ersten Jahren seines Pontifikats (und ich finde es noch immer richtig). Nach und nach wurde mir dann aber auch klar, dass der berechtigte Ruf in den ‚Außendienst‘ einer weltpastoral engagierten Kirche zu Sekundäreffekten einer innerkirchlichen Problemverschleierung führen kann. Denn auch im eigenen Innen muss gelten, was nach außen vertreten wird. Und man darf dem eigenen Reformbedarf nicht ausweichen, indem man alles an die Missionsfront wirft („Wichtiger als kirchliche Nabelschau ist die Neuevangelisierung der Gesellschaft“).
Primat der Evangelisierung
Der von Papst Franziskus in seinem Brief an das Volk Gottes in Deutschland mit Blick auf den Synodalen Weg zurecht angemahnte „Primat der Evangelisierung“[9] muss daher mit der eigenen Selbstevangelisierung[10] beginnen. Denn wer nach draußen geht, wird dort unweigerlich mit den Pathologien des eigenen Innen konfrontiert. Strukturfragen reflektieren nämlich Glaubensinhalte – oder sie sind nicht evangeliumsgemäß. Und das größte Evangelisierungshindernis überhaupt ist eine Kirche, deren äußere Gestalt permanent ein Zeugnis wider das Evangelium darstellt. Dass es daher eine umfassende und tiefgreifende Selbstbekehrung der Kirche braucht, scheint auch Papst Franziskus begriffen zu haben.
2. Missbrauchskrise – synodale Umkehr zwischen Klerikalismus und Spiritualität
Franziskus kam mir wie ein kluger, alter Schachspieler vor, der immer schon an den übernächsten Zug denkt. Er veränderte die Dinge nicht mit einem autoritären Handstreich – was möglich, zugleich aber auch selbstwidersprüchlich gewesen wäre. Stattdessen setzte er auf einen langsameren, vermutlich aber nachhaltigeren Weg („Prozesse in Gang setzen statt Räume besetzen“[11]). Franziskus ist in den ‚Maschinenraum‘ kirchlicher Macht hinuntergestiegen und hat den Modus ihrer Ausübung verändert – wenn auch eher in spirituellem als in rechtlichem Sinn. Er hat nur wenige wirkliche Reformentscheidungen getroffen. Aber er veränderte den Weg, auf dem sie zustande kommen. Denn er hat einen synodalen Weg eingeschlagen (bis hin zur stimmberechtigten Teilnahme von Nichtbischöf:innen an der Synode 2024, zur unmittelbaren Übernahme von deren Ergebnissen in das päpstliche Lehramt und zur Weiterentwicklung im Sinne einer weltweiten Kirchenversammlung im Jahr 2028[12]), um die Wende zu einer „ganz und gar synodalen Kirche“[13] zu initiieren. Synodalität als gemeinsamer Weg („syn-hodos“) kirchlicher Selbstbekehrung zum Evangelium. Wie bitter nötig diese ist, zeigt die noch immer andauernde Missbrauchskrise.
‚Fliegenschiss‘ der Kirchengeschichte?
Diese stellt eine epochale Zäsur der Kirchengeschichte dar. Sie eröffnet eine neue Phase der Nachkonzilszeit, denn in ihr hat die Kirche das Versprechen des Konzils verraten, ein „Sakrament des Heils“[14] zu sein. Stattdessen erwies sie sich als Ort des Unheils, an dem nicht nur unschuldige Opfer missbraucht, sondern auch schuldige Täter gedeckt wurden, weil man das Ansehen der Institution und nicht das Leben der Opfer schützen wollte. Es gibt ganze Ortskirchen, in denen noch immer jene schreckliche Problemignoranz herrscht, die auf dem Höhepunkt der Missbrauchskrise (oder besser auf einem ihrer Tiefpunkte) sichtbar wurde, als Kardinaldekan Angelo Sodano, der bereits als Päpstlicher Nuntius während der rechtsextremen Militärdiktaturen in Lateinamerika keine gute Rolle spielte, am Ende der Ostermesse 2010 in einer Solidaritätsadresse an Papst Benedikt versicherte, die Kirchenkritik angesichts der Missbrauchsfälle sei nicht mehr als ein chiacchiericcio del momento (= ein Geschwätz des Augenblicks, man könnte intentionsgemäß auch übersetzen: ein ‚Fliegenschiss‘ der Kirchengeschichte).
Missbrauch, Klerikalismus und Synodalität
Franziskus hat mit dieser römischen Mentalität gebrochen. 2014 richtete er eine Päpstliche Kommission zum Schutz von Minderjährigen eingerichtet, 2016 stellte er die Vertuschung von Missbrauch unter Strafe und 2019 rief er zu einem ‚Missbrauchsgipfel‘ nach Rom. Vor allem aber packte er das Problem an der Wurzel seiner systemischen Ursachen (Stichwort: sakralisierte Machtasymmetrien). Die von ihm hergestellte Verknüpfung von Missbrauch, Klerikalismus und Synodalität ist dabei von zentraler Bedeutung. Denn es gilt einerseits: „Zum Missbrauch Nein zu sagen, heißt zu jeder Form von Klerikalismus mit Nachdruck Nein zu sagen.“[15] Und andererseits ist Synodalität ein probates „Gegenmittel“[16] gegen eben diesen Klerikalismus – weshalb die synodale Wende seines Pontifikats auch auf direkte Weise mit der Missbrauchskrise verbunden ist. Synodalität in diesem Sinn zielt auf eine jesusbewegte Selbstbefreiung der Kirche aus ihrem machtförmigen Klerikalismus.
Kirche als Societas Jesu
Die synodale Kirche, die Franziskus vorzuschweben schien, erinnert daher an seine eigene Ordensgemeinschaft, die Gesellschaft Jesu (SJ). Societas Jesu, jesuanische Weggefährt:innenschaft der Nachfolge, das waren für ihn zunächst einmal alle Getauften. Für diese gilt nämlich vor allen amtlich-funktionalen Differenzierungen IHS: Wir haben Jesus als Gefährten („Iesum habemus socium“). Diese jesusspirituelle Grundausrichtung prägte auch seinen ignatianisch grundierten Begriff des Synodalen, der in einem gemeinsamen geistlichen Unterscheiden besteht, das ein anschließendes amtliches Entscheiden synodal vorbereitet: „Alle werden gehört, einige beraten, einer entscheidet“[17]
Monophysitische Schieflage
Jede Synode ist ein geistliches Ereignis. Zugleich ist sie aber auch ein rechtliches und ein politisches Event. Das hat mit der prinzipielle Doppelstruktur von Kirche zu tun. Diese nämlich ist dem Konzil zufolge eine „realitas complexa“ (Lumen gentium, Nr. 8), die sich aus einem „menschlichen“ (LG 8) und einem „göttlichen Element“ (LG 8) zusammensetzt. Franziskus überbetonte ihren göttlichen Aspekt als „geistliche Gemeinschaft“ (LG 8) und unterschätzte ihr menschliches Wesen als „sichtbare Versammlung“ (LG 8). Die – dogmatisch gesprochen – implizite Ekklesiologie seines pneumatologisch grundierten Synodalkonzepts („Der Hl. Geist ist der Hauptakteur der Synode“[18]) hatte eine monophysitisch-spiritualistische Schlagseite. Und diese führte zur Gefahr eines päpstlichen ‚Doketismus‘, der Synodalität lediglich als einen ‚Scheinleib‘ betrachtet, dessen geistliche Erfahrungen sich nicht in rechtliche und politische Kirchenstrukturen inkarnieren müssen.
Tribalisierung des Volkes Gottes
Den spirituellen Optimismus des Papstes, dass die „hierarchische Organe“ (LG 8) der Kirche ihren synodalen Geisterfahrungen schon irgendwann folgen werden, musste man nicht teilen. Denn auch in der Kirche gibt es eine asymmetrische Tribalisierung[19] des rechten Randes (inkl. einer sehr ungleichen Mobilisierung von Traditionalist:innen und Reformorientierten auf beiden Seiten des Spektrums): Das eine Volk Gottes zerfällt in mindestens zwölf Stämme mit sehr unterschiedlichem Kirchen- und Weltgefühl. Deren kaum noch mediierbare Konflikte[20] stellen die synodale Basistugend der Parrhesia auf eine harte kirchenpolitische [LINK] Probe: „Mit Freimut sprechen und mit Demut hören.“[21]
Fähigkeit zu reflexiver Selbstdifferenz
Synodalität ist daher von ihren eigenen Voraussetzungen her eine geistliche Herausforderung. Sie erfordert nämlich die Fähigkeit zu reflexiver Selbstdifferenz: Man muss sich zu sich selbst noch einmal verhalten können – und Gott größer sein lassen als die eigenen kirchenpolitischen Verortungen. Schade ist nur: Diese Fähigkeit ist nicht auf allen Seiten gleich stark ausgeprägt – manche katholische Mindsets widersprechen ihr sogar grundsätzlich. Denn es gibt ja nicht nur Katholik:innen, mit den man nicht einfach reden kann. Sondern auch solche, mit denen man einfach nicht reden kann.
3. Reformstau – theologische Ernüchterung zwischen Konzil und Synode
Anders als sein Vorgänger Benedikt XVI.[22], hat Franziskus in diesen Konflikten das Zweite Vatikanum stets in robuster Weise gegen seine traditionalistischen Gegner verteidigt (Stichwort: „Traditionis custodes“). Er hat nicht nur die Konzilspäpste Johannes XIII. und Paul VI. heiliggesprochen (und somit auch das Konzilserbe abgesichert), sondern auch immer wieder klargestellt, man müsse in ihren Spuren nun in „kreativer Treue zur Tradition“[23] voranschreiten „zu den neuen Horizonten, zu denen der Herr uns führen möchte“[24]. Das Konzil habe nämlich eine „irreversible, vom Evangelium ausgehende Erneuerungsbewegung hervorgebracht“[25]: „Und jetzt muss man vorangehen.“[26]
Grundansatz der Befreiungstheologie
Franziskus vertrat daher nicht nur einen pastoral turn des kirchlichen Lehramtes, sondern auch der akademischen Theologie. Diese dürfe keine reine „Schreibtischtheologie“[27] mehr sein, sondern müsse „nach Volk und nach Straße“[28] riechen: „Der Ort eures Nachdenkens sollen die Grenzbereiche sein.“[29] Ohne selbst ein ausgewiesener Befreiungstheologe zu sein, hat er deshalb nicht nur 2018 den befreiungstheologisch inspirierten Märtyrerbischof Oscar Romero heiliggesprochen, sondern auch jahrzehntelang verfolgte Befreiungstheologen wie Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff oder Ernesto Cardenal rehabilitiert. Deren praxistheoretischen Grundansatz[30] erklärte er in dem Motu proprio Ad theologiam promovendam sogar zur theologischen Norm:
„Die theologische Reflexion ist […] zu […] einem Paradigmenwechsel aufgerufen […], der sie […] dazu verpflichtet, eine grundlegend kontextuelle Theologie zu sein, die in der Lage ist, das Evangelium unter den Bedingungen […] zu interpretieren, unter denen Männer und Frauen tagtäglich […] leben […]. […] Dies ist der pastorale ‚Stempel‘, den die Theologie als Ganzes und nicht nur in einem bestimmten Bereich annehmen muss […]. Die theologische Reflexion ist aufgefordert, sich mit einer induktiven Methode zu entwickeln, die von den verschiedenen Kontexten […] ausgeht, in welche die Menschen hineingestellt sind […].“[31]
Pastorale Wende
Das sind päpstliche Worte, auf die man nicht nur in der Praktischen Theologie hierzulande lange gewartet hat – und die unter den beiden Vorgängern des verstorbenen Papstes kaum vorstellbar gewesen wären. Höchstlehramtlich realisieren sie die „pastorale Wende“[32] des Konzils auf der Ebene des theologischen Diskurses. Die Konsequenzen für eine zukünftige Grundausrichtung der Theologie benannte 2017 die Apostolische Konstitution Veritatis gaudium zur Reform der kirchlichen Studien:
„[Einer] […] der wichtigsten Beiträge des Konzils [war es, die] […] Trennung zwischen Theologie und Pastoral […] zu überwinden. Ich wage zu sagen, dass es die Grundordnung der Theologie […] gewissermaßen revolutioniert hat. […] Die Fragen unseres Volkes, […] seine Träume, seine Kämpfe, seine Sorgen besitzen einen hermeneutischen Wert, den wir nicht unbeachtet lassen dürfen, wenn wir das Prinzip der Menschwerdung ernst nehmen wollen.“[33] (VG 2; 5).
Pastoral offen, dogmatisch unbeweglich
Das ist weit mehr als nur wohlklingende Lehramtspoesie. Es ist ernst gemeint und ernst zu nehmen. Und doch stehen diese Grundoptionen des programmatischen Teils von Veritatis Gaudium in Spannung zu den Einzelnormen ihres juridischen Teils. Generell hat sich Franziskus in innerkirchlichen Streitfragen zwar durchaus als pastoral offen, zugleich aber auch als dogmatisch unbeweglich erwiesen. Wenn er „jesuanisch milder“[34] im Ton war, sich jedoch „auf der Ebene der Lehre anders positioniert[e] als auf der der Pastoral“[35], dann wurde er dem konziliaren Ineinander von Dogma und Pastoral[36] damit nicht gerecht – eine halbierte Konzilsrezeption, die zwar den pastoralen Sinn des Dogmas, nicht aber die dogmatische Bedeutung der Pastoral erfasst.
Bruchpunkt der Enttäuschung
In diesem Zusammenhang war das nachsynodale Schreiben Querida Amazonia für viele ein erster Bruchpunkt der Enttäuschung. Hatte das Schlussdokument der Amazoniensynode von 2019 noch eine ökologische Gesamtvision des „guten Lebens für alle und alles“[37] (inklusive jener Figur der Pachamama, die von rechtskatholischen Extremisten in den Tiber geworfen wurde) entwickelt, die auch umstrittene Kirchenprobleme (bis hin zu Fragen wie Zölibat und Frauenordination) integrierte – so blieb letzteres jedoch ohne päpstliche Konsequenzen im nachsynodalen Schreiben. Das war für viele eine bittere Enttäuschung, die zugleich auch so manche Täuschung beendet hat: Franziskus war nie ein progressiver Liberaler im Sine des westlichen Reformkatholizismus.
Konservativ, aber nicht reaktionär
Ich erinnere mich noch gut an Artikel zum Konklave 2005, in denen Bergoglio als einzig aussichtsreicher Gegenkandidat Ratzingers gehandelt wurde: konservativ (aber nicht reaktionär) in dogmatischen Fragen, zugleich aber überzeugend (aber nicht revolutionär) in seinem pastoralen Stil. Lehre und Leben treten auseinander. So blieb denn auch die von ihm propagierte Barmherzigkeit zweischneidig: biografisch nachvollziehbar, zugleich aber nicht ohne fürsorglich-autoritären Paternalismus. Es gibt sogar mehr Gemeinsamkeiten zwischen Franziskus und Benedikt XVI. als viele meinen, z. B. ihren lehramtlichen Populismus. Beide machten sich nämlich zum Sprachrohr des (in unkritischer Idealisierung romantisierten) ‚einfachen Volkes‘ und brachten dieses gegen (vermeintlich) herrschende theologische Eliten (vor allem im deutschsprachigen Kontext[38]) in Stellung. Hinzu kommen irritierende Aussagen zu Sexualität (Stichwort: Kaninchen), Erziehung (Stichwort: Ohrfeigen) oder Frauen (Stichworte: fruchtbares Empfangen, marianischer Genius).
Ortskirchen verweigern sich
Und doch ist diese enttäuschende Seite nicht die ganze Wahrheit. Es wäre provinziell, das zu Ende gegangenen Pontifikat nur in westlich-reformkatholischer Optik zu betrachten. Im Gespräch mit Menschen aus anderen Weltgegenden kann man erfahren, wie herausfordernd Papst Franziskus für manche Kirchenregionen (z. B. in den USA, in Afrika und Osteuropa) war. Ganze Ortskirchen verweigern sich dem weltsynodalen Reformprozess. Für ihre kirchenpolitischen Gegenmaßnahmen nutzen sie die neue synodale Freiheit in der Kirche. Ein kontinentaler Widerstand wie jener der besonders konservativen afrikanischen Bischofskonferenzen gegen Fiducia supplicans wäre unter den beiden Vorgängern von Papst Franziskus unvorstellbar gewesen.
Erzliberal und ultraprogressiv
Diese aktuellen Debatten zeigen, wie sehr sich die innerkirchliche Machtkonstellation unter den Päpsten Johannes Paul II. und Benedikt XVI. kirchenpolitisch nach rechts verschoben hat (inkl. entsprechender Bischofsernennungen). Solange ganze Bischofskonferenzen die Missbrauchskrise ignorieren, ihre klerikalistischen Systemursachen leugnen und synodale Umkehrwege torpedieren – so lange bleibt Franziskus, wenn man ihn globale Kirchenkoordinaten einordnet, für große Teile der Weltkirche ein erzliberaler und ultraprogressiver Papst, für manche sogar ein manifester Häretiker (Stichwort: Sedisvakantismus). Mit Blick auf die Nachhaltigkeit des begonnenen Aufbruchs fragt man sich: Es gibt eine Generation Benedikt – aber wird es auch eine Generation Franziskus geben? Und welcher Priestertypus wird in den kommenden Jahrzehnten die Kirche führen?
Für manche zuviel und dennoch nie genug
Ein Nachruf darf nicht weniger komplex sein als das Leben, dem er etwas Erinnerndes nachzurufen versucht. Das gilt auch für Papst Franziskus. Er hat die Kirche zweifellos verändert. Sie ist heute eine andere als noch unter seinen beiden Vorgängern. Kaum wurden jedoch die systemischen Probleme einer sich zaghaft und mühsam transformierenden Weltkirche endlich in relativer Freiheit synodal besprechbar, lähmten ihre Kontraste schon jeden weiteren Fortschritt. Es ist die Tragik seines Pontifikats, dass all das für Konservative zuviel und für Progressive nie genug war. Nach zwölf Jahren herrscht daher nicht nur zunehmende Ernüchterung im Reformlager, sondern am rechten Kirchenrand auch ein blanker Hass (inkl. Gebete für das baldige Ableben des Papstes), der für fortschrittliche Katholik:innen während des nachkonziliaren ‚Rollbacks‘ unter Johannes Paul und Benedikt undenkbar schien. Es bleiben zwiespältige Gefühle: Ich habe Franziskus persönlich sehr gemocht. Und ich habe mit ihm zugleich auch theologisch sehr gehadert.
Er war ein großer Papst, auch in seinen Grenzen.
[Langfassung des Nachrufs]
[1] Jorge Mario Bergoglio: Rede auf der IX. Kongregation des Kardinalskollegiums (9. März 2013).
[2] EG 49.
[3] Papst Franziskus, zit. nach Antonio Spadaro: Das Interview mit Papst Franziskus.
[4] Papst Franziskus, zit. nach Antonio Spadaro: Das Interview mit Papst Franziskus.
[5] Papst Franziskus, zit. nach Antonio Spadaro: Das Interview mit Papst Franziskus.
[6] Papst Franziskus: Laudato sí. Enzyklika über die Sorge für das gemeinsame Haus (24. Mai 2015), 49 [nachfolgend: LS].
[7] LS 49.
[8] Papst Franziskus: Ansprache auf der Gebetswache mit den Jugendlichen in Krakau (30. Juli 2016).
[9] Papst Franziskus: Brief an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland, 9
[10] Paul VI.: Evangelii nuntiandi. Nachsynodales Schreiben über die Evangelisierung in der Welt von heute (8. Dezember 1975), 15. Siehe dazu auch Christian Bauer: Vom Lehren zum Hören? Offenbarungsmodelle und Evangelisierungskonzepte im Übergang vom Ersten zum Zweiten Vatikanum, in: Julia Knop/Michael Seewald (Hg.): Das Erste Vatikanische Konzil. Eine Zwischenbilanz 150 Jahre danach, Darmstadt 2019, 95-116.
[11] EG 223.
[12] Vorbild dürfe die Weiterentwicklung der CELAM-Bischofsversammlungen in Lateinamerika sein, die seit 2021 als Asamblea Eclesial des gesamten Volkes Gottes abgehalten werden.
[13] Papst Franziskus: Ansprache zur 50-Jahr-Feier der Errichtung der Bischofssynode (17. Oktober 2015).
[14] Dieses Versprechen haben beide Kirchenkonstitutionen des Konzils gegeben: seine dogmatische (Lumen gentium, Nr. 48) und seine pastorale (Gaudium et spes, Nr. 45).
[15] Papst Franziskus: Brief an das Volk Gottes (20. August 2018).
[16] Papst Franziskus: Ansprache zu Beginn der Jugendsynode (3. Oktober 2018).
[17] Vgl. Julia Knop: Communio hierarchica – communicatio hierarchica. Synodalität nach römisch-katholischer Façon, in: Markus Graulich, Johanna Rahner (Hg.): Synodalität in der katholischen Kirche. Die Studie der Internationalen Theologischen Kommission im Diskurs (QD 311), Freiburg/Br. 2020, 153–169, 161.
[18] Papst Franziskus: Eröffnung der Bischofssynode für die Amazonasregion (7. Oktober 2019).
[19] Christian Bauer: Mehr Synodalität wagen? Kirchenpolitik im Kontext asymmetrischer Tribalisierung, in: Fernblick. Onlinemagazin von Theologie im Fernkurs (Nr. 12 – Januar 2022). Siehe auch Ders.: Romexkursion als theologisches Forschungsfeld? Ein Seminar zur Weltsynode 2024 (Teil 1), auf: Feinschwarz.net (24. Oktober 2024) sowie Kirchenpolitik als theologisches Forschungsfeld. Ein Seminar zur Weltsynode 2024 (Teil 2), auf: Feinschwarz.net (25. Oktober 2024).
[20] Christian Bauer: Wer hören will, muss fühlen. Zum Umgang mit Dissens in synodalen Prozessen, in: Dietmar Winkler, Roland Cerny-Werner (Hg.): Synodalität als Möglichkeitsraum: Erfahrungen – Herausforderungen – Perspektiven, Innsbruck 2023, 113-128.
[21] Papst Franziskus: Ansprache zur Eröffnung der Bischofssynode (6. Oktober 2014).
[22] Vgl. Christian Bauer: Pastorale Lehrverkündigung? Wider die Relativierung der dogmatischen Autorität des Zweiten Vatikanums, in: Diakonia (2013), 43-47.
[23] Papst Franziskus: Discorso ai membri della commissione teologica internazionale (24. November 2022).
[24] Papst Franziskus: Ansprache zum 25. Jahrestag der Veröffentlichung des Katechismus der katholischen Kirche (11. Oktober 2017).
[25] Papst Franziskus: Brief zum hundertjährigen Bestehen der Katholisch-theologischen Fakultät von Buenos Aires (3. März 2015).
[26] Papst Franziskus: Brief zum hundertjährigen Bestehen der Katholisch-theologischen Fakultät von Buenos Aires (3. März 2015). Man kann den 2021 begonnenen synodalen Weltprozess vor diesem Hintergrund als eine Art ‚Konzil in Zeitlupe‘ verstehen (vgl. Christoph Theobald: Un nouveau concile qui ne dit pas son nom? Le synode sur la synodalité, voie de pacification et de créativité, Paris 2023).
[27] EG 133.
[28] Papst Franziskus: Brief zum hundertjährigen Bestehen der Katholisch-theologischen Fakultät von Buenos Aires (3. März 2015).
[29] Papst Franziskus: Brief zum hundertjährigen Bestehen der Katholisch-theologischen Fakultät von Buenos Aires (3. März 2015).
[30] Dazu passt auch, dass Papst Franziskus 2021 zum 130. Geburtstag der katholischen Soziallehre mit der päpstlichen Tradition entsprechender Sozialenzykliken brach (vgl. Christian Bauer: Soziallehre vs. Befreiungstheologie, oder: Warum es diesmal keine neue Enzyklika gibt, auf: Feinschwarz.net (8. Juni 2021).
[31] Papst Franziskus: Ad theologiam promovendam. Apostolisches Schreiben nach Art eines Motu proprio (1. November 2023).
[32] Vgl. Christian Bauer: Pastorale Wende? Konzilstheologische Anmerkungen, in: Christian Bauer, Michael Schüßler (Hg.): Pastorales Lehramt? Spielräume einer Theologie familialer Lebensformen, Ostfildern 2015, 5-45.
[33] Papst Franziskus: Veritatis gaudium. Apostolische Konstitution über die kirchlichen Universitäten und Fakultäten (8. Dezember 2017), 2; 5.
[34] Magnus Striet: Ende der Richtlinienkompetenz. Der Papst setzt auf Pragmatik, auf: Katholisch.de (16. Oktober 2023).
[35] Magnus Striet: Ende der Richtlinienkompetenz. Der Papst setzt auf Pragmatik, auf: Katholisch.de (16. Oktober 2023).
[36] Vgl. Christian Bauer: Die Pastoralität des Zweiten Vatikanischen Konzils. Zur Genealogie eines zentralen Konzilsdiskurses, in: Sandra Arenas, Edoh Bedjra, Catherine Clifford u. a. (Hg.): Allgemeine Einführung und Hermeneutik. Das Zweite Vatikanische Konzil – Ereignis und Auftrag (Bd. 1), Freiburg/Br. 2024, 413-425.
[37] Manuela Kalsky: Ein Netzwerk-Wir: Religion im Zeitalter der Superdiversität, in: Zeitschrift für Pastoraltheologie (2024), 93-107, 103 (siehe auch Christian Bauer: Buen vivir – gutes Leben? Pastoraltheologie im Zeichen der Klimakatastrophe in: Zeitschrift für Pastoraltheologie (2022), 7-18).
[38] So kritisierte Papst Franziskus am 24. Januar 2023 in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP, der Synodale Weg in Deutschland sei ‚elitär‘, da er von einer kleinen theologischen Elite angeführt werde und nicht das ganze Volk Gottes miteinbeziehe. Und Papst Benedikt hatte bereits angesichts der ‚Causa Hans Küng‘ zur Aufgabe des Lehramtes erklärt, den Glauben einfacher Katholik:innen gegen die Macht der Intellektuellen zu verteidigen: „Seine Aufgabe ist es, dort zur Stimme der Einfachen zu werden, wo Theologie das Glaubensbekenntnis nicht mehr auslegt, sondern es in Besitz nimmt und sich über das einfache Wort des Bekenntnisses stellt. Insofern wird zwangsläufig das Tun des Lehramts immer den Ruch des Naiven an sich haben. [Es] […] schützt den Glauben der Einfachen; derer, die nicht Bücher schreiben, nicht im Fernsehen sprechen und keine Leitartikel in den Zeitungen verfassen können.“ (Joseph Ratzinger: Was ist Freiheit des Glaubens? Silvesterpredigt 1979, in: Joseph Ratzinger: Gesammelte Schriften (Bd. 9), Freiburg/Br. 2016, 324–339, 335).
Beitragsbild: Shutterstock
Karikatur: Gerhard Mester