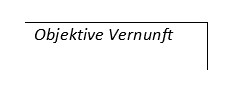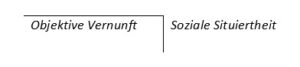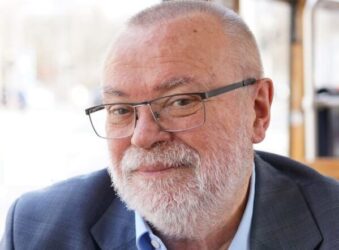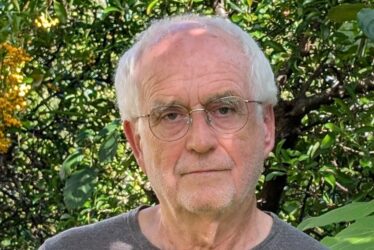Kontextualität oder Situiertheit werden in Theologie und Kirche oft schlagwortartig gebraucht oder als unsachliche Politisierung der Vernunft abgelehnt. Michael Schüßler stellt Donna Haraways zentralen Text vor und diskutiert am Beispiel „epistemischer Unregerechtigkeit“ (Miranda Fricker) die Potenziale einer praxistheologischen Orientierung.
1. Eine virulente Kontroverse
Wie jede Theologie entsteht dieser Beitrag aus den Fragen einer konkreten Situation heraus. 2022 hatte Christian Bauer die kontroversen Debatten zwischen Analytischer und Kontinentaler Theologie[1] mit seinem Text „Allianzen im Widerstreit“[2] noch einmal aufleben lassen und auch pastoraltheologische Positionen darin verwickelt. Im Februar 2023 trafen sich dann die an der Debatte Beteiligten zum gemeinsamen Workshop „Epistemologie der Ränder“, in dessen Kontext die folgenden Überlegungen situiert sind.[3]
Bauers Ansatzpunkt war „die neue Gesamtsituation einer sich postkolonial neuformierenden Welttheologie“[4]. Auch deutschsprachige Theologie und analytische Epistemologie seien „immer schon ‚provinziell‘: ein partikularer Ort mit ganz eigenen Kontingenzen.“[5] Die für Praktische Theologien konstitutive Lebensweltorientierung sei deshalb von epistemologischer Bedeutung für ihre Wissensformen.
Thomas Schärtl und Benedikt Göcke haben ihre Entgegnung auf diese Position auch am Topos „Situiertes Wissen“ festgemacht. Analytische Religionsphilosophie sei dem an Kant geschulten Grundsatz verpflichtet, „dass immer nur das Argument zählt – und nicht primär die Autorität, die das Argument formuliert, oder die Epoche und Kultur, aus der es stammt“[6]. Dazu schreiben sie:
„Sowohl Bauer als auch Schüssler [sic!] präsentieren Beispiele für eine Wende in einem kulturwissenschaftlichen, humanwissenschaftlichen Theoriesetting: Wenn von einigen Pastoraltheologen ein sogenanntes ‚situiertes Wissen‘ […] beschworen wird, dann enthält diese Forderung eine kaum verschleierte Kritik an der tradierten Wissenschafts- und Universitätspraxis. Unter postkolonialen Vorzeichen gilt sie als eurozentrisch und rassistisch.“ Diese Kritik laufe „darauf hinaus, das wissenschaftliche Ideal objektiver Erkenntnis infrage zu stellen. Der entscheidende Maßstab soll stattdessen die authentische erstpersönliche und vor der eigenen kulturellen Identität gerechtfertigte Erfahrung sein. […] Eine Position müsse demzufolge zunächst dialektisch enttarnt und dekonstruiert werden oder sich im ‚situierten Wissen‘ kontextualisieren und perspektiven-relativistisch konfrontieren lassen, um überhaupt als berechtigt und bedeutsam gelten zu können.“[7]
Dieser Passage lassen sich mindestens drei Aussagen entnehmen.
(1) Das Theorem „situiertes Wissen“ enthält eine Kritik an herkömmlicher westlicher Wissenschaftspraxis und deren Vernunftbegriff, indem diese mit Kategorien wie „eurozentrisch oder rassistisch“ in Verbindung gebracht werden. Das ist richtig und begründbar und kann sogar um die Kategogien „patriarchal oder sexistisch“ ergänzt werden. Es folgt intersektionaler Wissenschafts- und Gesellschaftskritik, die weltweit erforscht und diskutiert wird.[8]
(2) Diese tradierte Wissenschaftspraxis müsse sich mit der eigenen Kontextualität und Perspektivität konfrontieren lassen. Auch das ist ganz offenbar der Fall.
(3) Bei dieser Kritik aber werde Wissenschaftlichkeit und vor allem das Ideal wissenschaftlicher Objektivität aufgegeben, indem es durch erstpersönliche, subjektive Erfahrung und kulturelle Identitätspolitik ersetzt wird.
An dieser letzten Aussage wird die folgende Argumentation ansetzen und der Frage nachgehen, ob diese Einschätzung einer kritischen Prüfung standhalten kann. Dazu wird zunächst ein Blick auf das Verhältnis von freistehenden, abstrakten Begründungen zu in Praxis- bzw. Körperverhältnisse eingebetteten Begründungen geworfen. Der oft schlagwortartige Gebrauch „situiertes Wissen“ wird anschließend mit einer genauen Lektüre des einschlägigen Textes von Donna Haraway in seinen epistemologischen und normativen Konturen herausgearbeitet. Von dort aus kann ein kritischer Abgleich mit den Einschätzungen von Thomas Schärtl und Benedikt Göcke erfolgen. Dieser Wissensstand wird im Ausblick an die eingangs aufgeworfene Frage nach einer künftigen Provinzialisierung westlicher Theologie rückgebunden.
2. Von Gründen und Abgründen: Theologie im Practice Turn
Die Auseinandersetzung zwischen (post)metaphysischen Theologien mit universalisierten Geltungsansprüchen und kontextuellen Theologien mit situierten Erkenntnispraktiken zieht sich durch die jüngere christliche Theologiegeschichte. Man denke nur an die Auseinandersetzungen um die Befreiungstheologien oder an die Anfangsjahre der feministischen Theologien im 20. Jahrhundert. Aber sogar die, übrigens fast ausschließlich männlichen und priesterlichen, Befreiungstheologen haben ihr theologisches Denken an den europäischen Fakultäten Münster, München oder Leuven gelernt. Doch, wie Bauer schreibt, die „Zeit der großen Namen scheint auch im deutschsprachigen Sprachraum vorbei zu sein“[9]. Der in sehr unterschiedliche theologische Strömungen anschlussfähige Graham Ward hat die neue Lage in einem Vortrag an der Stellenbosch University in Südafrika einmal so skizziert: „after two centuries, Germany is no longer the intellectual powerhouse for theological and philosophical thinking; nor is France the powerhouse for post Second World War radical thinking and critical theory. They cannot speak universally. In fact, the attempt to speak universally leads to fracture and further fracture until we are back with the local and the embodiment of the particular. We are back with why place matters (land, histories, languages) – in every sense of that word ‘matters’.”[10]
Graham Wards Beobachtung kann als Teil eines Practical Turn im intellektuellen Feld insgesamt gelesen werden.[11] Verkörperungen, Materialitäten und situierte Kontexte werden als konstitutiv angesehen für die Geltungsansprüche von Gründen bei der Herstellung von (Glaubens)Wirklichkeit. In der deutschsprachigen Philosophie unterscheidet Matthias Jung drei Arten des Begründens.[12] Freistehendes Begründen macht sich, wie etwa die analytische Philosophie, möglichst frei von situativen Bedingungen und vertraut der kritischen Kraft abstrahierender Vernunft. Dabei besteht allerdings die Gefahr, dass man im „Kantianischen Versuch zur Reinigung der öffentlichen Vernunft von kontingenten Beimischungen verkörperter Traditionen das Kind mit dem Bade ausschüttet“, indem nur noch „freistehende und nicht mehr verkörperte Gründe zählen“[13]. Eingebettetes Begründen bezieht dagegen auch praktische Erfahrungen argumentativ mit ein. So basiert die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte zwar einerseits auf universalen Vernunftgründen, aber ebenso auf dem praktischen Hintergrund der Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Verkörpertes Begründen nimmt schließlich die leibhafte Existenz des Menschen nicht nur als Ort der Einschreibung von Normen wahr, sondern auch als „Verkörperung bottom-up, verstanden als eine Quelle rationaler Kreativität, als locus von qualitativen Intensitäten und sensomotorischen Gewohnheiten, die den Lauf der diskursiven Vernunft inspirieren und formen“[14]. Die Kraft zu Universalisierungen und Objektivität sei damit nicht aufgegeben. „Doch auch diese Kraft bleibt verkörpert; sie kann nicht mehr nach dem Modell der diskursiven Selbstbefreiung des Geistes durch freistehende Argumentation gedacht werden“[15].
Praktische Situiertheit als Bedingung der Wissensproduktion zu verstehen, das hat die Theologien in den letzten Jahrzehnten verändert. Die Genese Praktischer Theologie / Pastoraltheologie ist eng mit dieser Wende verbunden, so Ottmar Fuchs: „Die Kontextbezogenheit der Praktischen Theologie als Wissenschaft ist ihr von der praxisbezogenen Zielsetzung eingeschrieben. Die Wahrnehmung eines differenzierten Kontextbezugs ist eine Funktion ihrer Konkretionsqualität“[16]. Ähnliches hat auch die systematisch-theologischen Fächer erfasst.[17] Hans Joachim Sander und Gregor Maria Hoff skizzieren ihr Projekt der „Glaubensräume“ in diesem Sinn: „Die topologische Theologie geht von Orten aus, […] lässt sich auf die relativierende Dynamik gesellschaftlicher Heterotopien ein, um die Bedeutung des Evangeliums zu erfassen“ und „ist entsprechend auf reale Probleme geeicht“[18]. Die Fächergrenzen verschwimmen, wenn Hoff an anderer Stelle schreibt, nachdem „der Performative Turn in der praktischen Theologie bereits intensiv rezipiert wurde“ verschiebe sich jetzt auch „der fundamentaltheologische Ansatz hin zu einer praktischen Perspektivierung theoretischer Glaubensverantwortung. Das Zeichen ‚Gott‘ lässt sich nicht anders als in den Formen seiner Bezeichnung erreichen und bestimmen“[19] Und diese Bezeichnungen gibt es eben nicht außerhalb einer Situiertheit in Praxisvollzügen, angesichts von Missbrauchskrise, Klimakatastrophe, neuen Kriegen oder digitaler Technologien. Eine praxistheoretisch gewendete Theologie erforscht nicht nur den Raum der guten Gründe, sondern die mehrdeutige Wirklichkeit faktischer Abgründe.[20] Nach Judith Gruber kann deshalb „die Ereignishaftigkeit Gottes […] nicht mehr an ein übernatürliches Wesen rückgebunden werden. Doch wo ist dieser Gott dann zu finden? Wie ereignet sich Gott in den Singularitäten kontingenter Ereignisse?“[21] Ähnlich schreibt Hanna Reichel für die Constructive Theology „it pushes for expanding the analysis to take the contextual conditioning, power dynamics, and real-life effects of cognitive systems into account, instead of merely assessing their inner coherence and explanatory potential. It challenges theology to reflect self-critically on contextual commitments, discern systematic complicity, and prevent bad effects”[22].
Dass ein Wissensbereich diesen Practice Turn entdeckt hat, zeigt sich daran, dass die Konstitution des Eigenen in performativen Codes und Praktiken betont wird. Von daher verliert jenes theologische Orientierungswissen an Plausibilität, das (jetzt: nur) auf einer freistehenden Abstraktionsebene gewonnen wurde. Wissen wird nicht mehr methodisch objektiv entdeckt oder transzendental konstruiert, sondern entsteht in performativen Vollzugswirklichkeiten: doing gender, doing culture, doing ritual, doing theology. Saskia Wendel etwa verbindet am Beispiel der Leib-Christi-Metapher transzendentale Ansätze und performative Theorien der Verkörperung mit einer intersektionalen Machtanalyse des Christentums. „Wie alle Körper, so ist auch der Corpus Christi nicht einfach gegeben. Vielmehr werden unterschiedliche Vorstellungen, Bilder und Zeichen des Leibes Christi auf diskursive, näherhin performative, also wirklichkeitssetzende Art und Weise, erzeugt, in unserem Fall im Kontext theologischer Diskurse“[23]. Gender, race und class matters ebenso wie die epochalen Zeichen der Zeit.
Es wird deutlich, dass mit jeder nächsten Herausforderung nicht nur ein neues Problem für das Denken auftritt, sondern dass jedes dieser Probleme zugleich die ontologischen wie epistemologischen und ethischen Grundlagen des Denkens selbst mitverändert. „Nicht hinter der Praxis, also transzendental, ist […] anzusetzen, sondern in ihr“[24], schreibt Armin Nassehi. Die Logik von Praktiken ist jedenfalls mit der Logik sprachlicher Vernunft nicht immer identisch, wie Pierre Bourdieu eine Erkenntnis seines Forscherlebens zusammenfasst: „Die Logik der Praxis […] (ist logisch) bis zu jenem Punkt, an dem Logischsein nicht mehr praktisch wäre.“[25] Die Bedingung der Möglichkeit von Leben und Erkennen wird von den Motiven des Bewusstseins ins Empirische konkret situierter, relationaler Praxisverhältnisse verlagert. Und in dieser Praxis ist nicht nur an der Sprache anzusetzen, sondern an den komplexen, verkörperten Vollzugsformen und Diskursbedingungen in konkreten Situationen, an Interaktionen, Diskursen und Materialitäten. Karen Barad formuliert es so: „Die Überzeugung, daß grammatikalische Kategorien die zugrundeliegende Struktur der Welt widerspiegeln, ist eine durchgängige, verführerische Gewohnheit des Geistes, die in Frage zu stellen sich lohnt.“[26] Barad ist Nachfolgerin auf der Professur von Donna Haraway. Deren einflussreicher Text „Situiertes Wissen“ gilt als Knotenpunkt der Diskussion und steht im Zentrum des nächsten Abschnitts.
3. Situiertes Wissen: Donna Haraway lesen
Katharina Hoppe schreibt in der ersten deutschsprachigen Dissertation zu Haraway, es gebe zum Theorem „Situiertes Wissen“ eine „ritualisierte Zitationspraxis“ im Sinne eines „Aufrufs zur Kontextualisierung und Verortung der eigenen Subjektposition.“[27] Dabei kommen die differenzierte Argumentation wie die epistemologischen Implikationen nur selten ausreichend zur Sprache. Es lohnt sich aber Haraway nicht nur (zustimmend oder ablehnend) zu zitieren, sondern auch zu lesen. Bevor gleich zentrale Aspekte vorgestellt werden, noch ein Blick auf die Autorin[28], schließlich ist Donna Haraway alles andere als ein theologischer Klassiker.[29]
Haraway hat Zoologie, Philosophie und englische Literatur studiert, wurde in Biologie promoviert und hat dann im Feld der Wissenschaftsgeschichte gearbeitet. 1980 übernimmt sie die Professur für Feministische Theorie, Philosophie und Geistesgeschichte an der University of California in Santa Cruz, die erste feministische Denomination in den USA. Damit ist sie Teil des dortigen interdisziplinären Forschungsprogramms „History of Consciousness“, das Natur- und Geisteswissenschaften verbindet. Dieses Denken jenseits der Disziplinen hat sie auch bekannt gemacht, „ihr Postulat einer Situierung des Wissens, die Figur der Cyborg oder ihr berüchtigter Aufruf, sich mit unterschiedlichen Spezies verwandt zu machen, sind aus kultur- und sozialwissenschaftlichen Debatten kaum mehr wegzudenken“[30].
Weniger bekannt ist, dass Haraway in einer irischen Einwandererfamilie sehr katholisch aufgewachsen ist. Im Dokumentarfilm „Storytelling for earthly survival“ erzählt sie: “I grew up in that fascist-Catholic scene in the 1950s in Irish-Catholic Denver. I try to forget them, but the love for stories, I don´t forget. I also think I inherited a strong love of storytelling from growing up Catholic. […] With a profound emersion in the liturgy, in the colors, in the symbols, in the rituals, […] in the dressing up. I wanted to lead a children´s Crusade in the holy land for Christs sake. I know this is really bad, [laughing] however this helps me to remember how deeply rooted Christian culture is in this thing we call the West. And how profoundly islamophobic it is. And that in some way I inherited it, without even knowing that I was inheriting that.”[31]
Für die theologische Tradition gilt Haraway als Provokation: queer-feministisch, post-christlich und post-anthropozentrisch.[32] Es war deshalb eine Überraschung, dass Papst Franziskus in seinem Ökologie-Schreiben „Laudate Deum“ in Fußnote 41 zustimmend auf Haraway verweist: „Gott hat uns mit allen seinen Geschöpfen verbunden“ und auch „das technokratische Paradigma“ dürfe uns nicht „von der Welt um uns herum isolieren und uns darüber hinwegtäuschen, dass die ganze Welt eine ‚Kontaktzone‘ [Haraway] ist“. Deshalb sei auch das Christentum heute dazu „gezwungen zu erkennen, dass man nur von einem ‚situierten Anthropozentrismus‘ sprechen kann. Das heißt, wir müssen anerkennen, dass das menschliche Leben ohne andere Lebewesen nicht verstanden und nicht aufrechterhalten werden kann“.[33]
In der Klimakrise des Planeten müsse sich der Mensch als situiert und eingebettet verstehen, als relationales Wesen. Dass dies auch für Wissensprozesse, Erkenntnistheorie und damit für Wissenschaft gelte, das hat Haraway schon früh beschäftigt. Ihr Text „Situiertes Wissen“ entsteht als Kommentar zu einem Tagungsreferat von Sandra Harding. Harding hat zusammen mit Nancy Hartsock die feministische Standpunkttheorie entwickelt, jene kontextuelle Wissenschaftskritik, mit der sich Haraway selbst wiederum kritisch auseinandersetzt.
Als erstes ist festzuhalten, dass das Thema des Textes gerade nicht Identitätsfragen sind oder das, was heute oft abwertend als Identitätspolitik bezeichnet wird. Ihr Thema ist die Frage nach möglicher Objektivität von Erkenntnis. Allerdings schlägt Haraway eine Umstellung der bisherigen Begriffsarchitektur vor. „Ich argumentiere für Politiken und Epistemologien der Lokalisierung, Positionierung und Situierung, bei denen Partialität […] die Bedingung dafür ist, rationale Ansprüche auf Wissen vernehmbar anzumelden.“[34] Während Situiertheit und Objektivität meist als sich gegenseitig ausschließende Kategorien verstanden wurden, untersucht Haraway deren Verflochtenheit.
Deshalb steht am Beginn auch eine Selbstkritik feministischer Wissenschaft, von der sie vermutet, sie sei quasi von der anderen Seite her jener gerade genannten „verführerischen Dichotomie in die Falle gegangen“[35] Um die Ansprüche naturwissenschaftlich harter Objektivität als androzentrisch, anmaßend und letztlich auch nur auf ein Spiel der Zeichen und sprachlichen Referenzen rückführbar zu kritisieren, habe auch sie früher das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. „Ich und andere begannen unsere Arbeit mit dem Wunsch nach einem starken Instrument zur Dekonstruktion der Wahrheitsansprüche einer feindlichen Wissenschaft, indem wir die radikale historische Spezifizität und damit die Anfechtbarkeit jeder Schicht der zwiebelförmig angeordneten wissenschaftlichen und technologischen Konstruktionen zeigten“[36] Das allein aber war zu wenig. Man musste auch positiv sagen, was eine nicht-androzentrische Wissenschaft ausmacht. Neben der Dekonstruktion entstand ein zweiter Pol an Objektivitätskritik, die feministisch-materialistische Standpunkttheorie. „Feministinnen müssen auf einer besseren Darstellung der Welt beharren“, die „eine adäquatere, reichere, bessere Darstellung einer Welt, in der ein gutes Leben möglich sein soll, anbietet, und […] ein kritisch-reflexives Verhältnis zu […] dem für jede Position konstitutiven, unterschiedlichen Maß an Privilegiertheit und Unterdrückung ermöglicht.“[37]
Haraway ist auf der Suche nach einem „brauchbaren, allerdings nicht unschuldigen Objektivitätsbegriffs“[38]. Das heißt „binäre Oppositionen zu vermeiden“[39], also spannungsreiche Kontraste nicht einseitig aufzulösen, sondern darin zu differenzieren. Drei Aspekte sind hervorzuheben.
Erstens gibt Haraway wissenschaftliche Konzepte wie Objektivität und Universalität eben nicht auf. Sie bezieht sich auf Positionen in Postmoderne und Dekonstruktion, zieht aber gegen den Vorwurf, alles in beliebige Zeichenketten aufzulösen, quasi eine Art realistisches Minimum ein. Es gilt „einer ‚wirklichen‘ Welt die Treue halten, einer Welt, die teilweise miteinander geteilt werden kann“[40]. Gerade der Blick auf die Wissenschaftspraxis aber fordert dann einen anderen und besseren Begriff von Objektivität bzw. Universalität. „Wissenschaft war immer eine Suche nach Übersetzung, Verwandlung, Beweglichkeit und nach Universalität“, und Haraway fügt hinzu, „die ich Reduktionismus nenne, wenn eine Sprache (wessen wohl) als Maßstab für alle Übersetzungen und Verwandlungen aufgezwungen werden muss“[41].
Zweitens könne deshalb Objektivität und Universalismus nicht mehr auf dem Weg einer scheinbar neutralen und machtvergessenen „view from nowhere“ verfolgt werden. Das verbietet die historische Wissenschaftsforschung, die konstitutive Verbindung von Wissen und Macht und die Verkörpertheit jedes „Blicks“. Etwas „objektiv sehen“ wird widersprüchlich, wenn „objektiv“ als allumfassend universal gedacht wird, „sehen“ aber als verkörperte Praktik ohne Standpunkt und Blickrichtung schlicht nicht möglich ist. Haraway spricht vom „göttlichen Trick, alles von nirgendwo aus sehen zu können“[42], was Wissenschaft selbst zu einem mythischen Projekt macht und wenig realistisch sei. Sie besteht deshalb auf einem komplexen standpunkttheoretischen und situierten Minimum epistemischer Gerechtigkeit: „Nur eine partielle Perspektive verspricht einen objektiven Blick. Dieser objektive Blick stellt sich dem Problem der Verantwortlichkeit für die Generativität aller visuellen Praktiken, statt es auszuklammern.“[43]
Das macht drittens einen verantwortlichen Begriff wissenschaftlicher Objektivität zu einem pluralen und spannungsreichen Prozess zwischen Ethik und Epistemologie. Ähnlich einer „Epistemologie der Ränder“[44] schreibt Haraway zunächst: „Die Etablierung der Fähigkeit, von den Peripherien und den Tiefen aus zu sehen, hat Priorität.“[45] Bisher marginalisierte Positionen werden bevorzugt, gerade weil sie ihre Situiertheit nicht so stark mit universalisierender Macht verschleiern konnten und vom hegemonialen Wissenskanon als kontextuell oder partikular, als verkörpert oder feministisch markiert wurden. Weil Körper und Kontext beim Vollzug der Vernunft stören, waren alle mit Körper und Kontext verbundenen Positionen lange abgewertet[46]: Frauen haben Gefühle, Männer haben Verstand; Schwarze Menschen haben Körper, weiße Menschen haben Geist; arme Menschen haben bedauernswerten Kontext, reiche Menschen universalen Weitblick. Nichts davon stimmt, sondern reproduziert diskriminierende Stereotype als erkenntnistheoretische Position.[47] Haraway verkompliziert jetzt aber auch die faktische Gegenreaktion, nämlich situierte Sprecher*innen-Positionen als überlegen anzusehen. Sie macht vielmehr klar, dass die situierte Verortung und Verkörperung von Wissen ebenfalls kein unschuldiger Standpunkt ist, der moralisch per se überlegen wäre. „Im Anspruch, eine Perspektive aus der Position der weniger Mächtigen einzunehmen, liegt […] die ernstzunehmende Gefahr einer Romantisierung und/oder Aneignung dieser Sichtweise. […] Die Standpunkte der Unterworfenen sind keine ‚unschuldigen‘ Positionen.“[48] Standpunkttheorien können problematisch sein, wenn sie marginalisierte Positionen selbst aus der wissenschaftlichen Kritik bzw. Dekonstruktion herausnehmen und essentialisieren. Das heißt, „dass unschuldige ‚Identitätspolitiken‘ und Epistemologien unmöglich Strategien für eine klare Sicht von den Standpunkten der Unterworfenen aus sind.“[49] Haraway bringt den entscheidenden Unterschied auf den Punkt: „Identität, einschließlich Selbstidentität, produziert keine Wissenschaft, kritische Positionierung produziert – ist – Objektivität.“[50]
Damit lässt sich der Argumentationsstand folgendermaßen zusammenfassen:
Was meint Objektivität? Objektivität wird möglich, wenn „die Relevanz von Verortung, Verkörperung und partialer Perspektive“[51] nicht geleugnet wird. Situiertheit ist nicht der Gegner, sondern die Voraussetzung von Objektivität als möglichst umfassende und also multiperspektivische Erfassung von Wirklichkeit. Haraway wendet sich deshalb ausdrücklich gegen identitäre Positionen. „Das Versprechen der Objektivität liegt darin, daß wissenschaftlich Erkennende nicht die Subjektposition der Identität suchen, sondern die der Objektivität, d.h. der partialen Verbindung.“[52] Das bedeutet, Objektivierungspraktiken bestehen nicht im Ausschließen, sondern im Anreichern.
Was verhindert Objektivität? Da ist zunächst das traditionelle Verständnis wissenschaftlicher Objektivität als Totalität des einen überlegenen Blicks von oben: „Die […] Position, von der aus Objektivität unmöglich praktiziert und gewürdigt werden kann, ist der Standpunkt des Herrn, des Mannes, des einen Gottes, dessen Auge alle Differenz produziert, aneignet und lenkt. […] Der göttliche Trick ist selbstidentisch, und wir haben dies fälschlicherweise für Kreativität und Wissen, sogar für Allwissenheit gehalten“[53]. Aber auch die Gegenposition eines epistemologischen Relativismus ist für Haraway nicht viel besser, vor allem, wenn damit die konkrete Situiertheit und deren Machtverhältnisse erneut ausgeblendet werden. „Relativismus ist ein Mittel, nirgendwo zu sein, während man beansprucht, überall in gleicher Weise zu sein. Die ‚Gleichheit‘ der Positionierung leugnet Verantwortlichkeit und verhindert eine kritische Überprüfung.“[54] Haraway unterscheidet deshalb vom epistemischen Relativismus die weiterführende Perspektive der Relationalität. Aus meiner Sicht liegt in deren Gleichsetzung eine Quelle akademischer Scheingefechte, wenn nämlich relationalen Positionen automatisch epistemologischer Relativismus und ethische Defizite unterstellen werden.[55]
Die relationale Position situierten Wissens ist durch diese Aspekte charakterisiert:
Vernünftige Objektivität als Orientierung wissenschaftlichen Arbeitens braucht erstens leidenschaftliche Unvoreingenommenheit (Thomas Kuhn), also die brauchbaren Haltungen der Neugier, der Kritik und der Forschungsfreiheit. Dazu gehört zweitens ein Bewusstsein für die unvermeidliche Positionierung des Blicks. „Positionierung ist daher die entscheidende wissensbegründende Praktik, die wie so viele wissenschaftliche und philosophische Diskurse auch um die Metaphorik der Vision [des Blicks] herum organisiert sind. Positionierung impliziert Verantwortlichkeit für die Praktiken, die uns Macht verleihen.“[56] Und drittens basiert Objektivität nicht auf Einheit und Zentralität, sondern auf Vielfalt und relationalem Verbunden-sein. Voraussetzung ist „eine Vielfalt partialen, verortbaren, kritischen Wissens, das die Möglichkeit von Netzwerken aufrechterhält, die in der Politik Solidarität und in der Epistemologie Diskussionszusammenhang heißen“[57]. Denn das erkennende Subjekt ist weder heroischer Herr der Dinge noch ist es tot. Es „ist in all seinen Gestalten partial und niemals abgeschlossen, ganz, einfach da oder ursprünglich, es ist immer konstruiert und unvollständig zusammengeflickt, und deshalb fähig zur Verbindung mit anderen und zu einer gemeinsamen Sichtweise.“[58]
Dem Theorem „situiertes Wissen“ geht es weder um Identitätspolitik noch um Relativismus, sondern um die Lokalisierung von weltkonstituierenden Relationen: „Unsere Suche nach Partialität ist kein Selbstzweck, sondern handelt von Verbindungen und unerwarteten Eröffnungen, die durch situiertes Wissen möglich werden. Einen spezifischen Ort einzunehmen, ist der einzige Weg zu einer umfangreicheren Position.“[59]
4. Abgleich: Reentry von Situiertheit in analytische Philosophie und Theologie
Wie angekündigt werden nun die Aspekte von Thomas Schärtl und Benedikt Göcke vom Beginn noch einmal aufgenommen und kritisch diskutiert.
Die eingangs dritte Aussage lautete, mit dem Theorem „situiertes Wissen“ werde das Ideal wissenschaftlicher Objektivität aufgegeben, indem es durch erstpersönliche, subjektive Erfahrung und kulturelle Identitätspolitik ersetzt wird. Haraway hat über solche Interpretationen, die leider auch Anhalt in manch tatsächlicher Verwendung haben, einmal gesagt: „Manchmal lesen Leute ‚Situiertes Wissen‘ in einer Weise, die mir ein bisschen flach vorkommt; im Sinne von dem Ausweis, was identifizierende Markierungen von jemandem sind und wörtlich, wo jemand ist. ‚Situiert‘ in diesem Sinne bedeutet nur an einem Ort sein.“[60] Um die drei wichtigsten Differenzierungen noch einmal deutlich zu machen: Situiertes Wissen ermöglicht erstens in der Tat die epistemische Offenheit für marginalisierte Erfahrungen und soziale Ungerechtigkeit. Es geht dabei zweitens nicht um eine identitäre Abbildung rein subjektiver Erfahrungen, sondern um deren komplexe Diskursivierung, um die Möglichkeiten und um die Schwierigkeiten dabei, denn „nicht jede partiale Perspektive ist brauchbar.“[61] Situiertes Wissen ist drittens nicht das Andere, sondern ein Bestandteil der wissenschaftlich verantworteten Suche nach validen Wissensbeständen.
Schärtl und Göcke kritisieren diese Position als fragwürdige Politisierung wissenschaftlicher Neutralität. Beide haben ihr Verständnis Analytischer Theologie in der Antwort auf Bauers Frage nach den gesellschafts- und kirchenpolitischen Implikationen, als liberales und am Freiheitsbegriff orientiertes Unternehmen positioniert. Liberale Positionen interessieren sich zwar auch für Ungerechtigkeiten, halten aber zugleich eine unparteiliche und vom Situativen abstrahierte Beurteilung für notwendig, um Willkür auszuschließen. Jüngere Diskussionsbeiträge versuchen diesen scharfen Gegensatz von Liberalismus und einer situierten Epistemologie der Ungerechtigkeit allerdings zu entdramatisieren. Katharina Kauffmann argumentiert in ihrem gleichnamigen Text, „eine liberale Gesellschaft [ist] darauf angewiesen, dass sozial konstruiertes Wissen im Diskurs geteilt wird, da sonst Ungerechtigkeiten nicht erkannt, kritisiert und beseitigt werden können“[62].
Damit sind wir bei den anderen beiden Aussagen vom Beginn: Die tradierte Wissenschaftspraxis müsse sich mit der eigenen Kontextualität und Perspektivität konfrontieren lassen. Das Theorem „situiertes Wissen“ enthält eine Kritik an tradierter westlicher Wissenschaftspraxis, indem diese mit Kategorien wie „eurozentrisch oder rassistisch“ in Verbindung gebracht werden.
Die bisher verwendete Differenz Analytische vs. Kontinentale Philosophie lässt sich von der praktisch-theologischen Diskussion her auf etwas andere Weise beschreiben. Analytische Theologie folgt in ihrer Selbstwahrnehmung der sprachanalytischen Vernunft und versucht um des „wissenschaftlichen Ideal objektiver Erkenntnis“ Willen eine „neutrale Position“ ohne soziale Situiertheit, „in der immer nur das Argument zählt – und nicht primär die Autorität, die das Argument formuliert, oder die Epoche und Kultur, aus der es stammt“[63].
Mit der Unterscheidungstheorie des britischen Mathematikers George Spencer Brown[64] lässt sich das in eine Unterscheidungsform bringen: draw a distincion. Die freistehende objektive Vernunft analytischer Rationalität wird von einer Umwelt abgegrenzt, in der es Unbestimmtes anderes gibt, auf das sie sich bezieht.
In der von Christian Bauer ausgelösten Diskussion wird diese unbestimmte andere Seite nun markiert, nämlich als „jene Partei, die sich auf angewandt-kritische oder postmodern-politische Theorien beruft und jede Position auf kulturelle, gesellschaftliche, identitätsprägende Strukturen, Diskurse oder Dispositive zurückführt“ [65], kurz: auf Lebenswelt oder Situativität. Mit George Spencer Brown lässt sich das in die Unterscheidungsform Objektive Vernunft | Soziale Situiertheit bringen.
Dirk Baecker erläutert, „dass Spencer-Browns so genanntes mark of distincion oder auch cross die für das westliche Denken höchst ungewohnte Aufforderung enthält, einen Unterschied als einen Zusammenhang zu lesen“[66].
Das ist ein wichtiger Hinweis. Wie andere feministische, postkoloniale oder neu-materialistische Theorien bringt Donna Haraway diese Unterscheidung durcheinander, bezieht soziale Situiertheit in rationale Begründungen mit ein und verbindet dabei Erkenntnistheorie mit Ethik. Wenn ich es recht verstehe, operiert die von analytischer Religionsphilosophie inspirierte Analytische Theologie aber mit dieser Unterscheidung als kategoriale Trennung, um kontingente Faktoren bei der Entwicklung neuer metaphysischer Positionen herunterdimmen zu können.
Dass gerade dabei erkenntnistheoretische wie ethische Lücken entstehen, das haben Sally Haslanger[67] und vor allem Miranda Fricker mit dem Konzept epistemischer Ungerechtigkeit herausgearbeitet.[68] Fricker ist eine angelsächsische Philosophin, die mit analytischem Denken vertraut ist. Sie versteht sich zugleich als kritisch-feministische Theoretikerin. Fricker ergänzt gängige Gerechtigkeitstheorien um die Analyse „epistemischer Ungerechtigkeit“, was sie an zwei Aspekten konkretisiert. Wenn einer Person nur deshalb weniger Glaubwürdigkeit entgegengebracht wird, weil sie als Frau oder Person of Color identifiziert wird (im Fachgespräch, bei einer Polizeikontrolle), dann handelt es sich um Zeugnisungerechtigkeit: Dann zählt für die epistemische Qualität einer Aussage gerade nicht das Argument, sondern bestimmte soziale Humankategorisierungen[69]. Davon unterscheidet Fricker hermeneutische Ungerechtigkeit, wenn nämlich für eine faktische Ungerechtigkeit (noch) gar keine ausreichenden begrifflichen Mittel zur Verfügung stehen. Erst als die Bezeichnung „sexuelle Belästigung“ im öffentlichen Gebrauch zur Verfügung stand, konnte sexistische Diskriminierung auch als solche benannt und ethisch kritisiert werden. „Man könnte sagen, dass Zeugnisungerechtigkeit durch Vorurteile in der Ökonomie der Glaubwürdigkeit entsteht, während hermeneutische Ungerechtigkeit aus strukturellen Vorurteilen in der Ökonomie kollektiver Deutungsmöglichkeiten resultiert.“[70]
Für das Thema dieses Beitrags ist jetzt die genauere Argumentation bei Fricker von Bedeutung. Um ihr Konzept zu entwickeln, grenzt sie sich von zwei Positionen ab, vom analytischen Mainstream und von einer überdehnten Postmoderne. „In der anglo-amerikanischen Erkenntnistheorie kommen […] bestimmte Überlegungen schlicht nicht vor – beispielsweise die, dass epistemisches Vertrauen untrennbar mit sozialer Macht verbunden sein könnte oder dass soziale Benachteiligung zu einer epistemischen Benachteiligung führen kann, die ungerecht ist. […] Ihr fehlt ein theoretischer Rahmen, der die ethischen und politischen Aspekte unseres wissensbezogenen Verhaltens aufzeigt.“[71] Womöglich spiele dabei auch „der theoretische Rahmen von Individualismus und obligatorischer Idealisierung der Vernunft“[72] eine Rolle. Genauso problematisch aber sei eine reduktionistische Postmoderne, die ins Esoterische oder rein Aktivistische abgleitet. „Das Misstrauen gegenüber der Kategorie der Vernunft als solcher und die Tendenz, sie auf eine Machtfunktion zu reduzieren, verhindern […] genau die Fragen, die wir stellen müssen, um herauszufinden, wie sich Macht auf uns als vernunftbegabte Wesen auswirkt.“[73]
Wie ginge es anders? Dazu verlässt Fricker die beide kategorialen Unterscheidungen sprachanalytische Vernunft | soziale Situiertheit wie auch Erkenntnistheorie | Ethik[74]. Ihre Theorie epistemischer Ungerechtigkeit entsteht mit ausdrücklichem Bezug auf Donna Haraway als davon abweichende Lösung, nämlich „dass wir die Thematisierung moralischer Fragen mit der sozial situierten Darstellung unserer epistemischen Praktiken verbinden. Eine sozial situierte Darstellung einer menschlichen Verhaltensweise ist eine Darstellung, bei der die Beteiligten nicht losgelöst von gesellschaftlichen Machtverhältnissen gedacht werden […].“[75]
Damit schließt sich der Kreis, oder epistemologisch mit Spencer-Brown genauer, es kommt zu einem Reentry, einem Wiedereintritt der Unterscheidung in das durch sie Unterschiedene.[76] Sozial situierte Machtverhältnisse sind nicht die andere Seite einer vernünftigen Suche nach rationalen Gründen, sie sind ein Teil davon und müssen in philosophischen Begründungen selbst mit beachtet werden. Deshalb schreibt Fricker, „vor dem Hintergrund der herkömmlichen Einteilung der Philosophie ist dieses Buch weder ein Werk der Ethik noch ein Werk der Erkenntnistheorie; vielmehr verhandelt es einen Grenzbereich zwischen diesen beiden philosophischen Gebieten“[77].
Fricker behandelt die Unterscheidung von Erkenntnistheorie (Objektive Vernunft) und Ethik (Soziale Situiertheit) also erstens als differenzierten Zusammenhang mit kreativer Komponente. Durch den Reentry beginnt die Unterscheidung zu oszillieren. Es entsteht ein Grenzbereich, in dem Ethik und Erkenntnis miteinander hergestellt werden, weil das jeweils andere im Eigenen vorkommt, ohne darin aufzugehen. Dass Fricker dabei konkret situierte Praxisbeispiele aus Literatur und Gesellschaft aufruft, ist konsequent, weil sich daran zeigen lässt, wie die Probleme quasi abduktiv bearbeitet werden.[78]
Dirk Baeker meint, diese Schreibweise eines Hakens „setze sich aus dem horizontalen Strich als dem Zeichen für die Negation () und dem vertikalen Sheffer Stroke | als Zeichen für neither-nor, weder-noch, zusammen“[79]. Fricker scheint bei ihrer Suche nach einem besseren Verhältnis von Vernunft und Situiertheit zweitens auf eine solche Logik des weder – noch zurückzugreifen (weder Ethik, noch Erkenntnistheorie). Im theologischen Kontext ist es relevant, dass sich diese Denkfigur des weder – noch auch bei einem christlichen Denker wie Michel de Certeau findet. Christian Bauer weist beständig darauf hin, dass heute weder die binäre Unterscheidung entweder – oder, noch das postmoderne sowohl – als auch weiterführend sind, sondern ein weder – noch, „dessen doppelte Verneinung den christlichen Gottesdiskurs dauerhaft offen hält“[80].
Diese vielleicht etwas theoretisch anmutenden Überlegungen haben unmittelbare handlungsermöglichende Konsequenzen für Kirche und christliches Leben. Im einen Fall geht es darum, die rationale Begründung des Gottesbegriffs und seiner Eigenschaften metaphysisch möglich zu machen, und dann zu sehen, was für Folgen sich daraus ableiten lassen. Im anderen Fall ist die Begründung des Gottesbegriffs jenseits der sozialen Situiertheit seiner Verwendung und der dabei bedeutungsrelevanten Machtverhältnisse grundlegend unvollständig und Ausdruck einer „willful hermeneutical ignorance“[81], die es zu vermeiden gilt.
Um es konkreter zu machen: Was haben die profanen Probleme rassistischer Diskriminierungen oder sexistischer Ungerechtigkeiten überhaupt mit Gott und Theologie zu tun? Handelt es sich nicht einfach um ethische Fragen, die mit ethischen Reflexionstheorien bearbeitet werden und Theologie dort höchstens säkular hineinübersetzt oder in Form eines exotischen religiösen Arguments vertreten werden könne? Um theologische Argumente überhaupt anschlussfähig zu machen, so die erste Position, müssten vor allem das Wesen und die Eigenschaften Gottes als rationales Argument plausibilisiert werden. Entsprechend hatte sich die analytisch-theologische Forschung in ihren Drittmittelprojekten vor allem auf „die Philosophie des Bewusstseins und die Theologie des göttlichen Wissens, die Eigenschaften Gottes und alternative Gottesbegriffe“[82] konzentriert.
Von der Argumentation dieses Textes her sieht die Lage ein wenig anders aus. Haraway und mit ihr das dynamische Feld relationaler Ontologien plädieren für eine grundsätzliche Verflochtenheit von ontologischen, epistemologischen und ethischen Fragen. Haraways Nachfolgerin Karen Barad nennt ihren Ansatz Agentiellen Realismus, weil die Wirklichkeit in materiell-diskursiven Unterscheidungspraktiken performativ immer wieder neu hergestellt wird. Sie spricht von „Onto-epistemo-logie“ als „Ernstnehmen der Verflechtung von Ethik, Erkenntnis und Sein“[83]. Erkenntnis besteht darin, „dass ein Teil der Welt sich einem anderen Teil zu erkennen gibt. Erkenntnis- und Seinspraktiken sind nicht voneinander zu trennen, sie implizieren sich wechselseitig. Wir gewinnen keine Erkenntnis dadurch, daß wir außerhalb der Welt stehen; wir erkennen, weil wir zur Welt gehören. Wir sind Teil der Welt in ihrem je unterschiedlichen Werden. Die Trennung der Erkenntnistheorie von der Ontologie ist ein Nachhall einer Metaphysik, die einen wesentlichen Unterschied zwischen Mensch und Nicht-Mensch, Subjekt und Objekt, Geist und Körper, Materie und Diskurs annimmt.“[84] Und genau das wird angesichts von Klimakrise und digitaler Technologien heute problematisiert.
Theologisch ist das deswegen produktiv, weil damit wesentliche Basisaussagen der christlichen Gottestradition auf neue Weise reformuliert werden könnten. Dazu gehört die zentrale theologische Erkenntnis, dass sich Gott und Gerechtigkeit, dass sich Gottes- und Nächstenliebe zueinander nicht wie die kategoriale Trennung von Erkenntnistheorie und Ethik verhalten, sondern im Sinne einer performativen Verschränkung immer schon miteinander verflochten gemeinsam hergestellt werden. Ein solcher Ansatz performativer Verflechtungen ist aktuell nicht nur in historischen Forschungen äußerst relevant[85], sondern hat in der praktischen Fundamentaltheologie von Johann B. Metz und Helmut Peukert, in feministischer Theologie und theologischer Genderforschung oder in befreienden und postkolonialen Theologien zu jenem Practical Turn geführt, wie er weiter oben skizziert wurde.
Dies scheint mir auch die Arbeit von Miranda Fricker zu dokumentieren, die praktische Ungerechtigkeitserfahrungen auf ihre epistemischen Anteile hin befragt. Aus meiner Perspektive geht das über eine Einschätzung als Anwendung analytischer Philosophie weit hinaus, weil der ganze Theorierahmen damit verschoben und etwa Foucaults Machtanalyse als Teil des Diskurses behandelt wird. Womöglich wäre dann Frickers Arbeit aus theologischer Perspektive näher an einer Analyse der Eigenschaften Gottes als manche neuere religionsphilosophische Abhandlung zu einer sich auf Gott berufenden Einheitsmetaphysik.
5. Ausblick: Postkoloniale Situiertheit deutschsprachiger Theologie
Wer internationale Diskussionen wahrnimmt, kann den eingangs angesprochenen post- und dekolonialen Fragestellungen nur schwer ausweichen. Zu offensichtlich ist, wie sehr die Gegenwart von den anhaltenden Folgen des kolonialen Zeitalters geprägt ist, von der Grenzziehung der Nationalstaaten im globalen Süden über die Idee von Weltreligionen als abgrenzbare Container des Glaubens bis zum Streit um den Wissenschaftsbegriff der Aufklärung. Historische und zeitgenössische Studien erforschen die unglaublich komplexe Verflochtenheit bisher kategorial und regional getrennter Bereiche.
Wenn Graham Ward in Stellenbosch sagt, Deutschland sei nicht mehr das Powerhause der Theologie, ist die Herausforderung für die Standards deutschsprachiger Theologie auf den Punkt gebracht. Judith Gruber hat in einem viel zitiertem Aufsatz die Reaktionen von freundlicher Ignoranz bis zu vehementen Abwehrhaltungen beschrieben. Bis zu dem Rat von Kollegen, sich nach dem „Randthema“ ihrer Dissertation zu interkultureller und postkolonialer Theologie „nun wirklich einem Kernthema der Theologie“[86] zuzuwenden. Aber wo ist der Rand und wo ist die Mitte? Und warum wird die theologische Landschaft immer noch in Zentralarchitekturen[87] konzentrischer Kreise gedacht?
Dipesh Chakrabartys glückliche Wendung „Provincializing Europe“ meint in der Tat, dass auch Aufklärung und westliches Denken aus „situiertem Wissen“ entstanden sind. Nikita Dhawan hat das noch einmal zugespitzt mit der Bemerkung, postkoloniales Denken im Süden versuche die Aufklärung vor den Europäern zu retten.[88] Das Archiv Europas gehört nicht mehr „uns“ allein. Auch Denkern wie Achille Mbembe geht es um die „Herstellung universeller Gerechtigkeit“[89], aber indem die großen Ansprüche auf ihre praktische Wirklichkeit hin überprüft werden.[90] Und dann sieht man eben das eurozentrische und auch rassistische Erbe westlichen Denkens, das in die besten Texte und Argumentationen eingeflochten ist, auch in den Theologien.
Es war die Schlusspointe in meinem kleinen Text zur Bauer/Schärtl-Kontroverse[91], dass das kommende theologische Grundsatzwerk vielleicht gerade von einer Gruppe Frauen aus dem globalen Süden verfasst werde. Kurz danach schrieb Armin Nassehi im Kursbuch September 2022 zum Thema „Der Westen“: „Vielleicht liegt der ‚Westen‘ in Saint Louis, Saint Louis im Senegal. Zumindest hatte ich dieses Gefühl, als ich das Buch Afrotopia von Felwine Sarr gelesen habe, einem senegalesischen Schriftsteller und Ökonomen.“[92] Das sei weder neokolonial oder romantisierend gemeint, so Nassehi: „Ich will nur demonstrieren, dass eine Kritik an der westlichen Moderne an ähnlichen Kategorien ansetzen kann und seine Kriterien nicht einfach aus dem Gegen und einer Alternative formuliert, sondern empirisch an den Gegebenheiten ansetzt. Sarr setzt offensiv auf Pluralität und Perspektivendifferenz – und das könnte womöglich das Vehikel sein, das weltgesellschaftlich jene Form ausmacht, die man dann womöglich nur noch behelfsweise westlich nennen könnte“.[93]
Dem sollten sich auch die Grundlagendiskurse der verschiedenen theologischen Disziplinen im Kontext Europas stellen. Dekolonisierung bedeutet dann mit Kristin Merle eine Überschreitung der „konventionellen Regeln monokulturellen Wissenserwerbs, wenn aus der Umstellung auf partizipativen Wissenserwerb Allianzen entstehen, mithilfe derer auch noch einmal geklärt werden kann, wozu welcher Wissenserwerb dient“[94]. Auch deutschsprachige und europäische Theologie entsteht eben als situiertes Wissen.
_____
Autor: Michael Schüßler ist Professor für Praktische Theologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen und im Redaktions-Team von feinschwarz.net. Neu erschienen ist sein Sachbuch „Es kommt was ins Rutschen. Eine theologische Reise an die Kipppunkte der Gegenwart“ im Grünewald-Verlag. [ORCID: 0009-0009-2061-3027 | GND (131704796)] Eine Online-Übersicht der Veröffentlichungen auch mit Open Acess Texten findet sich hier: https://ixtheo.de/AuthorityRecord/512981590.
_____
[1] Hans-Joachim Höhn / Saskia Wendel / Gregor Reimann / Julian Tappen (Hg.), Analytische und Kontinentale Theologie im Dialog (QD 314), Freiburg/Brsg. 2021.
[2] Christian Bauer, Allianzen im Widerstreit? Zur Internationalität deutschsprachiger Theologie zwischen analytischer und kontinentaler Theologie, in: ThRev 118 (2022), 1-22.
[3] Die Beiträge werden in einer der nächsten Ausgaben der Münchener Theologischen Zeitschrift dokumentiert, auch eine überarbeitete Fassung dieses Textes.
[4] Bauer, Allianzen, 2-3.
[5] Ebd., 2.
[6] Thomas Schärtl / Benedikt Göcke, Unter Verdacht. Zum Streit um die Analytische Theologie, in: Herder Korrespondenz 76 (2022), H. 10, 47-50, 50.
[7] Schärtl / Göcke, Unter Verdacht, 50.
[8] Vgl. Shirley Anne Tate, Encarnación Gutiérrez Rodríguez (Hg.), The Palgrave Handbook of Critical Race and Gender, London 2022, online: https://doi.org/10.1007/978-3-030-83947-5.
[9] Bauer, Allianzen, 2.
[10] Graham Ward, Decolonizing Theology, in: Stellenbosch Theological Journal 2017 (3), 561-584, 569.
[11] Christian Bauer / Michael Schüßler, Practical Turn der Systematischen Theologie? Konzilstheologische Erkundungen und praxistheoretische Beobachtungen, in: ThQ 203 (2023), H. 4, 342-357.
[12] Ich danke Thomas Wabel für die Erinnerung an diesen Text bei einer Konferenz zu den Grenzen des Menschlichen in der Pflege.
[13] Matthias Jung, Gründe als Rechtfertigung – verkörpert, eingebettet und freistehend, in: ders. u.a. (Hg.), Dem Körper eingeschrieben. Studien zur interdisziplinären Anthropologie, Wiesbaden 2016, 125-141, 127.
[14] Jung, Gründe, 128.
[15] Ebd., 140.
[16] Ottmar Fuchs, Wie verändert sich universitäre Praktische Theologie, wenn sie kontextuell wird? In: Pastoraltheologische Informationen (ZPTh) 18 (1998), 115-150, 116.
[17] Vgl. dazu Bauer / Schüßler, Practical Turn, 342-357.
[18] Gregor Maria Hoff / Hans-Joachim Sander, Vorwort zur Reihe, in: Hans-Joachim Sander, Glaubensräume. Topologische Dogmatik, Band 1: Glaubensräumen nachgehen. Ostfildern 2019, 9–14, 10.
[19] Gregor Maria Hoff, Performative Theologie. Studien zur fundamentaltheologischen Theoriebildung. Stuttgart 2022, 18.
[20] Artur R. Boelderl (Hg.), Welt der Abgründe. Zur George Bataille, Wien 2015.
[21] Judith Gruber, Der Cultural turn als erkenntnistheoretischer Paradigmenwechsel. Theologische Stellprobe in einer epistemologischen Rekartographierung, in: dies. (Hg.), Theologie im Cultural Turn. Erkenntnistheologische Erkundungen in einem veränderten Paradigma, Frankfurt/M. 2013, 21-44, 38.
[22] Hanna Reichel, After Method. Queer Grace, Conceptual Design, and the Possibility of Theology, Louisville 2023, 40.
[23] Saskia Wendel, Die „Leib Christi Metapher“. Kritik und Rekonstruktion aus gender-theoretischer Perspektive, Bielefeld 2023, 10.
[24] Armin Nasssehi, Der soziologische Diskurs der Moderne, Frankfurt/M. 2006, 229.
[25] Bourdieu, zitiert nach Pierre Bourdieu; Loic J. D. Wacquant, Reflexive Anthropologie, Frankfurt/M. 32013, 44.
[26] Karen Barad, Agentieller Realismus, Berlin 22017, 8. Vgl. zu Barad die bald erscheinende und deutschsprachig diskurseröffnende Habilitation von Franca Spieß, Das Materielle in Schöpfung und Inkarnation. Theologische Erkundungen im Dialog mit Karen Barads Agentiellem Realismus, Bielefeld 2025, sowie das praktisch-theologische Dissertationsprojekt von Lucas Gaa zu Theologie und Materialität bei Bruno Latour und Karen Barad.
[27] Katharina Hoppe, Die Kraft der Revision. Epistemologie, Politik und Ethik bei Donna Haraway, Frankfurt/M 2021, 18.
[28] Vgl. Katharina Hoppe, Donna Haraway zur Einführung, Hamburg 2022.
[29] Vgl. etwa Simon Reiners, Donna Haraway – Unruhig bleiben in turbulenten Zeiten, in: feinschwarz.net vom 6.9.2024, online: https://www.feinschwarz.net/donna-haraway-unruhig-bleiben-in-turbulenten-zeiten/.
[30] Hoppe, Donna Haraway, 9.
[31] Fabrizion Terranova, Storytelling for earthly survival, DVD 2017, ab 8:28. Siehe auch: https://earthlysurvival.org/. Ich danke Ursula Offenberger für den Hinweis auf den Film – und das Ausleihen der DVD.
[32] Für eine frühe feministische und praktisch-theologische Rezeption vgl. Elaine Graham, Transforming Practice. Pastoral Theology in an Age of Uncertainty, Eugene 1996, 156-162. Eine differenzierte aktuelle Diskussion mit subjektphilosophischer Theologie am Beispiel Saskia Wendels findet sich in Caroline Helmus, Subjektphilosophie im Gespräch mit Cyborgs und Hunden, in: Martin Breul / Mirja Kutzer / Julian Tappen (Hg.), Menschen. Glauben. Gott. Zur philosophischen Theologie Saskia Wendels, Freiburg/Brsg. 2024, 211-231.
[33] Alle Zitate Papst Franziskus, Laudate Deum, Nr. 67; 68. Eine erhellende Vergleichsanalyse bietet Simon Reiners, Begegnungen im Anthropozän. Donna Haraways und Papst Franziskus´ Sorge für einen beschädigten Planeten, Frankfurt/M. 2021 (Frankfurter Arbeitspapiere zur gesellschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Forschung), online: https://nbi.sankt-georgen.de/assets/documents/fagsf_79.pdf.
[34] Donna Haraway, Situiertes Wissen. Die Wissenschaftsfrage im Feminismus und das Privileg einer partialen Perspektive, in: dies., Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen, Frankfurt / New York 1995, 73-97, 89.
[35] Haraway, Situiertes Wissen, 74.
[36] Ebd., 77.
[37] Ebd., 78.
[39] Ebd., 80.
[40] Ebd., 78.
[41] Ebd., 79.
[42] Ebd., 81.
[43] Ebd., 82.
[44] So der Titel des zugrundeliegenden Workshops.
[45] Haraway, Situiertes Wissen, 83.
[46] „Beim Versuch der Reflexion über den Körper stößt man auf eine Eigentümlichkeit: Nicht nur für diese spezifische, sondern für jede wissenschaftliche Reflexion scheint der Körper selbst, unser Erkenntnisobjekt, als Störgröße für das erkennende Subjekt zu fungieren. Der Körper stört beim Denken“, Regina Ammicht-Quinn, Körper – Religion – Sexualität. Theologische Reflexion zur Ethik der Geschlechter, Mainz 1999, 40, sowie anschließend 40-57.
[47] Vgl. zum Verhältnis von Aufklärung und kolonialem Rassismus jetzt Nikita Dhawan, Die Aufklärung vor Europa retten. Kritische Theorien der Dekolonisierung, Frankfurt/M 2024. Zur Kritik und Diskussion von rassistisch-kolonialen Stereotypen bei Kant vgl. Dhawan 58-84, sowie Margit Wasmeier-Sailer in diesem Heft.
[48] Haraway, Situiertes Wissen, 83.
[49] Ebd., 85.
[50] Ebd., 87.
[51] Ebd., 84.
[52] Haraway, Situiertes Wissen, 86.
[53] Ebd., 87.
[54] Ebd., 84.
[55] Vgl. Michael Schüßler, Verflüssigung der Zeit – Verflüssigung der Wahrheit? Relationale Theologie des Ereignisses in digitaler Gegenwart, in: Michael Seewald (Hg.), Glauben ohne Wahrheit? Die Theologie und der Relativismus, Freiburg/Brsg 2018, 159-177.
[56] Haraway, Situiertes Wissen, 87.
[57] Ebd., 84.
[58] Ebd., 86.
[59] Haraway, Situiertes Wissen, 91.
[60] Hoppe, Donna Haraway, 37.
[61] Haraway, Situiertes Wissen, 85.
[62] Katharina Kaufmann, Liberalismus und die situierte Epistemologie der Ungerechtigkeit, in: Zeitschrift für Praktische Philosophie 9 (2022), H. 1, 201-224, 211, online: https://doi.org/10.22613/zfpp/8.2.4. Siehe dazu auch Briana Toole, Demarginalizing Standpoint Epistemology, in: Episteme 19 (2022), 47-65, online: https://doi.org/10.1017/epi.2020.8.
[63] Schärtl / Göcke, Unter Verdacht, 50.
[64] Ich beziehe mich auf die Rezeption von Spencer-Brown durch Dirk Baecker, Beobachter unter sich. Eine Kulturtheorie, Berlin 2013. Siehe für eine pastoraltheologische Rezeption die bald erscheinende Dissertation von Susanne Tepel, Logik trifft Logos. Die Mathematik von George Spencer-Brown als Inspiration für die „Form“ einer Pastoral in der nächsten Gesellschaft, Tübingen 2025 (Diss).
[65] Schärtl / Göcke, Unter Verdacht (wie Anm. 5), 50.
[66] Dirk Baecker, Ein neues Zeichen, in: ders., Wozu Theorie? Berlin 2017, 242-256, 243.
[67] Sally Haslanger, Der Wirklichkeit widerstehen, Berlin 2021. Haslanger schreibt, sie habe zunächst analytische Metaphysik studiert, später eine feministische Lesegruppe organisiert und mit den Werkzeugen der Vernunft und Rationalität an einer angemessenen Theorie sozialer Gerechtigkeit gearbeitet (S. 7-8). In neueren Texten geht es ihr um „ein praxisorientiertes und materialistisches Verständnis der sozialen Welt“ im Wissen, dass „Gesellschaften komplexe dynamische Systeme sind“ (S. 15). Der in diesem Text gebrauchte Formenkalkül von Spencer-Brown (Unterscheidung und Reentry) ist übrigens eine Inspirationsquelle selbstorganisierter, nicht-linearer Systeme, was bei Haslanger (ähnlich etwa zur Performativität bei Barad) die Wirklichkeit als „kausale Rückkopplungs- oder sogenannte ‚Looping‘-Effekte zwischen menschlichem Denken/Sprache und der materiellen Welt“ (S. 11) erscheinen lässt.
[68] Vgl. zum Folgenden auch die ganz ähnlich gelagerte Rezeption bei Kristin Merle, Wissenserwerb durch Regelbruch, in: dies. / Manuel Stetter / Katharina Krause (Hg.), Prekäres Wissen. Praktische Theologie im Horizont postkolonialer Theorien. Festschrift für Birgit Weyel, Leipzig 2024, 17-35.
[69] Zu diesem Begriff vgl. Stefan Hirschauer (Hg.), Un/doing Differences. Praktiken der Humandifferenzierung, Weilerswist 2017.
[70] Miranda Fricker, Epistemische Ungerechtigkeit. Macht und die Ethik des Wissens München 2023, 24.
[71] Fricker, Epistemische Ungerechtigkeit, 24.
[72] Ebd., 24.
[73] Fricker, Epistemische Ungerechtigkeit, 25.
[74] Das Wort Ethik meint hier primär Fragen der Gerechtigkeit und schließt die im liberalen Diskurs manchmal separat behandelte politische Strukturethik mit ein.
[75] Fricker, Epistemische Ungerechtigkeit, 26.
[76] Vgl. Baecker, Beobachter, 42-64.
[77] Fricker, Epistemische Ungerechtigkeit, 25.
[78] Der Reentry als Wiedereintritt einer Unterscheidung in das durch sie Unterschiedene folgt nicht der Logik „der Deduktion und Induktion, sondern, mit Charles Sanders Peirce gesprochen, der Abduktion. Sie müssen die Unterscheidung ihrerseits kreuzen, mit Leerstellen arbeiten, neue Unterscheidungen treffen und sie in den Raum der Unterscheidung einführen. Das geht nur kreativ, muss sich allerdings mit jedem Sprung darauf verlassen, anschließend überprüfen und nachweisen können, welchen Möglichkeitsbedingungen der Sprung genügte“, Baecker, Beobachter, 52-53. Das gilt wohl auch, so die These hier, für den Wiedereintritt der sozialen Wirklichkeit in eine ehemals freistehende Epistemologie. Ähnliches findet sich bei Alfred North Whitehead. Der Mathematiker und mit Bertrand Russell Co-Autor von „Principia Mathematica“ spricht vom „Trugschluß der unzutreffenden Konkretheit […], wenn man ein wirkliches Einzelwesen bloß insoweit betrachtet, als es bestimmte Denkkategorien exemplifiziert. […] Die Verifizierung eines rationalistischen Schemas muss in seinem allgemeinen Gelingen angestrebt werden und nicht in der besonderen Sicherheit oder sofortigen Klarheit der Grundprinzipien“ (A. N. Whitehead, Prozess und Realität. Entwurf einer Kosmologie, 9. Aufl. Frankfurt/M. 2021, 39; 40).
[79] Baecker, Neues Zeichen, 243.
[80] Bauer, Allianzen, 20.
[81] Gaile Pohlhaus, zitiert nach Kaufmann, Liberalismus.
[82] Schärtl / Göcke, Unter Verdacht, 47.
[83] Barad, Agentieller Realismus, 100; 101.
[84] Barad, Agentieller Realismus, 100.
[85] Vgl. etwa Linda Ratschiller / Karolin Wetjen (Hg.), Verflochtene Mission. Perspektiven auf eine neue Missionsgeschichte, Köln–Weimar 2018.
[86] Judith Gruber, Wider die Entinnerung. Zur postkolonialen Kritik hegemonialer Wissenspolitiken in der Theologie, in: Andreas Nehring / Simon Wiesgickl (Hg.), Postkoloniale Theologien II. Perspektiven aus dem deutschsprachigen Raum, Stuttgart 2018, 23-37, 23.
[87] Den Begriff entlehne ich der bald erscheinenden Habilitationsschrift von Andree Burke, Agent:innen des Unmöglichen. Entdeckungen kreativer Potenziale für ein kirchliches Personalmanagement im Wandel der Dispositive des Erwerbslebens, Tübingen 2023 (unveröff. Manusk.)
[88] Nikita Dhawan, Die Aufklärung vor Europa retten. Kritische Theorien der Dekolonisierung, Frankfurt/M. 2024.
[89] Achille Mbembe, Kritik der schwarzen Vernunft, Berlin 22018, 330.
[90] Vgl. dazu Jule Govrin, Universalität von unten. Eine Theorie radikaler Gleichheit, Berlin 2025.
[91] Michael Schüßler, Essay zur Kontroverse Bauer-Schärtl / Remenyi um die analytische Theologie, online: https://www.theologie-und-kirche.de/schuessler-essay.pdf.
[92] Armin Nassehi, Wo liegt der Westen? Eine Standortbestimmung in unübersichtlicher Zeit, in: Kursbuch 211 (September 2022), 97-120, 116.
[93] Nassehi, Wo liegt der Westen, 117.
[94] Merle, Wissenserwerb, 34.