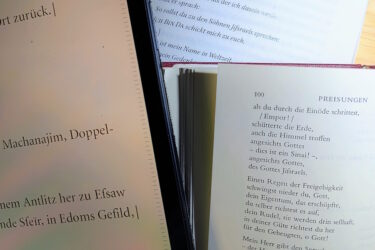Der israelische Schriftsteller und lange an der Universität Be’er Sheva lehrende Professor Aharon Appelfeld (1932-2018) schrieb 46 Bücher, geprägt von seiner früheren Herkunft aus Czernowitz (Bukowina). Lukas Pallitsch (Wien) spürt zentralen Aspekten in seinem Werk nach.
Aharon Appelfeld gehört zu den hierzulande viel zu wenig bekannten und folglich auch zu wenig rezipierten Stimmen israelischer Dichtung, die dem Grauen der Schoa nur knapp entronnen sind. Wie andere namhafte Schriftsteller stammte er aus der Bukowina, wo einst die Hälfte der Einwohner jüdisch war, und reifte in einem Elternhaus heran, das nur lose Verbindung zur jüdischen Tradition hielt und deshalb zum assimilierten Judentum gehörte.[1]
Seine Poetik lässt sich als schnörkellose Reduktion auf das Wesentliche verstehen.
Sein schriftstellerisches Profil ist durch seine frühe Lebensgeschichte geprägt, denn die Aufkunft des Nationalsozialismus zwang ihn zur Flucht quer durch Europa und nach Israel. Bis zu seinem Tod schrieb er Bücher in dichter Abfolge, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Die untergründigen Verbindungslinien, die sich autobiographisch durch seine Erzähltexte ziehen, sind für das Verständnis seiner Literatur zentral.
Puristischer Sprachstil und Sprachvielfalt

Die Bukowina wird in seiner Prosa zu einer Art Sehnsuchts- und Erinnerungs-, aber auch Traum- und Traumalandschaft.
Bukowina und Israel
Auf einzigartige Weise vermochte Appelfeld das flüchtende Waisenkind als Subjekt in der israelischen Literaturlandschaft zu etablieren.[4] Der frühe Heimatverlust und die Erfahrung mit der NS-Vernichtungsmaschinerie prägten sein literarisches Schaffen bis ins hohe Alter. Was er im Alter von zehn bis fünfzehn Jahren kaum verarbeiten kann, lebt von den frühen Erzählungen bis zum Spätwerk fort. Die Konturen seiner Fluchtroute lassen sich in seinen Romanwelten nachzeichnen. Dabei gehört es zu den hartnäckigen Thesen der Appelfeld-Forschung, dass seine Erzähltexte ausschließlich in der Bukowina situiert sind. Tatsächlich streifen seine Figuren durch diese landschaftliche Gegend, insbesondere durch die Fluss- und Waldgegend der Karpaten. Die Bukowina wird in seiner Prosa zu einer Art Sehnsuchts- und Erinnerungs-, aber auch Traum- und Traumalandschaft, die sich vor den Augen der Leserinnen und Lesern neu entfaltet. Die topographische Zentrierung auf die Bukowina gehört zu den kleinen blinden Flecken in der Forschung. Denn seine Figuren begeben sich häufig aus Israel zurück in diese versunkene Welt. Mitunter sind die Geschichten auch als Fluchtwege nach Israel angelegt, mithin ist der Schauplatz der Handlung auch Israel.
Judentum und Schoa
Appe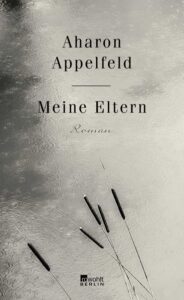
Traumatische Sprachlosigkeit gehört zu den subjektgeschichtlich tiefgreifenden Erfahrungen seiner Figuren im Leben nach dem Überleben.
Appelfeld hat seine Sehnsucht nach dem Judentum weder versteckt noch negiert, weshalb es hilfreich sein kann, wenn die Literaturwissenschaft sich den religiösen Sinnlinien in seinem Werk öffnet, wie auch umgekehrt die Theologie ihrerseits unter Wahrung der Autonomie seiner Erzähltexte die dort verhandelten Fragestellungen zu bearbeiten versucht. Vermutlich wird man Appelfelds Erzählprosa wohl nur dann angemessen verstehen, wenn man die religiösen Fragen ernst nimmt, um dadurch die Brüche und Strukturzusammenhänge klarer zu fassen. Schließlich wurde die Schoa dem säkularen Juden zum Anlass der Selbstvergewisserung. Die Schoa kommt als das, was sich Adorno zufolge „dem Verständnis [entzieht]“, also das zugleich „Unsagbare“ und „Unheilvolle“[6] ist, in seinen Erzähltexten lediglich als Bruchstelle zur Lesbarkeit. In seinen Prosatexten tastet Appelfeld schreibend die porösen Verlaufslinien der Bruchstelle ab, gibt aber den erzählerischen Blick nie ins Innere der Katastrophe frei. Seine Romane enden entweder vor der Schoa oder die Handlung setzt erst irgendwann nach den grauenvollen Ereignissen an, oder aber die Handlung klammert, wie im Roman Zeit der Wunder, diese Zeit aus. Nichts markiert den Versuch, die zurückliegenden Ereignisse in eine Sprache zu bringen, klarer als der Satz in der Geschichte eines Lebens: „Es gab keine Worte.“[7] Traumatische Sprachlosigkeit gehört zu den subjektgeschichtlich tiefgreifenden Erfahrungen seiner Figuren im Leben nach dem Überleben. Treffend mag hier die Schreibweise ÜberLeben sein, da es Jean-François Lyotard zufolge „impliziert, daß eine Entität, die tot ist oder es sein sollte, noch lebt“.[8] Die Zäsur wird in den Texten als Gefährdung kenntlich: Oftmals scheint es, dass die Figuren „eine unmögliche Geschichte in sich [tragen]“[9], wie Cathy Caruth es ausführt, die sie weder verarbeiten noch annehmen können.
Die Grundvorstellungen der Hebräischen Bibel und auch der jüdischen Tradition finden Eingang in sein Werk.
Biblische Sprache
Zur Reflexion dieser Fluchtgeschichten helfen biblische Texte. Sie werden ebenso wie die jüdische Tradition zu einem Fluchtpunkt von Appelfelds Erzählarchitektur. Auch manchen seiner Figuren hilft die Bibellektüre, um das Verhältnis von biblischer Tradition und säkularer Moderne auszuloten. Weithin unbeachtet blieb in der Forschung bisher, dass Appelfeld für seine Prosatexte wichtige biblische Denkfiguren, Motive und Zitate aufgreift und fortschreibt. Umgekehrt sind seine Romane vielfach auf die jüdisch-biblische Tradition rückgebunden. Nur folgerichtig lässt sich nach eingehender Lektüre insbesondere seines Spätwerks als These formulieren, dass die Heilige Schrift, die bei Appelfeld zwar ihren unhinterfragten Offenbarungscharakter eingebüßt hat, als wichtige Textgrundlage seiner Erzähltexte fungiert. Dabei werden zum einen biblische Motive aufgegriffen, zum anderen verleihen auch die Struktur- und Stilverfahren der Bibeltexte seinen Prosatexten einen Akzent. Obwohl man die großen religiösen Begriffe – wie etwa auch die Gottesfrage – in seinem Werk zunächst vergeblich suchen wird, finden die Grundvorstellungen der Hebräischen Bibel und auch der jüdischen Tradition Eingang in sein Werk.
Die besondere Kreativität, die Appelfeld in seinem Erzählwerk zur Geltung bringt, rührt auch in der Verarbeitung von biblischen wie allgemein religiösen Ambiguitäten: Dazu gehört der Bruch mit der Tradition, den meist der Vater seiner Protagonisten verkörpert, aber auch der mit viel Empathie eingespielte Vollzug religiöser Fest- und Feiertage. Dazu zählen insbesondere auch die deutlichen Bezugnahmen auf Appelfelds Lehrer Dov Sadan, Gershom Scholem und Martin Buber. Vor allem Bubers Begeisterung für die poetische, ästhetische und inhaltliche Qualität des biblischen Textes dürfte Appelfeld bis zuletzt beeindruckt haben – insbesondere aber der Sinngehalt biblischer Texte selbst: Ganz in diesem Sinne sind die Fluchtgeschichten mit der prägnanten biblischen Signatur des Exodus versehen. Die zerbrochene Kindheit seiner Figuren wird als Exodus-Geschichte literarisch verwandelt.
—

Lukas Pallitsch, Dr., PhD, ist Universitätsassistent („post-doc“) am Institut für Praktische Theologie der Universität Wien. In seiner Arbeit beschäftigt er sich v.a. mit dem Verhältnis von Literatur und Religion, aber auch mit Theorie und Formen des interreligiösen Lernens (insbes. christlich-jüdischer Dialog) und antisemitismuskritischer Bildung.
Beitragsbild: Wolfgang Treitler
Bild von Appelfeld im Text: Von Jwh at Wikipedia Luxembourg, CC BY-SA 3.0 lu, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32969143
—
[1] Vgl. Gila Ramras-Rauch: Aharon Appelfeld: The Holocaust and Beyond. Bloomington 1994.
[2] Paul Celan, Der Meridian und andere Prosa. Frankfurt a.M. 1988, 37.
[3] Aharon Appelfeld, Meine Eltern. Berlin 2017, 7f.
[4] Miller Budick spricht in diesem Zusammenhang vom „refugee survivor“ (Miller Budick, Emily: Aharon Appelfeld’s Fiction. Acknowledging the Holocaust. Bloomington 2005, XII).
[5] Aharon Appelfeld, Meine Eltern. Berlin 2017, 141.
[6] Theodor W. Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Frankfurt a.M. 2003, 116–117.
[7] Aharon Appelfeld, Geschichte eines Lebens. Berlin 2005, 91.
[8] Jean-François Lyotard, Der/Das Überlebende. In: Dietmar Kamper (Hg.): Anthropologie nach dem Tode des Menschen. Frankfurt a.M. 1994, 437–462, hier 437.
[9] Cathy Caruth, Trauma als historische Erfahrung: Die Vergangenheit einholen. In: Ulrich Baer (Hg.): Niemand zeugt für den Zeugen. Frankfurt a.M. 2000, 86.