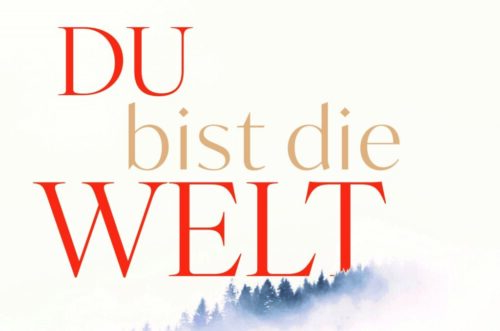Christ und Animist: In seinem neuen Buch „Du bist die Welt“ setzt sich Niklaus Brantschen mit Schamanismus auseinander – und über Tabus hinweg. Eine Rezension von Johanna Di Blasi.
„Christsein und Buddhist – wie passt das zusammen?“, wird Niklaus Brantschen, Schweizer Jesuit und Zen-Meister, immer wieder gefragt. Nun kommt auch noch Schamanismus hinzu. Der Begründer und langjährige Leiter des Lassalle-Hauses, ein interreligiöses Begegnungszentrum in der Schweiz, begibt sich mit seinem jüngsten Buch „Du bist die Welt“ auf die Spur schamanischer Weisheit in schwieriges Gelände. Ein Himmelsfahrtskomando möchte man meinen: Wie kann man über Schamanismus reden, als Nicht-Schamane, als Nicht-Indigener, als „alter weisser Mann“ gar? Besser gar nicht. Dies wurde dem Bestsellerautor und spirituellen Lehrer im Vorfeld auch dringend geraten. Er solle bloss die Finger von dem Thema lassen. Also Sprachlosigkeit, Nicht-Beziehung?
Unüberwindbare Fremdheit
„Interreligiöse Beziehungen“ sind in aller Munde, interreligiöse Studien tauchen überall auf, aber sie beschränken sich bei uns normalerweise auf die abrahamitischen Religionen. Hie und da kommt noch der Buddhismus hinzu. Darüber hinaus kann von Beziehung aber kaum die Rede sein. Bei der Konstellation Christentum und Schamanismus scheint eine regelrechte Unverträglichkeit vorzuliegen oder zumindest eine unüberwindbare Fremdheit. Während indigene Rituale und schamanische Symbole im Zuge postkolonialer Schuldaufarbeitung in Institutionen der Hochkultur angekommen sind (Kunstbiennalen, documentas), erschiene es nahezu obszön, wenn im selben Rahmen ein christlicher Priester das Räuchergefäss schwenken und seinen Segen erteilen würde.
Wenn man sich fragt, was einer Beziehung bislang entgegenstand, kommen einem eine Reihe von Gründen in den Sinn: neben der Missionsgeschichte und Verstrickung in den Kolonialismus Aussagen der Bibel über „Zauberei“, Urteile von Theologen, kulturelle Abwertungen und oftmals ausdrückliche Verteufelung, fortbestehende Missverständnisse und Vorurteile. Eine christliche Buchhändlerin rief aus: „Um Himmels willen! Schamanismus – doch nicht bei uns!“ Im Obergeschoss der Buchhandlung entdeckte Brantschen aber gleich mehrere Bücher zu „Krafttieren“. „Ironie der Geschichte“ vermerkt er dazu im Vorwort. Aber selbst Brantschen ist das Thema nicht leichtgefallen.
Nach innerem Ringen entschied er sich, einen radikal-subjektiven Zugang zu wählen, den Schamanismus von innen her zu erkunden. Also mit Mitte 80 noch trommeln lernen, in Schwitzhütten sitzen, Ayahuasca konsumieren? Das dann doch nicht. Aber sich verwurzeln. „Ich will und muss eintauchen, will die pflanzlichen und animalischen Anteile in mir sehen, annehmen und lieben. Ebenso die erdhaften“, weil Leben heisst, „sich im Erdreich verwurzeln“.
Verbindung mit den Ahnen in der Tiefe der Zeit
Der Autor lädt seine Leser:innen in knappen, verdichteten Kapiteln zu einer Reise durch das Reich der Pflanzen, Tiere und Geister ein. Er schlägt einen weiten Bogen über Moos und traurige Tieraugen (Rosa Luxemburgs „Büffelbrief“) zu Mischwesen und einer zeitgenössischen „Bärenfrau“ bis zu seiner Nichte, einer Bachblütenexpertin, die von sich sagt, sie sei „vielleicht so etwas wie eine Schamanin“. In prähistorischen Bildwerken tauchen Mensch-Tier-Zwitter auf, mit nach unten gestreckten Zehen. Es sind Trancefiguren. Auf der Schwäbischen Alb (Löwenmensch) oder in der südfranzösischen Höhle Trois-Frères („Tanzender Schamane“) wurden sie gefunden. Über sie verbindet sich der Autor mit den Ahnen in der Tiefe der Zeit, bevor es Christ:innen gab, und bevor Begriffe wie Religion oder Spiritualität Sinn ergaben.
Als „Bärenfrau“ bezeichnet er Nastassja Martin, die zeitgenössische französische Ethnologin und Autorin von „An das Wilde glauben“. Die Schülerin von Philippe Descola („Jenseits von Natur und Kultur“) wurde im entlegenen Kamtschatka, im äussersten Osten Russlands, von einem Bären angefallen. Die junge Forscherin schwebte nicht bloss zwischen Leben und Tod, sondern auch zwischen menschlichen und tierischen Sphären.
Eine geistige Nähe entdeckt Brantschen zu Malidoma Patrice Somé aus Burkina Faso. Dieser machte in einer Jesuitenschule Missbrauchserfahrungen und durchlief, zurückgekehrt ins Heimatdorf, eine Initiation. Somé bemerkte: „Dinge sind umso lebendiger, je mehr sie vom Schweigen umgeben sind.“ Stille erfuhr Somé als „Betrachtung, die uns betrachtet.“
Therapeutische Religionen
Einen Geistesverwandten entdeckt der Autor auch im französische Ethnologen Eric de Rosny. Dieser war überdies Jesuit wie Brantschen. De Rosny schildert in seinem Erfahrungsbericht „Die Augen meiner Ziege“, wie er sich Mitte des vergangenen Jahrhunderts in westafrikanische Kulte einweihen ließ. De Rosny lernte Kosmologien kennen, die von einer Parallelität von irdischer und übernatürlicher Welt ausgehen. Schamanen sind hier Mittlerfiguren und Träume ein wichtiges Medium. Spiritistische Kulte tragen zur Stabilisierung von Gemeinschaften bei, um den Preis vergleichsweise hoher sozialer Kontrolle.
Auf simples magisches Denken stieß der Anthropologe nirgendwo, vielmehr auf komplexe Praktiken, die Familien und ganze Dorfverbände in Therapien einbeziehen. Jenseits von Idealisierung, aber mit großem Respekt spricht de Rosny von Afrikas „therapeutischen Religionen“. Die Kunst des Heilers bestehe im Erspüren und Auflösen von Spannungen. Brantschen überträgt das auf seinen eigenen Berufsstand. „Ein guter Priester, eine gute Priesterin ist ein Mensch, der heilend wirkt und ein Segen ist für Menschen und andere Wesen.“ Der Weg dorthin führe über die spirituellen Wurzeln, und diese, so eine Pointe des Buches, seien schamanisch. In unserer Gegenwart, bemerkt Brantschen, „meldet sich das Verdrängte und Verleugnete allenthalben“. Es als „Neuheidentum“ abzutun und in die Esoterikecke zu schieben, greife zu kurz.
Kontrapunkt zu identitären Engführungen
Niklaus Brantschen setzt mit seinem Buch einen Kontrapunkt zu identitären Engführungen der erstarkenden christlichen Rechten wie auch zu Traditionalist:innen, die dem kirchlichen Bedeutungsschwund mit ängstlichem Rückzug begegnen. Im Hintergrund steht ein tiefenökologisches Anliegen: Erst wenn der Schrei der Erde „zu deinem Schrei wird, wirst du für die Lebenssphäre, die den schönen blauen Planeten Erde wie eine Membran umfängt, Sorge tragen.“
«Du bist die Welt» ist, wie im Untertitel angekündigt, ein Weisheitsbuch geworden. Eine Schwachstelle: Die kritische Auseinandersetzung mit dem Problem kommerzieller Ausschlachtung indigenen Wissens derzeit im Westen («Shaman Business») bleibt aus und die Frage nach spiritueller Appropriation, auch der eigenen, ungestellt. Die Frage, ob sich ein „alter weisser Mann“ überhaupt zum Schamanismus äussern darf, dürfte sich indes erübrigen: Wenn Schamanismus Menschen, Pflanzen, Tiere, Geister –und in manchen Fällen sogar Steine – miteinander ins Gespräch bringt, wieso sollte ein alter Mann nicht mitreden dürfen?
Hinweis: Der Bildungs- und Hotellbetrieb des interreligiösen Lassalle-Hauses wurde zum 1. Juli 2025 aus Spargründen eingestellt. Die Jesuiten-Gemeinschaft bleibt vor Ort präsent und aktiv. Schwierige Zeiten für eine „interreligiöse, weltoffene“ Spiritualität, für die Niklaus Brantschen steht.
Niklaus Brantschen, Du bist die Welt. Schamanischer Weisheit auf der Spur, Patmos Verlag 2025.
___

Johanna Di Blasi ist promovierte Kunsthistorikerin, Kulturjournalistin und Podcasterin. Als Mitarbeiterin der reformierten Online-Plattform RefLab in Zürich hostet sie den Podcast Himmel & Erdung (vormals TheoLounge) zu neuer Mystik und spiritueller Innovation.
Beitragsbild: Ausschnitt Buchcover