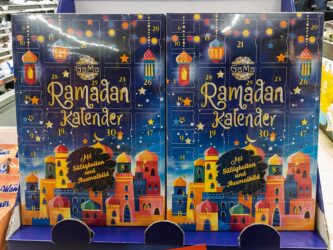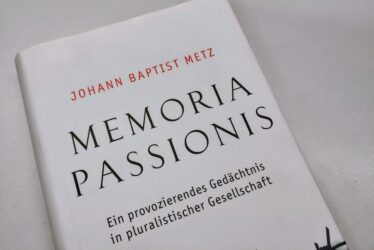Zur neuen Berliner Bundesregierung gehört mit Kulturstaatsminister Wolfram Weimers eine hochumstrittene und unter Kulturschaffenden massiv angefragte Person. Der Theologe Matthis Glatzel geht der politischen Theologie Wolfram Weimers nach.
Am 6. Mai wurde der Verleger und Publizist Wolfram Weimer durch Bundeskanzler Friedrich Merz zum Kulturstaatsminister ernannt. Während Weimer in Verbindung mit seinem Auftritt beim Deutschen Filmpreis in der ZEIT als ‚Unehrengast‘ betitelt wurde, stellte man auf der anderen Seite in der JUNGEN FREIHEIT erwartungsvolle Mußtmaßungen darüber an, ob Weimer jetzt dem Recherchekollektiv Correctiv die Mittel streichen werde. Dirk Knipphals stellte in der TAZ schließlich eine Nähe des Denkens Weimers zur sog. ‚Neuen Rechten‘ fest.[1]

Gesellschaftlicher Verlust
des Religiösen als Untergang
der abendländischen Kultur
Neben den Prädikaten wie ‚wertekonservativ‘, ‚neokonservativ‘ oder wahlweise auch ‚konservativ-liberal‘ trifft noch ein weiteres Prädikat auf Weimer zu: er ist bekennender Katholik. Prägnanten Ausdruck findet seine Religiosität etwa in seinem jüngsten Buch mit dem einschlägigen Titel Sehnsucht nach Gott. Warum die Rückkehr der Religion gut für unsere Gesellschaft ist aus dem Jahr 2021. Überraschend feiert Weimer hier eine bevorstehende Rückkehr der Religion für den mitteleuropäischen Kulturraum: „Die vorliegende Streitschrift vertritt die These, dass sich der Säkularisierungsprozess umkehren wird.“[2] Man kommt nicht umhin, diesen Optimismus im Horizont kulturpessimistischer Ressentiments zu lesen, wenn die Rede von einem Verlust Gottes im 20. Jahrhundert und postmodernen Wohlstandsgesellschaften ist.[3] In Land unter. Ein Pamphlet zur Lage der Nation spricht Weimer vom „zivilisatorischen Zerfall“[4] und bezeichnet Europa als erlöschenden Vulkan[5] dessen kulturelle Größe im Niedergang begriffen sei. An anderer Stelle bringt Weimer dieses Phänomen als ‚Nihilismus‘ zur Sprache: eine Gesellschaft, die an nichts glaubt, könne auch nicht mehr an sich selber glauben.[6] Gerade weil dieser Prozess der Säkularisierung zu den beiden großen atheistischen Ideologien von Faschismus und Kommunismus geführt habe, führe die Religionslosigkeit auf lange Sicht zu gesellschaftlichen Implosionen.[7] Das Ganze erinnert nicht von ungefähr an Oswald Spengler, auf dessen Werk Der Untergang des Abendlandes sich Weimer auch explizit bezieht. Auch Spengler markierte in diesem Werk einen gesellschaftlichen Verlust des Religiösen, der die apokalyptischen Untergangsdynamiken befördere. Schuld an diesen Prozessen ist laut Spengler die allgemein verbreitete Dekadenz. Der Begriff spielt eine zentrale Rolle für Spenglers Geschichtsphilosophie. Der Untergang der gegenwärtigen ‚abendländischen‘ Kultur sei etwa in einer um sich greifenden Genusssucht erkennbar.[8] Von hier aus ist es zur Rede über Wohlstandsverwahrlosung nicht mehr weit.
Die Annahme vom
religiös-christlichen Kern Europas
Interessant ist, wer gegenwärtig ebenfalls in kulturpessimistischen Untertönen im Nachgang an Spengler einen Verlust des Religiösen beklagt. Zu nennen ist Martin Lichtmesz, neurechter Publizist im Umfeld Götz Kubitscheks, mit seiner 2014 erschienen Monographie Kann nur ein Gott uns retten? Auch Lichtmesz beklagt hier den Untergang des eigenen „Kulturkreises“[9] – einem Grundbegriff Spenglers, den auch Weimer dankbar aufnimmt[10] –, dem es mit einer geistigen Revolution zu begegnen gelte.[11] Ähnlich wie Weimer hofft auch Lichtmesz auf eine religiöse Erneuerung des Christentums.[12] Die gebotene Erzählung verläuft dabei strukturanalog zu dem in Weimers Ausführungen Gebotenem. Der religiös-christliche Kern Europas wurde „zerschossen von Descartes und Kopernikus, Kant und Schopenhauer, Darwin und Freud, Nietzsche und Heidegger“[13] (Lichtmesz) oder wahlweise durch Kopernikus, Kant, Darwin, Feuerbach, Marx und Freud[14] (Weimer). Aufklärung und Religionskritik werden hier als gemeinsame Geschichte gelesen, die schlussendlich dazu führen musste, dass das ‚Abendland‘ nicht nur religiös, sondern auch kulturell sturmreif geschossen wurde.
Christentum als
Instrument der Wehrhaftigkeit
Doch worin liegt eigentlich das Problem an der Säkularisierung? Beide, Weimer und Lichtmesz, bekleiden keine kirchlichen Ämter und ihnen könnten doch auch die leeren Kirchenreihen egal sein. Sie ist ein Problem, weil hier die Religion für ein politisches Projekt in die Verantwortung gezogen wird. An dieser Stelle taucht auch bei Weimer der von Lichtmesz verwendete Begriff des Kulturkreises auf. So fühle der „Christ das Abendland als (s)eine Heimat.“[15] Damit wird eine enge Bindung von Christentum und Europa postuliert. Durch den Rückgang des ersteren komme letzterem jedoch die kulturelle Wehrhaftigkeit abhanden.[16] Europa misstraue sich, so Weimer, „es hasst seine Geschichte“.[17] Die Überzeugung, dass Europa zur kulturellen Wehrhaftigkeit das Christentum braucht, ist weit verbreitet. Der genannte Lichtmesz kann diesen Gedanken etwa im Anschluss an Ernst Jünger, ebenfalls ein wichtiger Vordenker der Neuen Rechten, durchspielen.[18] Ähnlich sieht es auch der AfD-Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah. Ihm gelten – in Anspielung an rechtsextreme Verschwörungserzählungen – die traditionellen „Kultur- und Religionsinstitutionen“ als „Hindernisse für den ‚Great Reset‘.“[19] Leider sei jedoch das „westliche Christentum […] vollständig entkernt, so daß wir nicht mehr erleben, was eine solche funktionierende Institution ist und kann.“[20] Neben dem ‚Great Reset‘ werden vom Christentum vor allem kulturelle Resilienzressourcen gegen eine feindliche Übernahme durch den Islam erwartet. So ist wiederum Lichtmesz skeptisch, ob die „stark verwässerten und verzuckerten Reste […] des Christentums“[21] dazu geeignet sind, der „Landnahme“ durch den „politische[n] Islam“[22] etwas entgegenzusetzen.
Es ist nicht die kriegerische Rhetorik, die bei Weimer zu finden ist und er verzichtet gleichermaßen auf verschwörungstheoretische Mythen. Sehr wohl findet sich bei ihm hingegen die Beschwörung des Christentums für eine kulturelle Wehrhaftigkeit: „Der Konflikt mit dem Islamismus kann man kaum mit intellektuellem Appeasement entschärfen. Vielmehr mit kultureller Selbstbehauptung.“[23]
Genderkulturpolitische Themen
Doch nicht nur nach außen hin soll die religiöse Erneuerung eine Funktion erfüllen, sondern gleichermaßen wird erhofft, alte gesellschaftliche Ordnungsvorstellungen neu zu installieren bzw. zu festigen. Zentral für Weimer sind dabei Ehe und Familie, die „dem Religiösen“[24] besonders am Herzen lägen. Demgegenüber sei es die „Gender-Ideologie“, die „die anthropologische Grundlage der Familie“[25] aushöhle. In der Forschung gelten die Ablehnung genderkulturpolitischer Themen als besondere „Brückenthemen“[26] zwischen der Neuen Rechten und dem Christentum. Es reicht bereits der Seitenblick auf Maximilian Krah, der gleichermaßen genderkulturpolitische Themen mit Verweis auf eine „natürliche Ordnung“ verunglimpfen kann, die letztlich „christlich gegründet“[27] sei. Inwiefern die Ablehnung genderkulturpolitischer Fragestellungen tatsächlich Ausweis einer problematischen extrem rechten Christentumsdeutung ist, soll und kann an dieser Stelle nicht entschieden werden.
Festgestellt werden kann jedoch sehr wohl, dass Weimer in ganz ähnlicher Hinsicht wie Lichtmesz und Krah eine erneute Bedeutungszunahme des Christentums begrüßt. Gemeinsam ist allen drei Autoren die Klage über einen Verlust des Religiösen im ‚Abendland‘, der einen gesellschaftlichen Zerfall zur Folge gehabt habe. Insbesondere bei Weimer und Lichtmesz wird hier der Bezug auf Spengler explizit. Aufgrund des Verlustes des Religiösen fehle der ‚abendländischen Gesellschaft‘, so die Überzeugung, die kulturelle Selbstbehauptung um sich gegen die ‚Islamisierung‘ zur Wehr setzen zu können. Zuletzt wird sich auch eine Bedeutung des Christentums für kulturpolitische Fragen, wie Familie, Ehe und Geschlecht, erhofft.
Der Universalismus der Menschenwürde
bedroht die völkische Ideologie.
Den angeführten Gemeinsamkeiten zum Trotz muss an dieser Stelle gleichermaßen differenziert werden. Der entscheidende Unterschied zwischen Weimer auf der einen und Krah und Lichtmesz auf der anderen Seite, liegt in der Würdigung des Individuums und der damit verbundenen Menschenwürde. So formuliert Krah als programmatischen Ausgangspunkt seiner Überlegung die Unterscheidung von Individuum und Kollektiv.[28] Was das genau bedeutet wird deutlich mit Blick auf Lichtmeszs Rede von einer „Ideologie und Hypermoral der ‚Menschenrechte‘“.[29] Ihm erscheint die Menschenwürde als Trick nationale Selbstbestimmung zu untergraben.[30] Der Universalismus der Menschenwürde bedroht die völkische Ideologie. Demgegenüber kann Weimer die Würde des Menschen als Konsequenz des Christentums nachdrücklich affirmieren.[31]
Diskursverschiebung nach rechts
Mit Blick auf die entscheidende Frage nach der Menschenwürde unterscheidet sich Weimer deutlich vom neurechten Ideenpolitiker Lichtmesz. Hier scheint eine Demarkationslinie zu verlaufen, die zu markieren im Sinne einer konsequenten Differenzierung nicht unterschätzt werden darf. In der Würdigung des Christentums für die Politik hingegen gibt es, wie gesehen, starke inhaltliche Überschneidungen zwischen dem Kulturstaatsminister und Akteuren der sog. Neuen Rechten und mit Spengler werden hier ähnliche Gewährsmänner in Stellung gebracht. Unabhängig davon, wie man im Einzelnen die Positionen Weimers bewertet, werden hier somit Vorstellungen transportiert, wie sie in der sog. ‚Neuen Rechten‘ entwickelt werden. Dies kann als Erfolg der strategischen Programmatik der ‚Neuen Rechten‘, die „kulturelle Hegemonie […] zu beeinflussen“[32], gewertet werden. Mit der Personalie Weimer scheint der Diskurs der Christentumsdeutungen bis in die höchsten staatspolitischen Ebenen erfolgreich ein Stück nach rechts verschoben worden zu sein. Der neue Kulturstaatsminister bestimmt damit eine Funktion des Christentums für rechtskonservative Politik. Konflikte mit den beiden Kirchen, ob evangelisch oder katholisch, die in den letzten Jahrzehnten die Pluralität und Individualität von Lebensentwürfen anerkannt haben und eine nicht polemische Rolle in der säkularen Gesellschaft suchen, scheinen vorprogrammiert.
___

Matthis Glatzel, Studium der Philosophie und Theologie in Mainz, Frankfurt und Leipzig, von Oktober 2021 – März 2025 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Graduiertenkolleg „Modell Romantik“ und ab April 2025 Assistent am Lehrstuhl für Praktische Theologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Titelbild: Shutterstock
[1] Kulturstaatsminister Wolfram Weimer: Und das soll bürgerlich sein? | taz.de (Zugriff am 25.05.2025)
[2] Wolfram Weimer, Sehnsucht nach Gott. Warum die Rückkehr der Religion gut für unsere Gesellschaft ist. Paderborn (Bonifatius) 2021, S. 15.
[3] Ebd.
[4] Wolfram Weimer, Land unter. Ein Pamphlet zur Lage der Nation. Gütersloh (Gütersloher Verlagshaus) 2012, S. 17.
[5] Vgl. Wolfram Weimer, Freiheit, Gleichheit, Bürgerlichkeit. Warum die Krise uns konservativ macht. Gütersloh (Gütersloher Verl.-Haus) 2009, S. 123.
[6] Vgl. ebd., S. 124.
[7] Ebd.
[8] Vgl. Robin Groß, Oswald Spengler: Der Untergang des Abendlandes. In: David Meiering (Hg.), Schlüsseltexte der „Neuen Rechten“. Kritische Analysen antidemokratischen Denkens. Wiesbaden/Heidelberg (Springer VS) 2022, 49-58., S. 52f.
[9] Martin Lichtmesz, Kann nur ein Gott uns retten? Glauben, hoffen, standhalten. Schnellroda (Verlag Antaios) 32020, S. 8.
[10] Vgl. Weimer, Sehnsucht nach Gott, S. 89.
[11] Vgl. Lichtmesz, Kann nur ein Gott uns retten?, S. 24.
[12] Vgl. Ebd.
[13] Ebd., S. 26.
[14] Vgl. Weimer, Sehnsucht nach Gott, S. 11.
[15] Ebd., S. 89.
[16] Vgl. ebd., S. 94.
[17] Ebd., S. 95.
[18] Vgl. Lichtmesz, Kann nur ein Gott uns retten?, S. 377.
[19] Maximilian Krah/Alexander Gauland, Politik von rechts. Ein Manifest. Schnellroda (Verlag Antaios) 2023, S. 170.
[20] Ebd.
[21] Lichtmesz, Kann nur ein Gott uns retten?, S. 81.
[22] Ebd., S. 79.
[23] Weimer, Sehnsucht nach Gott, S. 36.
[24] Ebd., S. 87.
[25] Ebd., S. 88.
[26] Benedikt M. Löw, Christen und die Neue Rechte?! Zwischen Ablehnung und stiller Zustimmung: eine Problemanzeige. Hamburg (Diplomica Verlag GmbH) 2017, S. 47. Vgl. Liane Bednarz, Die Angstprediger. Wie rechte Christen Gesellschaft und Kirchen unterwandern. München (Droemer Knaur) 2018, S. 60.
[27] Krah/Gauland, Politik von rechts, S. 24.
[28] Krah/Gauland, Politik von rechts, S. 14.
[29] Martin Lichtmesz, Ethnopluralismus. Kritik und Verteidigung. Schnellroda (Verlag Antaios) 2020, S. 200.
[30] Vgl. ebd., S. 36.
[31] Vgl. Weimer, Sehnsucht nach Gott, S. 36.
[32] Martin Sellner, Der Große Austausch in Deutschland und Österreich: Theorie und Praxis. In: Martin Lichtmesz (Hg.), Revolte gegen den Großen Austausch. Schnellroda (Verlag Antaios) 42022, S. 189.