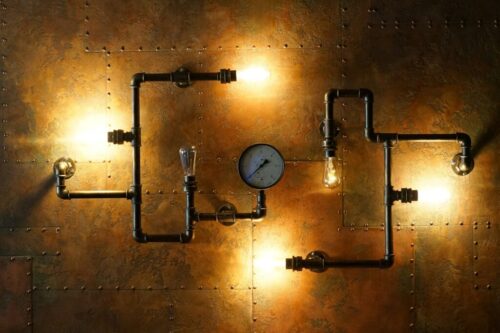Anne-Kathrin Fischbach, Stephan Tautz und Julia Enxing wagen einen Blick hinter die Kulissen der (theologischen) Wissenschaft und rufen zu einer Gegenkultur der Solidarität auf.
Wir müssen reden. Wir müssen miteinander statt übereinander reden, damit die Universität, damit die Wissenschaft ein besserer Ort für alle wird. Selbstverständlich ist der Blick auf die Existenz der:s Wissenschaftlers:in je individuell, kontakt- und statusabhängig. Anne-Kathrin Fischbach, Stephan Tautz und Julia Enxing sind in einem Austausch über ihr jeweiliges Erleben als Theolog:in an der Universität und teilen einige Aspekte ihrer Wahrnehmung in diesem Beitrag. So unterschiedlich die Situationen – leicht ist es für niemanden.
Anne-Kathrin Fischbach:
Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Artikels bin ich im neunten Monat schwanger. Das erste Mal bin ich mir über meine Berufswahl nicht mehr wirklich sicher. Ich habe wahnsinnig gern Theologie studiert und trotz aller Widrigkeiten, die ein Promotionsstudium mit sich bringt, würde ich das immer wieder machen. Wäre ich nicht schwanger geworden – ich würde nicht zögern, weiter eine akademische Karriere zu verfolgen.
Aber jetzt sind da Faktoren, die dafür sorgen, dass ich mit anderen Augen auf meinen Beruf blicke. Ich mache mir Sorgen, den Anforderungen dieses Berufs mit meiner neuen Lebenssituation auf Dauer nicht mehr gewachsen zu sein. Denn meine Situation ist vom Wissenschaftssystem nicht vorgesehen. Was eigentlich ein freudiges Ereignis ist, droht in meinem konkreten Fall zum möglichen Defekt zu werden.
Was eigentlich ein freudiges Ereignis ist, droht in meinem konkreten Fall zum möglichen Defekt zu werden.
Denn die Wissenschaft sieht zumindest in der Forschung Personal vor, das sich in einer Lebenslage befindet, in der es jederzeit mindestens 100% geben kann. Das Wissenschaftssystem ist auf der beständigen Suche nach Elite – und dazu zählen keine Menschen, die Care-Arbeit leisten wollen oder gar selbst krank sind. Nachteilsausgleiche, Förderprogramme und universitäre Unterstützungsangebote kommen gegen diesen universitären Habitus nur schwer an. Denn solche Angebote in Anspruch zu nehmen, suggeriert bereits, dass man es alleine nicht schafft. Und so bleibt es dabei: Nur wer es sich leisten kann oder will, keine Care-Arbeit zu übernehmen, wer „Schwäche“ möglichst effektiv kaschieren kann, kann dem universitär produzierten Bild von Elite entsprechen. Und das – nebenbei bemerkt – sind öfter Männer als Frauen.
„Schwäche“ möglichst effektiv kaschieren
Aber diese Konstruktion von Elite hat nicht nur Auswirkungen auf die Geschlechterverhältnisse an den Universitäten, sondern beeinflusst über die Kultur des kollegialen Miteinanders die gesamte Wissenschaftslandschaft. Das System Universität belohnt Vereinzelung und erzieht Wissenschaftler:innen in der Qualifikationsphase zu Einzelkämpfer:innen. Exzellenz zeigt sich hier in Abgrenzung zu den anderen – die unausgesprochene, perfide Logik hinter solcher Art Exzellenz: Nur wer länger, härter, verbissener arbeitet als alle anderen, wer sich selbst und andere effektiver ausbeutet, der arbeitet besser, sticht heraus – und bekommt dadurch die dringend benötigten Forschungsgelder. Obwohl der Wert einer wissenschaftlichen Community als Faktor für Wissenschaftlichkeit unbestritten ist und auch immer wieder beschworen wird, werden Solidarität, Teamfähigkeit und Kooperation systemimmanent wenig honoriert.
Das führt zu einer Kultur der unterschwellig lauernden Aggression – Wissenschaftler:innen werden dazu erzogen, stets auf der Lauer zu liegen, um die Schwächen anderer zu identifizieren. Es geht nicht nur darum, Forschungslücken auszumachen, Leerstellen zu finden, sondern genau diese „Schwächen“ auch bei anderen zu erkennen und „zu nutzen“. Profilierung gelingt darüber, mit messerscharfem Verstand die vermeintlich wissenschaftliche Defizienz der Kolleg:innen deutlich zu machen. Dies gelingt auf subtile Weise – etwa wenn Kolleg:innen in der Qualifikationsphase ständig gefragt werden, ob sie den einen oder anderen Aufsatz schon gelesen haben, der auf keinen Fall vernachlässigt werden sollte. Oder wenn Habilitationsvorträge oder Vorsingen für Lehrstühle für Nachfragen genutzt werden, die inhaltlich nicht weiterführen, sondern der Bloßstellung von Menschen dienen.
Kultur der unterschwellig lauernden Aggression
Die Grenze zwischen Unanständigkeit und Wissenschaftlichkeit ist hier schmal. Denn offiziell lässt es sich stets auf das eigene Wissenschaftsethos berufen, darauf, das Fach durch die eigene Expertise weiterzubringen. „Falsifikation“ hat Popper dieses Prinzip genannt, aber in unserem Falle geht es nicht darum, die Wissenschaft weiterzubringen, sondern die eigene Reputation.
Wie Wissenschaftler:innen in der Qualifikationsphase behandelt werden, empfinden sie zumeist als zutiefst unbefriedigend und als Zustand, an dem sie Änderungsbedarf sehen. Aber zugleich erlernen sie diese Behandlung anderer, vor allem Schwächerer, als „Berufsethos“, dem sie auch dann weiter folgen, wenn sie „arriviert“ sind. Dass dieses Berufsethos dem Ethos des Christlichen widerspricht und in besonderem Maße die theologische Lehre pervertiert, sollte an dieser Stelle eigentlich nicht erwähnt werden müssen. Muss es aber.
Die Grenze zwischen Unanständigkeit und Wissenschaftlichkeit ist schmal.
Ein Kulturwandel ist dringend notwendig – aber dieser erfordert eine Charakterstärke, die sich aus dem System alleine nicht ableiten lässt: Den Mut zu einem hohen Grad nicht nur an wissenschaftlicher Kritikfähigkeit, sondern vor allem zu persönlicher Selbstreflexion und -kritik; die Bereitschaft dazu, Opfer für die Gemeinschaft zu bringen, die zunächst oder vielleicht sogar auf lange Sicht nicht auf das eigene Konto einzahlen, dafür aber vielleicht auf das Konto der Wissenschaft – und damit der Allgemeinheit.
Stephan Tautz:
Wenn Kolleg:innen wie Anne-Kathrin Fischbach ihre Wahrnehmung teilen, dann geht mich das an. Und auch das sollte eigentlich nicht erwähnt werden müssen: Angesichts der strukturellen Benachteiligung von Frauen in der Theologie[1] empfinde ich die propagierte Kategorie der „Bestenauslese“ als grotesk. Solidarität bewährt sich gerade im Überschlag zu Menschen, mit deren identitären Markern ich nicht vollständig identisch bin – sonst ist es Herdentrieb. Und letztlich hilft gegen die oben skizzierte Kultur der Vereinzelung nur eine Gegenkultur der Solidarität.
propagierte Kategorie der „Bestenauslese“: grotesk
In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an eine Begebenheit während meines Studiums in Leuven – nach Selbstauskunft in der „Champions League“ der Theologie. Entsprechend hoch war der Leistungsdruck, der durch die vielen begabten Studierenden aus aller Welt noch erhöht wurde. Erst als ich bei einem Kaffee einigen Mitgliedern meiner Research Group offenbarte, wie sehr ich bisweilen kämpfen musste, zerbrach so etwas wie eine unsichtbare Barriere zwischen uns. Ich war nicht länger „the German“ – beinahe gefürchteter Repräsentant (m)einer deutschsprachigen Theologie. Und ich verstand, wie auch meine so beeindruckenden Kommiliton:innen (Lat. commilito, Mitsoldat oder besser: „Mit-Streiter“), unter der Situation litten.
wie sehr ich bisweilen kämpfen musste
Seit dieser Zeit verfolge ich offensiv die Strategie der offenen Kommunikation – also natürlich nur auf der Ebene „Gleichrangiger“. Solidarität durch geteilte Vulnerabilität will portioniert sein. Dabei wäre es sicher sinnvoll, eine Kultur der Solidarität auch zwischen verschiedenen Statusgruppen zu fördern. Dafür müssen wir miteinander reden, in einen offenen und ehrlichen Austausch über gegenseitige Erwartungen und Anforderungen treten.
Solidarität durch geteilte Vulnerabilität will portioniert sein
Genau das sieht die BAM – Bundeskonferenz des Akademischen Mittelbaus der Katholischen Theologie[2] – als ihren Auftrag. Als die BAM im Januar im Rahmen des Fakultätentags das letzte Mal tagte, übersetzten wir unseren Erfahrungsaustausch in die Forderung nach mehr Professionalisierung in der Personalführung. Wir wollen niemanden unter Generalverdacht stellen und natürlich kennen wir Beispiele von tollen, ja aufopferungsvollen, Vorgesetzten. Aber auch „wohlwollende Hierarch:innen“ würden durch klare Strukturen und transparente Regeln von der Last immer wieder neu zu treffender „Gnadenakte“ befreit. Das hat auch die Hochschulrektorenkonferenz erkannt, in deren Empfehlung „Macht und Verantwortungen“ es heißt: „Professor:innen sind häufig in einer Person Vorgesetzte, Betreuende und Gutachtende von Qualifizierungsarbeiten und oftmals entscheiden sie in alleiniger Verantwortung über Vertragsverlängerungen. Den Hochschulen kommt daher eine besondere Verantwortung in der Etablierung einer positiven Führungskultur sowie der kritischen Reflexion über und möglichen Neugestaltung von bestehenden Arbeits- und Betreuungsverhältnissen zu, um Machtmissbrauch vorzubeugen und ihm adäquat zu begegnen.“[3] „[W]ir können und wollen noch besser werden“[4], wie der Präsident der HRK, Walter Rosenthal, kommentierte. Ein guter Vorsatz, auch für uns Early Career Researcher. Auch wir müssen selbstbewusst, aber auch -reflektiert die Rolle als Mitarbeitende mit Rechten und Pflichten annehmen.
Julia Enxing:
Ich möchte dies alles: positive Führungskultur; faire Betreuung von Studierenden und Early Career Researchers; erfolgreiche Drittmittelanträge; super Lehre; erstklassige Publikationen; mitreißende Vorträge. Ich möchte eine gute Kollegin sein; ein offenes Ohr haben und mich zugleich abgrenzen können; Stimme einer progressiven Theologie sein; die Interessen derjenigen vertreten, die zu wenig gesehen und gehört werden. Ich möchte meine eigene Macht kritisch reflektieren, aufmerksam für Abwertungsstrategien und Ideologien sein. Ich möchte nicht neutral sein, aber zugleich: Professionalität auf allen Ebenen – logo. Schon beim Schreiben dieser Zeilen (die ich ohne Weiteres auf weitere Seiten ausdehnen könnte), wird klar: alles geht nicht. Das Problem ist nur, dass genau das alles erwartet wird.
Alles geht nicht.
Es stimmt, anders als Anne-Kathrin Fischbach und Stephan Tautz gehöre ich zu den „Arrivierten“. Ich habe eine entfristete, gut bezahlte Professur. Häkchen an dieser Stelle. Ich kann Einfluss nehmen und muss nur wenigen Rechenschaft ablegen. Die Freiheit in Forschung und Lehre ist ein hohes Gut, klingt aber „freier“ als sie tatsächlich ist. Es ist eine Freiheit, die an Erwartungen und Bedingungen geknüpft ist. Frei wäre sie, wären damit keine handfesten Privilegien verbunden. Frei wäre sie, gäbe es kein Konkurrenzverhältnis angesichts der immer weniger werdenden Studierenden, der leistungsorientierten Mittelbemessung, der Impact-Zahlen. Der Leistungsdruck, dem auch ich als Professorin gewachsen sein muss, ist an manchen Tagen kaum auszuhalten.
Die Freiheit in Forschung und Lehre ist ein hohes Gut, klingt aber „freier“ als sie tatsächlich ist.
„Sei Pippi – nicht Annika“ steht auf einer Postkarte auf meinem Schreibtisch. Warum eigentlich? Weil Annika-Sein gefährlich ist. Für Anne-Kathrin Fischbach, Stephan Tautz – aber auch für mich. Je anders, aber gefährlich. Für die Annikas ist hier kein Platz an der Uni, für die Toms auch nicht. Im Uni-Betrieb gibt es kein „good enough“. Und das macht mich sehr betroffen. Eine Doktorandin sagte mir neulich, dass sie sich irgendwie schon vorstellen könnte zu habilitieren und Professorin zu werden, dass sie aber denkt, den Druck und die Kritik nicht so gut aushalten zu können wie ich. Ich kann den Druck nicht „gut aushalten“. Eine Stimme in mir sagt „immerhin denken die andern, Du kannst das und Du verdirbst anderen damit nicht ihren Berufswunsch“. Aber ganz ehrlich: Kann das so funktionieren? Der Erwartungsdruck an mich als Professorin ist hoch: (Fast) jede dieser Erwartungen ist für sich berechtigt, zusammen sind sie unerfüllbar. Mein Alltag besteht darin, mich permanent entscheiden zu müssen, wen ich enttäusche, auf wessen Kosten ich arbeiten muss. Und dabei möchte ich genau das nicht: dass mein Mitarbeiter weniger Zeit für seine Forschung (die doch genauso relevant und wichtig ist wie meine eigene) hat, weil er mir zuarbeiten muss, mir Aufgaben abnehmen muss. Ich möchte nicht, dass Aufgaben an der Fakultät ungerecht verteilt sind, weil manche offenbar „besser“ Prioritäten setzen können.
Im Uni-Betrieb gibt es kein ‚good enough‘.
Die Anforderungen sind enorm, an allen Ecken und Enden – permanent. Immer ist irgendwas. Zweite Postkarte: „Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s about learning to dance in the rain.“ Wenn das so leicht wäre, denke ich. Und dennoch ist dieser Beruf irgendwie auch eine Berufung. Es ist ein wunderbarer Beruf – der Beste, den ich mir vorstellen kann. Trotz allem. So schwer es ist, die Verantwortung für die gegebenen Spielräume zu übernehmen, es gibt einen Gestaltungsspielraum, ein Spielbein, nur eins, aber immerhin.
Und dennoch ist dieser Beruf irgendwie auch eine Berufung. Es ist ein wunderbarer Beruf.
Wir wünschen uns Mut zum Miteinander; Mut, nicht immer nur zu fragen, sondern auch einfach mal zu machen. Mut zur Veränderung. Unsere Chance besteht darin, es besser zu machen, gemeinsam Perspektiven auszutauschen und so auch füreinander ein Verständnis zu erlangen. Die High Performer der Boomer-Generation (sorry!) dienen da sicher nicht als Vorbild. Wissenschaft kann lebensfreundlich, diverssitätssensibel und lebensförderlich sein. Aber es liegt an uns allen, unsere Universitäten zu einem Ort zu machen, der es lernt, mit Schwächen und Stärken umzugehen, sich einmal mehr für, an und mit den Stärken der anderen zu freuen und einmal mehr darauf zu verzichten, die Schwächen der anderen auszunutzen.

Anne-Kathrin Fischbach, Mag. theol., arbeitet am Lehrstuhl für Dogmatik an Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Von 2024–2025 war sie Sprecherin der BAM.

Stephan Tautz, Dr. theol., ist Akademischer Rat am Lehrstuhl für Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Seit 2024 ist er Sprecher der BAM.

Julia Enxing ist Professorin für Fundamentaltheologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Sie ist 2. Vorsitzende von AGENDA – Forum katholischer Theologinnen e. V. und Redaktionsmitglied von feinschwarz.net.
[1] Vgl. Julia Enxing/Martina Bär: Als Frau in der Wissenschaft, online unter: https://www.feinschwarz.net/als-frau-in-der-wissenschaft/. (abgerufen am 27.02.2025)
[2] Bei Interesse sei auf die Positionspapiere der BAM verwiesen: https://www.katholische-theologie.info/zusammenschlüsse/selbstdarstellungen-der-zusammenschlüsse/bundeskonferenz-der-wiss-assistenten-innen. (abgerufen am 27.02.2025)
[3] Macht und Verantwortung. Empfehlung der 38. HRK-Mitgliederversammlung am 14.5.2024, unter: https://www.hrk.de/positionen/beschluss/detail/macht-und-verantwortung/. (abgerufen am 27.02.2025)
[4] Macht und Verantwortung: HRK verabschiedet Empfehlung zu Maßnahmen gegen Machtmissbrauch, 15.5.2024, unter: https://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/macht-und-verantwortung-hrk-verabschiedet-empfehlung-zu-massnahmen-gegen-machtmissbrauch-5047/. (abgerufen am 27.02.2025)
Beitragsbild: Robert Anasch, unsplash.com