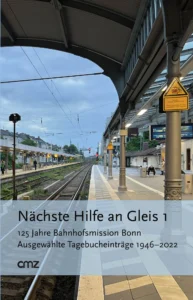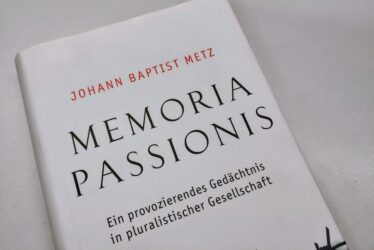35 Jahre war Gerhard Brose evangelischer Gemeindepfarrer in Bornheim, einer kleinen Stadt nördlich von Bonn. 2024 übernahm er, nach seiner Pensionierung, ehrenamtlich die Leitung der Bahnhofsmission Bonn. Ein Sozialbericht zum Beginn der Reisesaison aus der ehemaligen Bundeshauptstadt.
2024 feierten wir „125 Jahre Bahnhofsmission Bonn“. Ziel der Arbeit damals war es, junge Frauen, die vom Land kamen, um in der Stadt nach Arbeit zu suchen, davor zu bewahren, dass sie in die Hände von Zuhältern gerieten. Mit der Zeit änderte sich der Schwerpunkt der Arbeit der Bahnhofsmission: Die Reisehilfen wurden zur zentralen Aufgabe. Wer bei einer Reise zum Beispiel bei einem Bahnsteigwechsel oder beim Transport schwerer Koffer Hilfe brauchte, konnte sich an die Bahnhofsmission wenden.
In den Jahren 1939 – 1945 war die Arbeit der Bahnhofsmission verboten. Nach dem Krieg gab es eine weitere Veränderung: immer häufiger suchten Obdachlose, Drogenabhängige und auch Menschen mit psychischen Problemen bei uns Hilfe, neuerdings kommen zu uns auch Menschen, die nur über eine kleine Rente verfügen.
Die Differenz zur Gemeindearbeit
Mit den Menschen, die den Gastraum der Bahnhofsmission aufsuchen, hatte ich in meiner Gemeindearbeit wenig zu tun. Meine Arbeit war geprägt von Taufen, Beerdigungen und Hochzeiten, von der Konfirmandenarbeit und von Schulgottesdiensten an den drei Grundschulen und natürlich von der Vorbereitung des sonntäglichen Gottesdienstes. Als ich in Bornheim anfing, gab es nur eine angemietete Pfarrwohnung: Es gab keine Kirche, kein Gemeindezentrum, der Konfirmandenunterricht fand im Wohnzimmer statt. Kirche mit Gemeindezentrum, Orgel, Glockenturm, alles das wurde erst mit der Zeit realisiert.
Zentral für meine Arbeit war: Ich musste die Gemeindeglieder aufsuchen. Ab dem 70. Geburtstag besuchte ich die Gemeindeglieder. Diese Besuche waren wichtig, weil ich auch die Angehörigen kennenlernte. Auch ganz normale Hausbesuche füllten den Terminkalender. Da ich zu Beginn meiner Tätigkeit kein Arbeitszimmer hatte, fuhr ich zu den Kasualgesprächen zu den Gemeindegliedern hin. Ein wichtiges Mittel, mit den Gemeindegliedern in Kontakt zu kommen, waren die Schulgottesdienste. In den sechs Orten meines Gemeindebezirks gab es drei Grundschulen. Da die Kirche nicht fußläufig zu erreichen war, trafen wir uns einmal im Monat zum Schulgottesdienst in der Schule. So konnte ich da auch Werbung machen für die Familiengottesdienste und für die Spielwoche in den Sommerferien, später dann auch für den Kinderchor, für Posaunenchor und für die Gitarrengruppe.
Das Diakoniedefizit der Gemeinde
In der Regel waren die Gemeindeglieder gut situiert, waren dem bürgerlichen Milieu zuzurechnen. Die kirchenmusikalischen Angebote fanden bald große Resonanz, ebenso das Angebot der Erwachsenenbildung. Was nicht vorkam, war die diakonische Arbeit. Da aus rechtlichen Gründen zu Beginn meiner Tätigkeit das Diakonische Werk für Bornheim nicht zuständig war, gab es dort keine Diakonie. Der Anstoß für die Einstellung einer Sozialarbeiterin war der Anruf eines Familienvaters: Die Tochter war gerade geboren, und seine Frau lag mit hohem Fieber und einer Lungenentzündung im Bett. Für mich stellte sich die Frage: Wo sind wir als Gemeinde in solchen Notfällen präsent? Es wurde zwar in jedem Gottesdienst für die diakonische Aufgabe der Gemeinde gesammelt und es gab auch eine große Diakonie-Rücklage, es war Geld da, aber diakonische Hilfe gab es nicht. Im Laufe der Jahre gelang es, eine Sozialberatung aufzubauen und eine ökumenische Lebensmittelausgabe zu organisieren.
Und trotzdem wird in der öffentlichen Wahrnehmung selbst bei Gemeindegliedern die diakonische Arbeit nicht direkt mit der Kirchengemeinde in Verbindung gebracht. Für viele ist Diakonie nicht Kirche, der Zusammenhang wird nicht gesehen, auch nicht, wenn vor Ort in der Kirchengemeinde diakonische Hilfe angeboten wird.
Unsere Arbeit
In der Gemeinde musste ich die Menschen aufsuchen. Im Predigerseminar nannte man das die „Geh-Struktur“ der Gemeindearbeit. In der Bahnhofsmission kommen die Menschen von alleine. Die Arbeit dort wird durch Ehrenamtliche getragen. 33 Ehrenamtliche versuchen in Schichten, den Gästen Hilfe zu vermitteln. Die erste Schicht geht von 11.00 – 14.00 Uhr, die zweite von 14.00 – 17.00 Uhr, auch samstags und sonntags. Zur Zeit versuchen wir, auch Abendschichten von 17.00 – 19.00 einzuführen. Das erste Ziel unserer Arbeit ist: Jeder Mensch, der zu uns kommt, wird als Gast behandelt. Das erste Getränk ist umsonst, meistens ist das eine Tasse Kaffee, dazu wird Gebäck gereicht. Das zweite und weitere Getränke kosten dann 0,30 €.
Das zweite Ziel ist, Hilfe zu vermitteln, die Gäste auf das soziale Netz aufmerksam zu machen, das es in Bonn gibt. Fragen, mit denen wir oft konfrontiert sind, lauten: Wo kann ich übernachten, wo kann ich duschen, wo kann ich meine Sachen waschen lassen, wo bekomme ich etwas zu essen, wo bekomme ich Kleidung? Diese Hilfen zu vermitteln, macht den größten Teil unserer Arbeit aus. Wenn man das Wort „Bahnhofsmission“ hört, dann denkt man leicht, die wollen die Gäste missionieren, einfangen. Und wird das nicht sogar in der Bibel erzählt? In der Geschichte vom Fischzug des Petrus da wirft Petrus, nachdem er eine ganze Nacht vergeblich gefischt hat, noch einmal das Netz aus, weil Jesus ihn dazu auffordert. Wider Erwarten füllen sich die Netze, so dass sie fast reißen. Für einen Fischer ist der Anblick eines Netzes voller zappelnder Fische ein wunderschöner Anblick, während die Fische sicherlich anderer Meinung sind.
Nun, das Netz, das wir in Bonn auf Gleis 1 auswerfen, hat nicht das Ziel, Menschen einzufangen, sondern aufzufangen, den Menschen Halt zu geben. Für Obdachlose ist unser Gastraum ein Ort, wo sie sich sicher fühlen können. Hier klaut keiner das Wenige, das sie haben, der Schlafsack ist sicher. Und sie werden nicht über Defizite definiert. Menschen in Substitutionprogrammen kommen gerne zu uns, weil der Besuch ihrem Tag Struktur gibt und ein Stück Normalität. Menschen mit psychischen Problemen finden Ruhe, hier können sie einfach sitzen und auch mit ihrem imaginären Gegenüber diskutieren und keiner stört sie dabei.
Auch Menschen, die eine Wohnung haben, Menschen mit kleiner Rente kommen zu uns, weil sie sich hier den Kaffee leisten können. Und wenn es manchmal zu dem Kaffee auch ein Stück Kuchen gibt, kommt sogar ein bisschen Kaffeehaus-Atmosphäre auf. Am Tag der Bahnhofsmission, zu Ostern und Weihnachten wird auch gefeiert, mit Chor oder Posaunenchor oder anderem musikalischem Programm. Solche Feste sind wichtig, weil viele niemanden haben, der mit ihnen feiern würde.
Viele individuelle Schicksale
Doch die Einteilung der Gäste in ein Raster darf nicht den Blick auf ihre Individualität verstellen. Eine Frau erzählte mir, dass sie im Wald übernachten würde, in einem Zelt, auch im Winter, und sie würde nichts vermissen. Es wäre für sie überaus beglückend, morgens mit dem Gesang der Vögel aufzuwachsen. Ein Rentner erzählte mit, er habe nicht viel, doch er habe gelernt, mit wenig gut zu eben. Einige der Gäste, die zu uns kommen, haben sich tatsächlich für ein einfaches Leben entschieden.
Und im Gastraum wird auch diskutiert über Politik und Religion. Bei einer der monatlichen Andachten sagte ein Gast, es war in der Karwoche, „…und der Jesus ist wirklich auferstanden.“ Dieser Gast war körperlich und seelisch in keinem guten Zustand. Doch in diesem Bekenntnis war er auf einmal ganz wach und stark, als wäre dieses Bekenntnis tatsächlich der einzige Halt, den er im Leben noch hat. Solche elementaren Begegnungen in Sachen Glauben, solche Bekenntnisse zum Auferstandenen habe ich in der Gemeindearbeit nicht erlebt.
Begegnungen in Sachen Glauben
Einige der Gäste gehen regelmäßig in die Stadtbibliothek, der Generalanzeiger, die örtliche Tageszeitung, der bei uns ausliegt, wird sehr gründlich gelesen. Ein Pärchen geht zu Vorträgen der Gesellschaft für jüdisch-christliche Zusammenarbeit. Ein Gast kam immer und sagte: Ich hätte gerne eine Tasse Kaffee und ein Gespräch.
Doch es kommt auch zu anderen Begegnungen. An einem Sonntagmorgen steht auf einmal ein Gast im Gastraum, nur bekleidet mit einer Unterhose. Oder eine Frau saß im Winter, es war bitterkalt, weinend vor der Bahnhofsmission und ließ sich nicht bewegen, in den Gastraum kommen. Sie kam aus Polen und sprach kaum deutsch. Telefonisch stellten wir eine Verbindung zu dem Priester der polnischen Gemeinde her. Schließlich setzte sie sich in den Gastraum. Wir organisierten für sie eine Übernachtung. Alles schien erst einmal geordnet. Da stand sie auf und stieg einfach in den nächsten Zug ein und war weg. Manchmal sind Gäste auch aggressiv. Und manchmal müssen wir dann die Bundespolizei zu Hilfe rufen.
Das normale Leben: für manche ein Traum
Deshalb müssen die Schichten immer mit zwei Ehrenamtlichen besetzt sein, damit im Notfall einer Hilfe holen kann. Doch in der Regel sind die Gäste sehr dankbar. Bei einer anonymen Befragung schrieb einer der Gäste: die Bahnhofsmission ist meine Familie. Wer ehrenamtlich bei der Bahnhofsmission mitarbeiten möchte, wird in zwei Grundkursen geschult. Zur Schulung gehört auch ein Deeskalationstraining.
In der Gemeindearbeit habe ich viele Menschen erlebt, die mit ihren Selbstidealen zu kämpfen hatten, denen auch das normale Leben nicht gut genug war. In der Bahnhofsmission wäre für viele Gäste das normale Leben ein Traum.
______________________________________

Publikation:
Nächste Hilfe am Gleis 1. 125 Jahre Bahnhofsmission Bonn.
Ausgewählte Tagebucheinträge 1946-2022, Rheinbach 2024