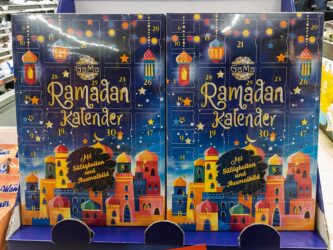Janine Joshi und Kornelia Freier über ein Projekt, in dem Schüler:innen der Natur eine Stimme verleihen.
Der Klimawandel wird nicht kommen, sondern wir sind bereits mittendrin. Mitten drin ist auch „Reli fürs Klima“, ein handlungsorientiertes Konzept für den Religionsunterricht. Die Kooperation zwischen Brot für die Welt und der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz verbindet Klimaschutz mit religiöser Bildung und fördert ein nachhaltiges und solidarisches Weltverhältnis. Das Konzept möchte Schüler:innen in den Austausch bringen mit Menschen aus dem Globalen Süden, die wirkungsvolle Ansätze gegen den Klimawandel entwickeln, so dass sie von ihnen lernen können. Darüber hinaus steht die Förderung der Handlungskompetenz, die Stärkung der Selbstwirksamkeit und der Resilienz im Vordergrund. Wir ermöglichen ihnen, ihre Stimme einzusetzen.
Aktuell geben Schüler:innen der Natur eine Stimme. Sie versetzen sich in die Lage der Natur. „Ich glaube die Natur ist so richtig sauer auf uns Menschen, wir mauern sie zu und benutzen sie, wie wir wollen. Wir Menschen treten gegen einen Baum, brechen Zweige ab und der Baum kann nicht zurückschlagen“ erzählt eine Siebtklässlerin.
Schüler:innen in den Austausch bringen mit Menschen, die wirksame Konzepte gegen den Klimawandel entwickeln
Die Vorstellung, dass die Natur nicht Objekt menschlicher Nutzung, sondern Subjekt eigener Rechte sein kann, findet weltweit zunehmend Gehör. In verschiedenen Teilen der Welt, insbesondere in indigenen Kosmovisionen, wird die Natur nicht als „etwas“, sondern als „jemand“ betrachtet. Der rechtliche Diskurs beginnt, diese Perspektive aufzunehmen – etwa durch die Anerkennung von Flüssen als Rechtssubjekte.
die Natur nicht als „etwas“, sondern als „jemand“ betrachtet
So kämpft das Kukama-Volk in Peru schon seit langem für die Rechte des Marañón-Flusses. Anfang Mai konnten 50 Schüler:innen im Rahmen von Reli fürs Klima bei Brot für die Welt direkt einen Austausch mit Celia Fasabi, einer Vertreterin der Federación de Mujeres Indígenas Kukama aus Peru, und Miriam Torres, Geschäftsführerin der peruanischen Nichtregierungs- und Menschenrechtsorganisation Forum Solidaridad Perú (FSP), erleben. Im Gespräch erzählte Celia Fasabi mehr über die Beziehung der Kukama zur Natur. Sie sagte sinngemäß:
Als indigene Völker sehen wir die Natur als einen Teil von uns. Wir sehen unseren Fluss, der Teil von uns ist, es ist so, als ob wir als Frauen Kinder haben und wir ernähren sie von unseren Brüsten, so ernährt uns die Erde, weil wir diejenigen sind, die auf dem Land arbeiten, und der Marañón-Fluss ist wie ein Vater. Wir ernähren uns von der Natur und wir ernähren auch sie, wir kümmern uns, schützen den Fluss und seine Nebenflüsse.
Für die Kukama ist der Marañón-Fluss mehr als ein Gewässer – er ist Vater, Lebensquelle und spirituelles Wesen. In ihrer Kosmovision sind Mensch und Natur untrennbar verbunden. Die Vorfahren leben im Fluss weiter in Städten unter der Wasseroberfläche, Schamanen kommunizieren mit den Geistern des Wassers, und der Fluss wird als lebendig, empfindsam und heilend erfahren. Diese spirituelle Verbindung geht über eine funktionale Beziehung hinaus: Der Fluss nährt, heilt und lehrt – und wird zugleich als verletzlich empfunden, wenn er durch Ölunfälle oder Plastikmüll leidet. Eingriffe wie das Ausbaggern des Flusses bedrohen daher nicht nur ihre Lebensgrundlage, sondern auch ihre spirituelle Welt.
Anerkennung des Marañón-Flusses als Rechtssubjekt
2021 erreichten die Kukama-Frauen einen historischen Erfolg: In einem richtungsweisenden Urteil erkannte ein peruanisches Gericht dem Marañón-Fluss und seinen Zuflüssen den Status als Rechtssubjekt zu. Der Fluss hat nun das Recht, frei zu fließen, vor Verschmutzung geschützt zu werden, seine biologischen Zyklen zu bewahren und seine Biodiversität zu erhalten. Die Frauen wurden als offizielle Vertreterinnen des Flusses benannt – eine rechtliche Umsetzung der spirituellen Verbindung.
Diese Entscheidung ist juristisch innovativ, da die peruanische Verfassung die Natur noch nicht explizit als Subjekt von Rechten anerkennt. Doch sie nimmt Bezug auf Präzedenzfälle in Ecuador und Bolivien, wo entsprechende Rechte bereits verfassungsrechtlich verankert sind, sowie auf internationale Entwicklungen wie den neuseeländischen Te Awa Tupua Act.
Ethik des Genug: eine Haltung, die Suffizienz, Respekt und kooperative Koexistenz in den Vordergrund stellt
Die Anerkennung der Rechte der Natur verweist auf eine ethische Grundhaltung, die sich fundamental von der Logik unbegrenzten Wachstums unterscheidet. Sie folgt der „Ethik des Genug“ – einer Haltung, die Suffizienz, Respekt und kooperative Koexistenz in den Vordergrund stellt. Die Kukama kritisieren die moderne Welt nicht nur wegen der Umweltzerstörung, sondern auch wegen ihrer Entfremdung von der Natur. Für sie bedeutet Entwicklung nicht Industrialisierung, sondern das gute Leben – ein Leben in Balance mit der Natur.
Das Konzept des „Buen Vivir“, wie es in Ecuador und Bolivien verfassungsrechtlich verankert wurde, inspiriert weltweit eine neue Sichtweise auf Naturrechte. Es erkennt die Erde – Pacha Mama – als lebendiges Wesen mit eigenen Rechten an. Dieses Denken fordert westliche Kategorien heraus, in denen Recht und Natur, Subjekt und Objekt, Geist und Körper strikt getrennt sind.
Die Erfahrungen der Kukama zeigen: Ein alternativer Zugang zum Leben, zur Natur und zum Recht ist nicht nur denkbar, sondern existent – und überlebensnotwendig.
ermöglicht es den Jugendlichen, spirituelle und rechtliche Konzepte von Natur aus erster Hand kennenzulernen
Dieser Dialog zwischen den Vertreterinnen der Kukama und den Schüler:innen fördert nicht nur globale Solidarität und kulturelles Verständnis, sondern ermöglicht es den Jugendlichen auch, spirituelle und rechtliche Konzepte von Natur aus erster Hand kennenzulernen. Die Auseinandersetzung mit den Lebensrealitäten der Kukama vertieft das Verständnis für Klimagerechtigkeit und motiviert zu eigenem Engagement.
So wie die Schüler:innen in ihre eigene Weltsicht die Kosmovision der Kukama einziehen lassen, so können wir auch unsere eurozentristische Sicht auf Schöpfung und des Verhältnisses des Menschen zur Natur weiten. In Schöpfungstheologien wird betont, dass alles Geschaffene eine Würde besitzt. Die spirituelle Bedeutung des Marañón-Flusses für die Kukama fordert Christinnen und Christen heraus, den Begriff der Imago Dei nicht nur auf den Menschen anzuwenden, sondern auf die gesamte Schöpfung auszudehnen. Wenn Gott alles Leben geschaffen hat, wie können wir dann Recht nur für den Menschen denken?
In Schöpfungstheologien wird betont, dass alles Geschaffene eine Würde besitzt.
Zugleich ruft die Geschichte der Kukama-Frauen zur ökologischen Umkehr auf. Der Fluss wird als leidendes Geschöpf beschrieben – verletzt durch menschliches Handeln. In ihm spiegelt sich der „stöhnende Kosmos“ (Röm 8,22), dessen Erlösung untrennbar mit der Gerechtigkeit für alle Lebewesen verbunden ist. „Reli fürs Klima“ greift diese theologische Tiefe auf und begleitet Religionslehrkräfte langfristig bei der Umsetzung im Unterricht.
Darüber hinaus werden bei Reli fürs Klima weitere theologische Perspektiven eingebunden. Am Beispiel der Kirchenwälder in Äthiopien reflektieren Schüler:innen die spirituelle Dimension heiliger Orte sowie die Bedeutung von Bäumen in der Bibel. Auch das Konzept des „Paradising“ findet Eingang in das Bildungsmaterial „Kostbares Nass – Wasser in Bangladesch“, das Wasser nicht nur als lebensnotwendige Ressource, sondern auch als geistliche Realität begreifbar macht.
enge Zusammenarbeit mit Brot für die Welt und Einbezug von Projekten aus dem globalen Süden
Die Herausforderung, der globalen Dimension der Klimakrise pädagogisch gerecht zu werden, wird dabei explizit thematisiert. Der zentrale didaktische Impuls liegt im Perspektivwechsel: Durch die enge Zusammenarbeit mit Brot für die Welt und den Einbezug von Projekten aus dem Globalen Süden – wie etwa den Kirchenwäldern in Äthiopien – erhalten Schüler:innen authentische Einblicke in Lebensrealitäten, die unmittelbar vom Klimawandel betroffen sind.
Zugleich wird bewusst vermieden, Perspektiven aus dem Globalen Süden als defizitär oder ohnmächtig darzustellen. Stattdessen werden Menschen in diesen Regionen als aktive Gestalter:innen ihrer Umwelt präsentiert, die mit kreativen und gemeinschaftlichen Lösungen auf ökologische Herausforderungen reagieren. Diese positive Darstellung wirkt emotional entlastend, stärkt die globale Empathie und vermeidet paternalistische Narrative. Die Schüler:innen erleben Menschen aus dem Globalen Süden als Vorbilder – als mutige Akteur:innen, die Veränderung ermöglichen. Dies motiviert sie, selbst aktiv zu werden: So konnten beispielsweise Schulklassen von uns dabei unterstützt werden, über 4.000 Bäume in Kirchenwäldern in Brandenburg zu pflanzen.
Menschen in diesen Regionen als aktive Gestalter:innen ihrer Umwelt mit kreativen und gemeinschaftlichen Lösungen
Die pädagogische Auseinandersetzung greift dabei gezielt die Spannung zwischen geografischer Distanz und gefühlter Einflusslosigkeit auf. Im Zentrum steht das Konzept des „Handabdrucks“: Während der ökologische Fußabdruck die individuellen Belastungen für die Umwelt misst, verweist der Handabdruck auf das aktive Gestalten gesellschaftlicher Strukturen. Dadurch wird deutlich, dass wir nicht nur lokal, sondern auch global Einfluss nehmen können – etwa durch politische Bildung, zivilgesellschaftliches Engagement oder nachhaltiges Handeln.
In Projekten, bei Gesprächen mit Politiker:innen im Abgeordnetenhaus oder beim Einreichen eigener Petitionen erleben Schüler:innen, dass ihre Stimmen gehört werden.
Schüler:innen erfahren, dass Partizipation auf vielen Ebenen möglich ist – von der eigenen Schule bis hin zur globalen Zivilgesellschaft. Sie erheben ihre Stimmen für die Natur und für mehr Klimagerechtigkeit. In Projekten, bei Gesprächen mit Politiker:innen im Abgeordnetenhaus oder beim Einreichen eigener Petitionen erleben sie, dass ihre Stimmen gehört werden, dass sie ernst genommen werden – und dass ihr Handeln Wirkung zeigt. Einfluss für das Klima entsteht so nicht nur durch symbolische Gesten, sondern durch konkrete Veränderungen: durch das Pflanzen von Bäumen, das Umgestalten von Schulhöfen, die Nutzung von (Regen-)Wasser und viele weitere Maßnahmen, die Verantwortung und Hoffnung miteinander verbinden.


Kornelia Freier ist Kultur- und Afrikawissenschaftlerin, Religionspädagogin, Bildungsreferentin bei Brot für die Welt.
Bild: Hermann Bredehorst / Brot für die Welt
Bild: Kathrin Harms/Brot für die Welt