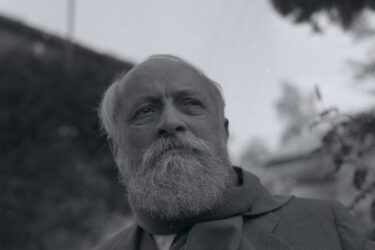Einige Anmerkungen zur Heiligsprechung von Carlo Acutis am nächsten Sonntag von P. Christian M. Rutishauser SJ.
Die Heiligsprechung des mit 15 Jahren an Leukämie verstorbenen Carlo Acutis musste wegen des Ablebens von Papst Franziskus verschoben werden. Der jugendliche Norditaliener, dessen sterbliche Überreste in Assisi liegen, wo er 2020 auch seliggesprochen wurde, wird bereits breit als «Cyber-Apostel» und «heiliger Influencer» verehrt.
Aus der Millenial-Generation.
Er steht für die Millennial-Generation, die einen Grossteil ihres Lebens in der digitalen Welt verbringt. Carlo Acutis hat als frommer Computerfreak den katholischen Glauben insbesondere im Internet bezeugt. Seine Verbindung von Hightech mit dem zentralsten Sakrament der katholischen Kirche, der Heiligen Messe, macht ihn für die Verantwortlichen in der Kirche besonders interessant.
Bei der breiten Bevölkerung dürfte der Anklang indes nicht nur so gross sein, weil er die altehrwürdige Wahrheit des Katholizismus mit digitaler Moderne verbindet. Er präsentiert das komplexe Symbolgeschehen und Ereignis der Eucharistiefeier auf einfache Art. Sein wortwörtliches und naturalistisches Verständnis ist zugänglich, zumal es auf ein spektakuläres Messwunder reduziert wird. Acutis jugendlicher Sammeltrieb hat ihn nämlich nicht zu Fussballstars oder anderen Helden geführt. Vielmehr hat er 2002 begonnen, eine Liste mit über 130 Hostienwunder zusammenzustellen und dokumentierend im Internet zu verbreiten.
Ein komplexes Symbolgeschehen wird einfach präsentiert.
Dabei präsentiert er viele mittelalterliche Wunderlegenden: Brot und Wein in Leib und Blut Christi verwandelt, werden von bösen Feinden mit physischer Gewalt vergebens zu vernichten versucht. Hostien werden geschändet, doch sie erweisen sich als unzerstörbar. Aus ihnen fliesst Blut zum Zeugnis, dass sie Leib Christi sind, oder sie verwandeln sich in eine Realpräsenz des Auferstandenen, indem sie leuchten und fliegen.
Hostienwundernarrative
Solche Legenden sind besonders ab den 13. Jahrhundert verbreitet worden, als die Kirche sich genötigt sah, das Wandlungswunder der Messe durch die Transsubstantiationslehre rationalistisch zu erklären. Der dramatische Kampf zwischen Gut und Böse, der diesen Hostienfrevelgeschichten eingeschrieben ist, wie auch das magische Verständnis einer Speise, die sich in göttliche Nahrung verwandelt, scheint nicht nur die Menschen damals angesprochen zu haben.
Unkritisch und unreflektiert dürften die Verantwortlichen der Kirche damit heute aus zwei Gründen nicht umgehen. Zum einen darf die Messe nicht wieder auf einen Hokuspokus verkürzt werden.
Magische Bedürfnisse
Die Kirche veräusserte ihr kostbares Gut und würde es einem magischen Bedürfnis anpassen. Die Eucharistie ist eine vielschichtige Dankesfeier für die Selbsthingabe Jesu, die christlich-kollektive Identität stiftet, indem alle Feiernden zu einem Leib Christi zusammenwachsen sollen. Sie ist heiliges Mahl und unblutiges Opfer zugleich, eingebettet in Wortliturgie mit Predigt und Gebet, damit eine Lerngemeinschaft entsteht. Die Feiernden sollen befähigt werden, in der Nachfolge Christi von der Frohbotschaft Zeugnis zu geben – mit eigenem Blut und ohne das Blut der anderen zu vergiessen.
Gewaltexzesse
Die Hostienwundernarrative haben jedoch in der Geschichte immer wieder zu Gewaltexzessen geführt. Daran muss zweitens erinnert werden, wenn Acutis zur Ehre der Altäre erhoben wird. Frauen, als Hexen stigmatisiert, ketzerischen Protestanten und im Mittelalter den Juden wurden die Hostienschändungen vorgeworfen. Gerade das Wunder von Paris 1290, wo ein Jude eine Hostie gestohlen und mit Nägeln malträtiert haben soll, diese dann aber wundersam schwebend entschwunden sei, hat Schule gemacht. Zum Beispiel 1370 in Brüssel, wo auch Juden Hostien mit Messer bestochen hätten. Diese hätte aber zu bluten begonnen.
Die Wundererzählungen, die Carlo Acutis gesammelt hat, sind historisch gesehen oft Teil des christlichen Antijudaismus. Sie aktualisieren den Gottesmordvorwurf: So wie die Juden einst Christus getötet hätten, würden sie ihn nun in der Hostie wieder töten, doch die Realpräsenz Christi sei stärker. In Brüssel wurden nach dem Hostienwunder an die 20 Juden ermordet und die Gemeinde vertrieben. Diese Wundererzählungen waren oft Motivation für Pogrome und es floss jüdisches Blut.
Nicht antisemitisch, sondern a-semitisch.
Carlo Acutis hatte Hostienwunder zu einer Internet-Ausstellung aufbereitet. Auch heute informiert die dazu geschaffene Homepage detailliert. Und als physische Ausstellung sind seine gesammelten Wunder schon auf allen fünf Kontinenten in über 10’000 Pfarreien gezeigt worden. Die Erzählungen sind dabei neutralisiert. So heisst es bei Acutis zum Beispiel: «Im Jahre 1290 entwendete ein Ungläubiger, der die christliche Religion verachtete und die Gegenwart Christi in der Eucharistie leugnete, eine Hostie, um sie zu entweihen.» Der Text ist also nicht direkt antijudaistisch bzw. antisemitisch, sondern a-semitisch, von Juden rein gemacht. Dennoch verletzen die Erzählungen die kollektive, jüdische Erinnerung, denn die Verfolgung durch Christen, die mit den eucharistischen Wundern legitimiert wurde, ist fest im Geschichtsbewusstsein des jüdischen Volkes verankert.
Wenn Kritiker schreiben, der Antijudaismus würde in der Frömmigkeit von Carlo Acutis Urständ feiern, ist dies übertrieben. Dem jugendlichen Heiligen mögen die Zusammenhänge nicht voll bewusst gewesen sein. Auch der Antisemitismus heute speist sich nicht direkt aus Acutis Frömmigkeit.
Es ist Aufgabe der Kirche aufzuklären.
Dennoch ist es die Aufgabe der Kirche, die Gläubigen aufzuklären und ihnen den historischen Kontext dieser Wundergeschichten bewusst zu machen. Zu leicht wird latenter Antijudaismus wieder aktiviert. Er mutiert dann und prägt Denken und Handeln unbewusst, wie dies das Berliner Forschungsprojekt «Christliche Signaturen des zeitgenössischen Antisemitismus» herausgearbeitet hat. Zudem sollten die Dialogverantwortlichen der Kirche proaktiv auf die jüdischen Partner zugehen. Die christliche Glaubensfreude an der Heiligsprechung von Acutis darf nicht mit Kollateralschäden für die Juden einhergehen.
Dieses Muster, das sich von der patristischen Theologie über die Kreuzzugszeit und Reformation bis in die Gegenwart hinein zeigt – man denke nur an die Selig- und Heiligsprechung von Edith Stein 1987 bzw. 1998, die bei Juden starke Irritation ausgelöst hat, da die Nazis sie als Jüdin und nicht als Christin umgebracht haben – , gilt es zu vermeiden. Dialogkompetenz besteht darin, ohne den eigene Glaubensüberzeugung zu schmälern und die Differenz zu verleugnen, Sensibilität für den anderen zu zeigen.
_______________

Beitragsbild: Rainer Bucher
Bild des Grabes von Carlo Acutis: Dobroš; CC BY-SA 4.0,