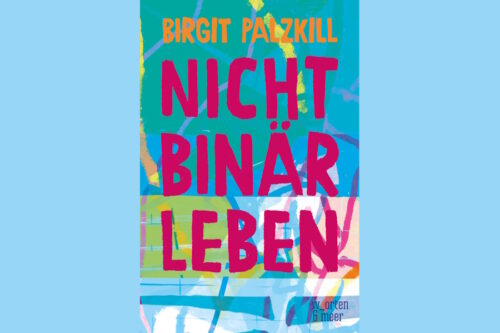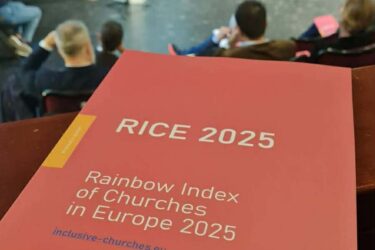Das Buch von Birgit Palzkill versammelt Erfahrungsberichte von nicht binär lebenden Menschen. Silke-Luca Obenauer stellt es vor.
In den letzten Jahren haben nicht binär lebende Menschen zunehmend an Sichtbarkeit gewonnen: Kim de l’Horizon erhielt 2022 für „Blutbuch“ den Deutschen wie den Schweizer Buchpreis, Nemo gewann 2024 mit dem Lied „The Code“ über das eigene Coming-Out den ESC. Unter den 125 katholischen Personen, die sich im Rahmen von #outinchurch im Januar 2022 als lesbisch, schwul, bisexuell, transident, intergeschlechtlich, queer geoutet haben, sind nicht binäre Menschen ebenso wie unter ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden in der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und auch im eigenen Umfeld begegnen Menschen zunehmend Jugendlichen und Erwachsenen, die sich nicht in die Kategorien von „Mann“ und „Frau“ einordnen. Obwohl Nichtbinarität zunehmend sichtbarer wird, sind aufs Gesamte gesehen nicht binäre Lebenswelten nach wie vor wenig bekannt, sind wir alle doch in einer Gesellschaft aufgewachsen, die zutiefst von einer binären Geschlechterordnung geprägt ist, also der Vorstellung, dass es nur Mann und Frau gibt.
Obwohl Nichtbinarität sichtbarer wird, sind nicht binäre Lebenswelten nach wie vor wenig bekannt.
Hier setzt das Buch von Dr. Birgit Palzkill, selbst nicht binär lebend, an. Um nicht binäre Lebensweisen von innen her aufzuschließen und begreifbarer zu machen, kommen nicht binäre Personen selbst zu Wort. Dafür hat Palzkill 17 Personen im Alter von 20 bis 70 Jahren interviewt: Sie erzählen von ihrem Weg, ihren Freiheiten sowie den Herausforderungen, in einer Gesellschaft zu leben, die nur zwei Geschlechter kennt. Ihre Erzählungen sind in 13 thematischen Kapiteln zusammengefasst, Originalzitate und erläuternde Abschnitte ergänzen sich. Außerdem bietet Palzkill auf der Grundlage je mehrerer Interviews vier Lebensgeschichten. So können Lesende einen lebendigen und originalen Eindruck in die Vielfalt nicht binären Lebens gewinnen. Um die Anonymität der Interviewten zu gewährleisten, haben sie sich je ein Pseudonym gewählt. Methodisch konnte Palzkill auf eigene Erfahrungen mit einer Interviewstudie zu lesbischem Leben zurückgreifen, die vor mehr als 30 Jahren die Grundlage für die Promotion in Soziologie bildete, zudem auf jahrzehntelange Beschäftigung mit Fragen rund um das Thema Geschlecht.
Inhaltlich spannt Birgit Palzkill in den 13 Kapiteln einen weiten Bogen: vom langen Weg, sich als nicht binär zu begreifen, über Coming-Out, Freiheiten nicht binären Lebens, Herausforderungen einer binären Welt mit ihren Kategorien und Sprachprägungen bis hin zu rechtlichen Aspekten und Anregungen für eine geschlechterinklusive Praxis.
Herausforderungen einer binären Welt mit ihren Kategorien und Sprachprägungen
Neben ganz unterschiedlichen Einblicken in die einzelnen Aspekte wird deutlich: Es gibt nicht den einen nicht binären Lebensweg oder Menschen. Nicht binäre Menschen sind vielfältig, sie tragen männliche, weibliche oder geschlechtsneutrale Vornamen, nutzen unterschiedliche Pronomen, zeigen unterschiedliche Aussehen (z.B. eher männlich oder weiblich assoziiert, androgyn), leben in unterschiedlichen Beziehungskonstellationen, verwenden unter dem Oberbegriff „nicht binär“ unterschiedliche Selbstbezeichnungen für ihre Geschlechtsidentität. Gemeinsam haben sie letztlich nur, dass sie sich keiner der beiden Geschlechterkategorien Mann/Frau zuordnen und dass es sich falsch anfühlt, so einsortiert zu werden. Somit wird deutlich: „nicht binär“ ist ein „Schirmbegriff“, „keine Bezeichnung für eine feste neue Geschlechterkategorie“ (90f.).
Nicht binäre Menschen sind vielfältig.
Eindrücklich veranschaulicht Palzkill, wie es sich auswirkt, wenn Menschen immer mehr zu sich und ihrem Leben finden: „Nicht binär zu sein bedeutet für mich ganz viel Freiheit, frei zu sein und selber bestimmen zu können, wie ich sein möchte.“ (64) „Herauszufinden, was der eigenen Person entspricht, ohne sich darum zu scheren, was gesellschaftlich als ‚weiblich‘ oder als ‚männlich‘ angesehen wird, führt zu größerer Selbstgewissheit und stärkt das Selbstbewusstsein.“ (64f.) Immer mehr wächst in diesem Prozess der eigenen Selbstbewusstwerdung auch das Erkennen, dass nicht sie selbst falsch sind, sondern dass eine Ordnung zu kurz greift, die nur Männer und Frauen kennt.
… das Erkennen, dass nicht sie selbst falsch sind, sondern dass eine Ordnung zu kurz greift, die nur Männer und Frauen kennt.
Neben den Freiheiten thematisiert das Buch auch die Herausforderungen nicht binären Lebens. Es geht z.B. um den „täglichen Zwang, sich als Frau oder Mann verorten zu müssen“ (108), in Formularen, beim Kleidungskauf oder Toilettengang. Dazu das stetige Eingeordnetwerden in eine der beiden Kategorien bei Anreden und Anschreiben (Herr/Frau) oder bei der Verwendung der Personalpronomen (er/sie). Hier werden nicht binäre Menschen aufgrund ihres Vornamens oder ihres Äußeren in der Regel entweder als männlich oder als weiblich einsortiert und angesprochen, was ein schales Gefühl zurücklässt. Dass die eindeutige geschlechtliche Zuordnung allgegenwärtig ist, stellt für viele eine Belastung dar. Jede Korrektur einer falschen Einsortierung entspricht je aufs Neue einem Coming-Out, das mit dem Risiko behaftet ist, nicht zu wissen, wie das Gegenüber damit umgeht; und oft ist eine Korrektur schlicht nicht möglich. Hinzu kommt die Sorge vor Übergriffen und Gewalt, die in besonderem Maße diejenigen nicht binären Menschen betrifft, die ein gendernonkonformes Erscheinungsbild haben. „Es ist immer die Frage: Soll ich über dem Radar bleiben oder unter dem Radar fliegen? Ohne Rock und ungeschminkt werde ich als Mann gelesen, dann gibt es kein Problem… aber es ist falsch, das bin ich einfach nicht“. (118)
Jede Korrektur einer falschen Einsortierung entspricht je aufs Neue einem Coming-Out.
Im vorletzten Kapitel bringt Palzkill Anregungen für eine geschlechterinklusive Praxis, die die Existenz von nicht binären Menschen mitdenkt. Angeführt werden z.B. inklusive Begrüßungsformen („Sehr geehrte Anwesende“), das Erfragen von Anrede/Pronomen, die Verwendung genderneutraler Begriffe und Funktionsbeschreibungen sowie das Mitdenken nicht binärer Eltern. Hier finden sich leicht umsetzbare Anregungen, die darauf verzichten, anderen Menschen im Alltag ungefragt ein Geschlecht zuzuweisen und damit möglicherweise falsch zu liegen und sie auszugrenzen. Leitend ist dabei der Grundsatz: „Thematisiere Geschlecht dann und nur dann, wenn es für den Zusammenhang von Bedeutung ist.“ (208) Damit gilt auch: Geschlecht ist unbedingt zu benennen, wenn Benachteiligungen, Diskriminierungen oder Gewalt, die Menschen aufgrund ihres Geschlechts erleben, sichtbar und bearbeitbar gemacht werden sollen.
Es geht um den Menschen in seiner Würde vor Gott.
Die Lektüre dieses Buches, das zum ersten Mal im deutschsprachigen Bereich nicht binäre Menschen selbst zu Wort kommen lässt, ist in vielfacher Hinsicht spannend und erkenntnisreich: um Kontakte mit nicht binären Menschen im eigenen Umfeld möglichst sensibel zu gestalten; als persönlicher Zugang, um über die eigene, wie auch immer definierte Geschlechtlichkeit nachzudenken; um Anregungen zu bekommen, „andere Menschen generell einfach als Menschen zu sehen, Kategorisierungen und Bewertungen zurückzustellen, vielfältige Perspektiven zuzulassen und dem Leben mit Neugier zu begegnen.“ (221) Dies ist m.E. auch ein lohnendes Unterfangen für kirchlich gebundene Menschen, sei es privat als Christenmenschen oder in der Pastoral, damit nicht binäre Menschen sich im kirchlichen Leben mitgedacht und willkommen fühlen. Denn: Es geht „der jesuanischen Botschaft nicht um die Zementierung von Rollen und Klischees, sondern um den Menschen in seiner Würde vor Gott.“ (Dr. Andreas Heek auf feinschwarz.net). Zu dieser jesuanischen Botschaft passt auch die Sehnsucht, von der ich das Buch getragen sehe; die „Sehnsucht nach einer Welt, in der sich jeder Mensch (…) in seinem So-Sein frei entfalten kann.“ (223)
Birgit Palzkill: Nicht binär leben, w_orten & meer, 2024

Dr. Silke-Luca Obenauer, Leitung der Evangelischen Erwachsenenbildung Karlsruhe, mit einem Auftrag für queersensible Bildungsarbeit
Bild: privat