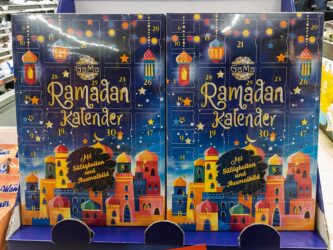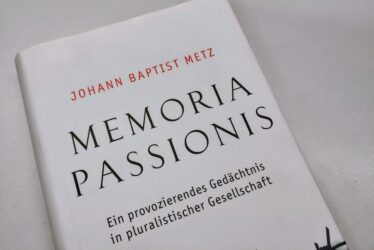Heute sind sie die Mehrzahl im Theologiestudium: die sogenannten Lai:innen. Doch auch hier gilt: aller Anfang ist schwer, wie ein Blick in die jüngere Geschichte zeigt. Ein Beitrag von Lea Torwesten und Miriam Niekämper.
Theologie studiert man wohl selten, um Karriere zu machen. Viele tun es mit der Überzeugung, dass die großen Fragen – nach Gott, nach Sinn, nach Gerechtigkeit – nicht einfach Privatsache sind. Doch auch Idealismus braucht am Ende einen Beruf.
Vor vierzig Jahren war das Risiko größer: Wer nicht Priester werden wollte oder konnte, galt vielerorts als überflüssig. „Ich habe sie nicht gerufen“, kommentierte der Essener Bischof Franz Hengsbach, gegen den inzwischen schwere Missbrauchsvorwürfe erhoben wurden, Mitte der 1980er Jahre die Studienwahl einer jungen Frau. Adressiert waren die Bochumer Theologie-Diplomstudierenden. Die Botschaft war klar: Im kirchlichen Dienst hatten sie keinen Platz. Dieser Satz brannte sich ein – als Chiffre einer Haltung, die Berufung nur anerkennt, wenn sie ins Raster der Weiheämter passt. Und als Erinnerung an Studierende, die sich – gerufen oder nicht – unbeirrt auf den Weg machten.
Drei von ihnen, die Ende der 1970er- und 1980er-Jahre als sogenannte „Laien-Theologen“ studierten, haben uns ihre Geschichten erzählt. Seit Kurzem sind sie alle im Ruhestand. Ein guter Anlass, ihre authentischen Zeugnisse festzuhalten und ihren Mikro-Theologiegeschichten eine Bühne zu geben – und damit auch auf ein Stück Geschichte der Bochumer Fakultät aufmerksam zu machen, die demnächst ihr 60. Jubiläum feiert.
Zwischen Wunsch und Wirklichkeit
Alle drei Interviewten fanden über die Jugendarbeit zur Theologie. Alfred Schweer wollte, wie der Kaplan, mit Jugendlichen arbeiten und Priester werden. Doch schon nach wenigen Tagen im Studienkolleg stellte er fest: „Ich bin hier nicht richtig.“ Die Berufsfrage stellte sich neu, denn es sei „vollkommen klar“ gewesen, dass „man als Nicht-Priester im Bistum keine Chance hat“. Das Theologiestudium setzte er dennoch fort, entschied sich zusätzlich für Psychologie – zunächst in Freiburg, dann wieder in Bochum.
Tobias Fontein hatte Theologie zunächst ausgeschlossen. Erst nach der Begegnung mit einem Pastoralreferenten entschied er sich, diesen Weg ebenfalls einzuschlagen – trotz der klaren Ansage seines Herkunftsbistums Münster, es würden nur einige Diplomtheolog:innen als Übergangslösung aufgrund des momentanen Priestermangels eingestellt. Ein Personalverantwortlicher erklärte ihm, sie müssten ein „zweites Standbein“ haben, da man ihnen keine lebenslange Perspektive bieten und sie nur so „sozialverträglich entlassen“ könne.
Für Elisabeth Sobek-Franz war die Situation als Frau noch schwieriger. Erst im Studium wurde ihr die Hürde richtig bewusst, denn zuvor konnte sie bei Jugendgottesdiensten einfach mitgestalten. Sie erzählt von abweisenden Bemerkungen: „So ein Diplomer will dann sofort einen Schreibtisch, ein Vorzimmer und eine Sekretärin.“ Ein anderer Bistumsverantwortlicher sagte, er habe nichts gegen theologisch gebildete Gärtner.
Theologie als „Luxus in der Lebensbiografie“?
Fontein erinnert sich an das geflügelte Wort: „Wir studieren Theologie als Luxus in der Lebensbiografie.“ Nach dem Abschluss wurde die Perspektivlosigkeit ernst: Bewerbungen blieben oft unbeantwortet. Sobek-Franz überlegte, Gemeindereferentin zu werden, man riet: „Du bist Volltheologin, stell dein Licht nicht unter den Scheffel.“ Sie fragte sich: „Aber wo soll es denn leuchten?!“ Gerne wäre sie Krankenhausseelsorgerin geworden, doch dieser Weg blieb ihr verwehrt. Auch eine Geschlechterungerechtigkeit: ein Kommilitone ließ sich zum Diakon weihen und konnte so in diesem Bereich arbeiten. Sie selbst war schließlich in der Beratung und Palliativbegleitung bei einem kirchlichen Träger tätig.
Schweer verband seine Studienfächer, kam über Praktikum und Zivildienst zur Erziehungsberatung der Caritas. Daneben arbeitete er in der psychologischen Beratung der Hochschulseelsorge und war dort eingebunden in das Gemeindeleben. Er habe „das Glück gehabt, dass die jeweiligen Priester sehr aufgeschlossen dafür waren“. Rückblickend sagt er: „Die Theologie hat mir die Türen geöffnet, aber ich habe eigentlich nie als Theologe gearbeitet“.
Neue Perspektiven – in der Schweiz
„Die wenigsten sind im kirchlichen Dienst gelandet, weil man sie eben nicht gerufen und gewollt hat“, berichtet Fontein. Nach einem Jahr Arbeitslosigkeit dachte er selbst über eine andere Perspektive nach – sein gefordertes „zweites Standbein“ war Pädagogik. Dann erfuhr er von einer Gemeinde im Bistum Basel. Er ging in die Schweiz und blieb, weil er dort die „befreiende“ Erfahrung machte: „Ich bin hier gewollt und werde gebraucht und geschätzt.“ Und: „Ich kann hier Sachen machen, die habe ich mir vorher überhaupt nicht vorstellen können.“
Er absolvierte einen Pastoralkurs, am Ende stand die Feier der Institutio. Der Bischof versprach, lebenslang adäquaten Dienst zu ermöglichen, die Theolog:innen Treue zum Bistum. Fontein machte Karriere soweit als Nicht-Priester möglich, war Gemeinde- und Dekanatsleiter, Regionalverantwortlicher, Mitglied des Bischofsrats. Als Gemeindeleiter durfte er taufen und trauen.
Seelsorge als Berufung
Damit ist Fontein der einzige, der offiziell pastoralen Dienst leistete. Doch alle drei sagen: „Ich habe das schon auch als Seelsorge verstanden.“ Während es für Hengsbach und andere undenkbar war, dass Lai:innen beauftragt werden, wurde der Dienst am Menschen unabhängig von Amtsautorität als „kirchlicher Dienst“ und „pastorales Handeln“ (Schweer) erlebt. Sobek-Franz betont: Haltung und Resonanzräume sind entscheidend. Und Schweer wurde immer wieder angesprochen: „Sie sind doch auch Theologe…“.
Trotz aller Hürden und verletzenden Äußerungen brach niemand das Studium ab. „Ich frage mich heute selber, warum mich das nicht davon abgehalten hat“, sagt Sobek-Franz, um aber gleich hinterherzuschieben, wie gut das gewesen sei. Fontein spricht von Berufung: „Sonst hätte ich das wohl kaum durchgehalten!“
Nicht gerufen – und doch berufen?! Die Frage bleibt: Wer ruft eigentlich? Wer hat die Autorität, Berufung zu erkennen oder zu verweigern? „Gottes Wege sind unergründlich“, sagt Fontein. Die drei wurden „nicht gerufen“ – angekommen sind sie dennoch.
Eine Schlusspointe: Ausgerechnet das Bistum Essen ermöglichte 2022 als erste deutsche Diözese die Taufe durch Pastoral- und Gemeindereferent:innen. Die Ausbildung von Pastoralreferent:innen wurde 1994 unter Hengsbachs Nachfolger eingeführt, Mitte der 2000er Jahre aber wieder eingestellt. 2012 wurde sie in Kooperation mit dem Bistum Münster neu aufgenommen.
Wieder einmal zeigt Kirchengeschichte: Kritisches Erinnern eröffnet Räume. Denn nichts ist in Stein gemeißelt – am wenigsten das, was sich selbst für gottgegeben hält.
Ein großer Dank gilt den drei Zeitzeug:innen, die sich bereit erklärt haben, uns ihre Geschichte zu erzählen.

Lea Torwesten, M.Ed. hat Katholische Theologie, Germanistik und Erziehungswissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum studiert. In ihrem kirchenhistorischen Promotionsprojekt befasst sie sich mit Erinnerungsorten als didaktischer Ressource. Sie arbeitet als freie Mitarbeiterin in der Museumspädagogik.

Dr. Miriam Niekämper hat Katholische Theologie und Französisch an der Ruhr-Universität Bochum studiert. Sie promovierte zur Fraternität der „Kleinen Bischöfe“ vor dem Hintergrund der Theologie einer „Kirche der Armen“ auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil.
Beitragsbild: TaniaVdB, pixabay.com