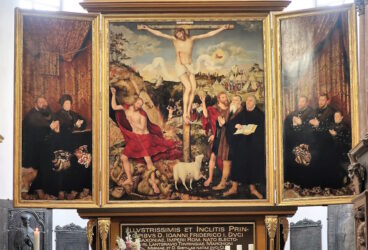Auf den Tag genau vor 200 Jahren, am 27. September 1825, wurde im Nordosten Englands zwischen Stockton und Darlington die erste öffentliche Eisenbahnstrecke eingeweiht, die Dampflokomotiven einsetzte. Johann Meyer nimmt dies zum Anlass, den vielfältigen Verflechtungen von Kirche und Eisenbahn im langen 19. Jahrhundert nachzuspüren.
Auf dem Weg zu einer Tagung fahre ich aus östlicher Richtung mit dem Zug in Köln ein. Der Zug verlangsamt sein Tempo, die Zugbegleiterin gibt die Anschlussverbindungen durch, rege Geschäftigkeit bricht aus. Die Fahrgäste suchen ihre Koffer beisammen und streben zu den Ausgängen. Der Zug überquert unterdessen in Schrittgeschwindigkeit auf der 1911 eingeweihten Hohenzollernbrücke den Rhein. Direkt vor der Zugspitze befindet sich das Wahrzeichen Kölns: Der Zug scheint förmlich in den Dom hineinfahren zu wollen, nimmt dann aber kurz vor dem Chor doch eine Rechtskurve und kommt im 1894 eröffneten Kölner Hauptbahnhof zum Stehen.
Dome des Maschinenzeitalters
Für die Menschen des 19. Jahrhunderts waren Bahnhöfe die „Dome des Maschinenzeitalters“1. Ihre beeindruckenden Eisenkonstruktionen predigten das Evangelium des technischen Fortschritts, der mit einem zivilisatorischen Fortschritt einherzugehen schien. Nirgendwo in Deutschland befindet sich eine Kathedrale des Mittelalters so eng neben einer Kathedrale des Eisenbahnzeitalters wie in Köln. Kaum anderswo vermischen sich nationale, religiöse und technische Elemente derart wie in der Rheinmetropole: auf der einen Seite der gotische Dom, in dessen Fertigstellung 1880 die Dombaubewegung zugleich eine symbolische Vollendung der deutschen Einheit erblickte; auf der anderen Seite Hohenzollernbrücke und Hauptbahnhof als Inbegriffe der technischen Modernität des aufstrebenden Deutschen Kaiserreichs.
Der Aufstieg des technischen Fortschrittsglaubens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ging mit einer religiösen Aufladung von Eisenbahntechnik und ihrer architektonischen Repräsentanten wie den Bahnhöfen einher. Das Heilsversprechen der Technik trat in Konkurrenz zum christlichen Glauben, der sich im 19. Jahrhundert in einer Säkularisierungskrise befand. Insbesondere in den explodierenden Großstädten sank die Bedeutung der Kirche, sichtbar etwa an abnehmenden Teilnahmezahlen an Gottesdiensten und Abendmahl. Auch die Eisenbahn wurde deshalb im langen 19. Jahrhundert kirchlicherseits unter den Vorzeichen der Säkularisierung bewertet. Auf der einen Seite weckte sie Hoffnungen auf die Intensivierung der Missionstätigkeit. Auf der anderen Seite wurde die Eisenbahn im Gegenteil gerade als Ursache für den Niedergang religiöser Praxis und einen allgemeinen Verfall von Sitten und Moral ausgemacht.
Eisenbahn als Instrument der Verwirklichung des Reiches Gottes
Dem ersten der beiden Rezeptionsstränge sind technikbegeisterte Theologen zuzuordnen, die meist aus der liberalen Theologie stammten, welche nach einer Aktualisierung der evangelischen Theologie im Geist der Moderne strebte. Der Heidelberger Theologieprofessor Richard Rothe lebte etwa in „der festen Überzeugung, daß dem Reiche Christi die Erfindung der Dampfwagen und Schienenbahnen eine weit bedeutendere positive Förderung geleistet hat als die Ausklügelung der Dogmen von Nicäa und Chalcedon.“2 Technik und Eisenbahn wurden als Instrumente begriffen, mit denen durch schnelleren Austausch von Ideen und einfachere Reisebedingungen die Verwirklichung des Reiches Gottes in greifbare Nähe rückte, die in eins gesetzt wurde mit gesellschaftlichem Fortschritt.
Aber nicht nur die progressive liberale Theologe war eisenbahnbegeistert. Auch der antimodernistische Papst Pius IX. war vom Besuch einer Eisenbahnfabrik und einer Probefahrt mit der Eisenbahn in Neapel 1849 so beeindruckt, dass er den Ausbau des Schienennetzes im Kirchenstaat forcierte. 1856 ließ er sich einen prunkvollen Galazug mit einem Eisenbahnwaggon als Privatkirche schenken, mit dem er den Kirchenstaat bereiste. Militärische Motive schnellerer Truppenbewegungen und eine Steigerung des Wirtschaftswachstums waren die weltlichen Gründe für den Eisenbahnbau. Jedoch konnten die Eisenbahnstrecken weder den Anschluss des Kirchenstaats an die Industrialisierung gewährleisten, noch den Untergang des Kirchenstaates mit der Eroberung Roms durch die Truppen der italienischen Einigungsbewegung 1870 verhindern.
Missionsjahrhundert im Eisenbahnnetz
Erfolgreicher sieht es hinsichtlich der religiösen Motivlage aus, mit der Eisenbahn Pilgerströme nach Rom zu lenken und so ganz im Sinne des Ultramontanismus europaweit die Stellung des Papstes unter den Gläubigen zu festigen. Auch über Rom hinaus ist der Aufschwung des Wallfahrtswesens im 19. Jahrhundert ohne die Eisenbahn undenkbar. Der Eisenbahnanschluss machte ab 1867 z.B. das südwestfranzösische Lourdes zum wichtigsten Pilgerziel Frankreichs und garantierte dessen Vorrangstellung etwa vor La Salette in den Alpen oder dem Mont Saint Michel vor der normannischen Ärmelkanalküste. Mit Pilgerzügen konnten insbesondere Kranke in großer Zahl nach Lourdes gebracht werden, die sich von der Quelle in der Wallfahrtsgrotte Heilung von ihren chronischen Leiden erhofften.
Sowohl in Europa als auch in den Kolonien profitierten Geistliche von den erleichterten Reisebedingungen durch neue Eisenbahnstrecken. James Fraser, der anglikanische Bischof der jungen stark industrialisierten englischen Diözese Manchester, wurde bekannt als Arbeiterbischof, der dank des dichten Eisenbahnnetzes rastlos durch seine Diözese reiste: Er konfirmierte insgesamt 29.000 junge Erwachsene, predigte in drei Vierteln der 420 Kirchen des Bistums, weihte 26 neue und hielt hunderte von Ansprachen zu weltlichen und geistlichen Themen, wie sein Biograph für Frasers 15-jährige Amtszeit von 1870 bis zu seinem Tod 1885 bilanzierte.
In den Kolonien waren europäische Missionare vor der Erschließung durch Eisenbahnstrecken mühsam in sengender Sonne oder tropischer Schwüle zu Fuß oder auf einem Pferde- bzw. Ochsenfuhrwerk unterwegs. Mit der Eisenbahn erreichten sie ihre Ziele nicht nur schneller, sondern auch noch ausgeruht und konnten sofort mit ihrer Arbeit beginnen. Dass das 19. Jahrhundert zum „Missionsjahrhundert“3 werden konnte, ist auch ein Resultat des weltweiten Ausbaus von Eisenbahnnetzen.
Mit der Christianisierung der Kolonien sollte nach Auffassung vieler Missionare zugleich ein zivilisatorischer Fortschritt einhergehen, der die Kolonien auf das europäische Kulturniveau anhob. Damit hielten jedoch auch in den Kolonien die negativen sittlichen Folgen des Eisenbahnwesens Einzug, wie sie in Europa bereits noch deutlicher zutage getreten waren. Kristallisationspunkt von Debatten, die einen durch die Eisenbahn verursachten Sittenverfall ausmachten, war die Diskussion um die Sonntagsentheiligung. Sinkende Gottesdienstteilnahmezahlen seien auch dadurch zu erklären, dass der Sonntagszugverkehr die Menschen zu einer Vergnügungsfahrt am Wochenende anstelle des Kirchgangs verleite. Im Gegensatz zu Kontinentaleuropa setzte sich im viktorianischen England und noch flächendeckender in Schottland ein „church interval“ bzw. der „Railway Sunday“ durch. Der Zugverkehr wurde sonntagvormittags reduziert oder sogar gänzlich eingestellt.
Sonntagszug statt Sonntagsheiligung
Als am 28. Dezember 1879 die Brücke über die Mündung des Flusses Tay bei Dundee unter dem Gewicht der Lokomotive in einem heftigen Wintersturm einstürzte und 75 Menschen in den Tod riss, war unter radikalen Verfechtern der Sonntagsheiligung die wahre Ursache des Unglücks schnell ausgemacht: Nicht die Naturgewalten seien schuld an der Katastrophe, wie sie in Theodor Fontanes berühmter Ballade „Die Brück‘ am Tay“ von den drei Hexen aus Shakespeares Macbeth verkörpert werden, sondern die Tatsache, dass es sich um einen Sonntagszug handelte. Einig waren sie sich jedoch in ihrer Kritik an technikgläubiger Hybris. „Tand, Tand / Ist das Gebilde von Menschenhand.“ So kritisiert sie Fontane am Ende seiner Ballade. Durch Eisenbahnunglücke wie im schottischen Firth of Tay erhielt der technische Fortschrittsglaube aber nur kurzzeitig kleine Risse.
Eine Bevölkerungsgruppe, bei denen der sittliche Verfall nach Ansicht einiger Geistlicher besonders deutlich sichtbar wurde, waren die Eisenbahnarbeiter, die – häufig fernab von Heimat, Gemeinde und Familie – die Eisenbahnstrecken errichteten. Besonders für die Erdarbeiten zur Begradigung der Streckenführung wurden zahlreiche Hände benötigt. Eng zusammengepfercht in Sammelunterkünften lebten die Arbeiter zusammen. Alkoholsucht, Gewalttätigkeit und sittlich-moralische Verrohung würden um sich greifen.
Johann Hinrich Wichern diente das Schicksal der Eisenbahnarbeiter 1848 in seiner berühmten Stehgreifrede auf dem Wittenberger Kirchentag als Anschauungsobjekt zur Illustration der negativen sozialen Folgen der Industrialisierung. Damit war die Berufsarbeit der Inneren Mission begründet, die ihre diakonische Tätigkeit ganz dem Namen nach als Pendant zur „äußeren Mission“ in den Kolonien begriff und auf eine Rückgewinnung der europäischen Arbeiter für den christlichen Glauben abzielte. Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wurden in diesem Zusammenhang außerdem die Bahnhofsmissionen gegründet, ursprünglich mit dem Ziel, dem Mädchenhandel mit den auf der Suche nach Arbeit in den Großstadtbahnhöfen ankommenden jungen Frauen Einhalt zu gebieten.
Insgesamt zeigt sich ein ambivalentes Bild des Verhältnisses von Kirche und Eisenbahn, das auch am Kölner Beispiel sichtbar wird: Die zentrale Lage des Kölner Doms direkt gegenüber vom Hauptportal des stark frequentierten Hauptbahnhofs dürfte ihren Teil dazu beitragen, dass der Dom die meistbesuchte deutsche Kirche ist. Zugleich ließ der schwefelhaltige Rauch der Dampflokomotiven bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts neben Industrieabgasen den ursprünglich hellen Sandstein des Doms ergrauen und ist mitverantwortlich, dass der Kölner Dom eine „ewige Baustelle“ bleibt.
___

Beitragsbild: https://pixabay.com/de/photos/dom-k%C3%B6ln-deutschland-rhein-wasser-1047849/
Literatur zum Weiterlesen:
Drehsen, Volker: „Des Geistes wandelnder Altar“. Religionspraktische Folgen aus der Begegnung von Frömmigkeit und Eisenbahn im 19. Jahrhundert. In: Pastoraltheologische Informationen 12 (1992) 1, 57–82.
Frenz, Albrecht/Kannenberg, Michael (Hg.): Kirche und Bahn. Von der Fils auf die Alb in die weite Welt. Illustrationen von Rainer Schoder. Geislingen an der Steige 2000.
Hänseroth, Thomas: Technischer Fortschritt als Heilsversprechen und seine selbstlosen Bürgen. Zur Konstituierung einer Pathosformel der technokratischen Hochmoderne in Deutschland. In: Vorländer, Hans (Hg.): Transzendenz und die Konstitution von Ordnungen. Berlin, Boston 2013, 267–288.
Meyer, Johann: Die Eisenbahn als Missionar oder Ursache des Sittenverfalls? Zur evangelischen Eisenbahnrezeption im Königreich Sachsen. In: Herbergen der Christenheit. Jahrbuch für deutsche Kirchengeschichte 46/47 (2022/2023), 35–77.
Nikles, Bruno W.: Bahnhofsmission und Bahnhofsdienste in Deutschland. Ein historischer Abriss ihrer Aufgaben- und Organisationsentwicklung. Opladen, Berlin, Toronto 2019.
Richardson, R. C.: The ‚Broad Gauge‘ and the ‚Narrow Gauge‘. Railways and Religion in Victorian England. In: Evans, A. K. B./Gough, J[ohn] V. (Hg.): The Impact of the Railway on Society in Britain. Essays in Honour of Jack Simmons. Aldershot (Hants) 2003, 101–115.
Schönborn, Christoph/Gürtlich, Gerhard H. (Hg.): Kirche und Eisenbahn. Weg – Wahrheit – Leben. 2. erweiterte Auflage. Wien 2016.
- Drehsen, Volker: „Des Geistes wandelnder Altar“. Religionspraktische Folgen aus der Begegnung von Frömmigkeit und Eisenbahn im 19. Jahrhundert. In: Pastoraltheologische Informationen 12 (1992) 1, 57–82, hier: 79. ↩
- Rothe, Richard: Stille Stunden. Aphorismen aus Richard Rothe‘s handschriftlichem Nachlaß. Wittenberg 1872, 344f. (Nr. 2422). ↩
- Warneck, Gustav: Warum ist das 19. Jahrhundert ein Missionsjahrhundert? Halle (Saale) 1880. ↩