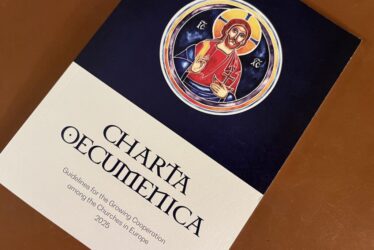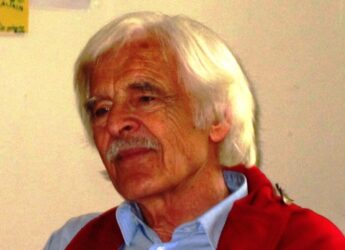Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine erschüttert das ökumenische Selbstverständnis zutiefst. In ihrer Antrittsvorlesung am 4.7.2025 sprach Regina Elsner über die Perspektiven der Ökumenischen Theologie als Denkraum des Friedens und als Solidaritätsbewegung der Erschütterten.
100 Jahre nach der Stockholmer Versammlung für praktisches Christentum, die als Ursprung der friedensethisch ausgerichteten Ökumene gilt, steht die ökumenische Theologie mit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine vor einem Trümmerhaufen der Fundamente, auf denen das ökumenische Selbstverständnis aufgebaut wurde. Neben der Aufarbeitung der eigenen Verstrickungen in die Kriegsideologie steht die Ökumenische Theologie vor der Frage: Welche Optionen kann sie eröffnen, um Ökumene neu als Denkraum von Frieden zu erschließen?
Die ökumenische Theologie steht vor einem Trümmerhaufen.
Ökumenische Theologie als Ort der „Solidarität der Erschütterten“
Eine theologische Auseinandersetzung über die Natur der Beziehungen zwischen Kirchen und Christen*innen als Solidarität kann helfen, eine Gegenmacht zu den hierarchischen und konfessionellen Vermachtungen zu erarbeiten, mit denen die russische Kirchenleitung ihre Kriegspropaganda stärkt. Das Konzept der Gegenmacht (Hannah Arendt) ist hilfreich, um toxische Formen von Solidarität gegen Formen abzugrenzen, in denen Solidarität auf die gemeinsame Handlungsfähigkeit einzelner Menschen abzielt. In der Beschreibung von Solidarität als Ermöglichung der gemeinsamen Handlungsfähigkeit ist ein Grundanliegen der ökumenischen Bewegung aufgegriffen: aus dem Verständnis des gemeinsamen Ziels heraus miteinander zu handeln, ohne auf die Erlaubnis durch autoritär verfügte dogmatische Einheit zu warten.
Solidarität als Ermöglichung der gemeinsamen Handlungsfähigkeit
Zusätzlich ist Solidarität im Kontext des Krieges in einer weiteren Dimension hilfreich. Die belarussische Philosophin Tatiana Shchyttsova beschreibt in ihrem kürzlich erschienen Buch „Die Solidarität der Erschütterten“ die verbindende Wirkmacht der Erschütterung angesichts unvorstellbarer Gewalt bei den Protesten in Belarus 2020. In Anlehnung an den tschechischen Philosophen Ian Patochka zeigt sie, wie erlebte Erschütterungen zu einem fundamentalen Wandel – einer Metanoia – der Einzelnen und der Gemeinschaft führt, wenn es denn gelingt, die erschütterten Einzelnen in einen Austausch über die erlebte Erschütterung zu bringen. In dieser Metanoia durch Erschütterung liegt der Anstoß für eine grundsätzliche Veränderung der Gemeinschaft hin zu einer Ordnung, die erneute gewaltsame Erschütterungen maximal vorbeugen möchte.
Erschütterungserfahrungen in eine grundlegende Verwandlung ökumenischer Selbstbestimmung überführen
Diese Ideen können einen Anstoß geben, die Erschütterung über das zutiefst unchristliche Handeln einer der größten christlichen Kirchen in eine grundlegende Verwandlung ökumenischer Selbstbestimmung zu überführen. Voraussetzung wäre ein möglichst breiter und offener Austausch über die individuell erlebte Erschütterung, da nur durch diese Verbindung der einzelnen Teile die Kraft der Solidarität der Erschütterten entstehen kann. Ökumenische Theologie wäre dieser Raum, in dem eine ernsthafte theologische Auseinandersetzung mit Erschütterungen der menschlichen und der kirchlichen Existenz bis hin zur Theodizee-Frage stattfinden kann. Ein solcher ökumenischer theologischer Raum der Solidarität versteht christliche Identität als die Fähigkeit, sich durch theologisch begründete Gewalt in den eigenen Glaubensfundamenten erschüttern zu lassen, und hätte kein Interesse an kanonischen konfessionellen Anerkennungsfragen. Er würde also auch die Menschen in Russland und Belarus einbeziehen, die aus ihrem christlichen Glauben heraus dem Krieg ihrer eigenen Kirchenleitung widerstehen.
kein Interesse an kanonischen konfessionellen Anerkennungsfragen
Fraglos wären das Prozesse, die den sogenannten Dialog über Lehrunterschiede zurückstellen würden, ohne diese jedoch aufzugeben. Sie bräuchten neue Begegnungsformate und eine strukturelle Kritik der Repräsentation von Kirchen durch ordiniertes Leitungspersonal. Allein darin könnte jedoch bereits ein transformativer Impuls stecken, der dem ökumenischen Kernthema der Synodalität durchaus nahesteht. Aus dem orthodoxen Raum ist hier zum Beispiel das Forschungsprojekt „Orthodoxy as Solidarity“ der estnischen Theologin Irina Paert zu nennen, die gelebte Basis-Solidarität im orthodoxen Kontext sichtbar macht, oder das Netzwerk „Christians against war“ aus dem belarusischen orthodoxen Raum.
Ökumenische Theologie als Ort der Kontextwissensproduktion
Ökumenische Theologie ist immer auch Konfessionskunde. In diesem Begriff steckt das oben benannte Problem der konfessionellen Identitäten durch Abgrenzung, das sicher einer kritischen Analyse bedarf. In den vergangenen Jahren ist außerdem oft davon gesprochen worden, dass die eigentlichen ökumenischen Verständigungslinien weniger den konfessionellen als vielmehr ideologischen Abgrenzungen folgen. Mit solchen neuen quasi-ökumenischen Vernetzungen und Blasen-Bildungen geht jedoch das Potential einer kritischen Konfessionskunde verloren, die zunächst vor allem daran interessiert ist, die jeweiligen Konfessionen in ihrer ganzen Vielfalt und in ihrem gesellschaftlichen Kontext kennenzulernen. Ökumenische Theologie als Begegnungsraum hat dabei die Chance, nicht nur Konfessionskunde, sondern auch Länder- und Regionalkunde zu sein.
Ökumenische Theologie: nicht nur Konfessionskunde, sondern auch Länder- und Regionalkunde
Der Fall Ukraine hat gezeigt, wie wenig wir wissen, und vor allem wie wenig Raum die Menschen aus den Kirchen und Ländern selbst in den ökumenischen Diskursen haben. Dabei war die Ökumenische Theologie unter den ersten, die traditionelle Missionsvorstellungen hinterfragt hat und die das, was heute als Kolonialismus- und Post-Imperialismusforschung verbreitet ist, thematisierte. Was für den globalen Süden – sicher lückenhaft, aber dennoch – gelungen ist, steht für den globalen Osten aus.
Ökumenische Theologie muss sich nicht von dem Protokoll kirchlicher Diplomatie begrenzen lassen.
Nicht nur, aber spätestens beim Eintreten einer so massiven Erschütterung wie dem russischen Angriffskrieg kann Ökumenische Theologie der Denkraum sein, in dem alle christlichen Gruppen unabhängig von ihrer kanonischen Anerkennung gehört werden. Fragen der kanonischen Anerkennung sind immer auch Machtfragen, die politischen Strategien unterliegen. Ökumenische Theologie muss sich nicht von dem Protokoll kirchlicher Diplomatie begrenzen lassen, sondern ist akademisch frei, Stimmen hörbar zu machen, die ansonsten von den jeweils mächtigeren Strukturen vereinnahmt und aus dem Diskurs verbannt werden.
Ökumenische Theologie als Ort theologischer „Auswilderung“[1]
Ökumenische Theologie ist in ihrem Selbstverständnis immer schon eine Grenzgängerin, die nicht in der kritischen Ideengeschichte oder institutioneller Selbstevaluation verbleibt, sondern anschlussfähig sein will für Gesellschaftswissenschaften und existentielle Wirklichkeitsfragen. Die Verbindung der ökumenischen Theologie mit der Friedensforschung, die Heinz-Günther Stobbe in Münster etabliert hatte, ist in diesem Sinn im Kern keine theologische Innovation, sondern eine Rückführung der Ökumenischen Theologie auf ihr Kerngeschäft im Modus der „Auswilderung“. Dass Sicherheitspolitik, Konfliktforschung und Rüstungsfragen ein zentrales Thema ökumenischer Reflektion sein können und müssen, wird aus einer dogmatisch oder kirchengeschichtlich fokussierten Ökumenischen Theologie heraus erst in dem Moment verständlich, wenn, wie aktuell, sicherheitspolitische Fragen und die weaponization theologischer Diskurse, dogmatischer Fragen und historischer Ereignisse die Tagesordnungen ökumenischer Foren dominieren. Mit Blick auf die Ukraine wird aber auch zunehmend deutlich, dass der Appell an das gemeinsame christliche Glaubensbekenntnis nicht mehr ausreicht, um die unterschiedlichen und tief gespaltenen christlichen Kirchen in einen substantiellen Gesprächsprozess zu bringen. Konzepte der Konfliktforschung wie Mediation, Dealing with the Past oder Transitional Justice können in einer solchen kirchenpolitischen Sackgasse christliche Versöhnungskonzepte fruchtbar ergänzen und weiten.
Ökumenische Theologie in Verbindung mit Friedens- und Konfliktforschung
Aber auch in der anderen Richtung der Wildnis liegt ein enormes Potential der Ökumenischen Theologie. In Zeiten eines verschärften Sicherheitsdiskurses, der staatliche und militärische Sicherheit ins Zentrum jeglicher politischer Entscheidungen stellt, werden Beiträge, die die menschliche Sicherheit als entscheidenden Aspekt von gesellschaftlicher Resilienz profilieren, ausgesprochen wichtig. Es kann die genuine Aufgabe von Ökumenischer Theologie sein, einen theologisch tragfähigen Begriff von Sicherheit im religiösen Kontext zu formulieren, der konfessionellen Grabenkämpfen um angebliche Identitätsverluste widersteht. Theologische Diskurse über Glaubenswahrheiten müssten dann darauf hin geprüft werden, inwieweit sie Resilienzen gegenüber einer Radikalisierung und Instrumentalisierung fördern – oder aber Konflikt, Spaltung und Exklusivität transportieren und damit gewaltsame Konflikte statt Frieden unterstützen können.

Regina Elsner ist Professorin für Ostkirchenkunde und Ökumenik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster, affiliierte Wissenschaftlerin am Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS) in Berlin und Redaktionsmitglied von feinschwarz.net
[1] Birte Platow hat vor kurzem auf feinschwarz.net mit Friedrich Wilhelm Graf die akademische Theologie als Biotop bzw. als Theotop beschrieben, das der Auswilderung bedarf.
Beitragsbild: Versehrte Gottesmutter-Ikone in den Trümmern eines Wohnhauses in Schyrokyne/Mariupol, 2018, Foto: Volodymyr Kutsenko.