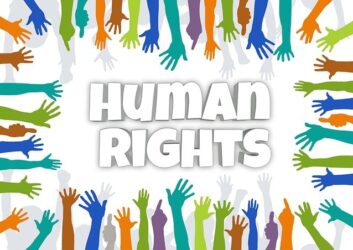Leo XIV. ist der erste englischsprachige Papst seit Hadrian IV. (†1159). Was bedeutet diese Papstwahl für den Vatikan, die Kirche und die USA? Annalena Müller zeigt drei Perspektiven auf.
Während des Pontifikats von Franziskus gehörte die Kirche in den USA zu den unruhigeren und rebellischeren Regionen. Gezeichnet von der Missbrauchskrise und Klagewellen, die mehrere Bistümer in die Insolvenz trieben, waren es vor allem die traditionell einflussreichen konservativen Kreise, die gegen die „Verwässerung“ der Lehre unter Franziskus rebellierten. Für den Vatikan war das aus mehreren Gründen ein Problem: Neben den theologischen Querschüssen aus Nordamerika hatte er mit stark rückläufigen finanziellen Zuwendungen zu kämpfen. Für den chronisch defizitären Kleinstaat ein Problem, das bei der Wahl Leos XIV. eine Rolle gespielt haben könnte.
Wie reagiert man in den USA auf die Wahl Leos XIV.?
Ben Munster ist Journalist beim Polit-Magazin Politico, das in den USA für investigativen Journalismus berühmt und gefürchtet ist. Munster kam eher zufällig zum Vatikan, eigentlich ist er Korrespondent für die Europäische Zentralbank. Im Sommer 2024 verfasste er eine umfassende Analyse des Franziskus-Pontifikats.
Dr. Bronwen McShea, Historikerin und traditionelle Katholikin, steht Kardinal Timothy Dolan nahe. Sie hofft auf eine Rückkehr zu lehramtlicher Klarheit – und mehr Zurückhaltung bei der Einmischung in inneramerikanische Angelegenheiten.
Prof. Carlos Eire, Religionshistoriker an der Eliteuniversität Yale und wie Papst Leo XIV. in Chicago aufgewachsen, sieht die Kirche in der grössten Krise ihrer Geschichte: «Leo wird schwierige Entscheidungen treffen müssen – vor allem, welche Gruppe die Kirche ausschliessen wird, um nicht an sich selbst zu zerbrechen.»
Ein Reporter in Rom: «Es geht um Geld und Macht»
Nach Franziskus’ Tod schickte sein Magazin Ben Munster (29) erneut nach Rom. Trotz seiner Vatikanferne kommt der Investigativjournalist bei den Kardinälen gut an. «Ich war überrascht, wie offen einige Kardinäle mit mir gesprochen haben», so Munster augenzwinkernd.
Laut Munster freuen sich auch konservative Kardinäle wie Raymond Burke und Timothy Dolan über die Wahl des ersten US-Amerikaners. Die Spannungen und die Insubordination innerhalb der US-Kirche dürften nun abnehmen – «einfach, weil der Papst Amerikaner ist».
Finanzstarke Spender hätten im Vorkonklave Einfluss genommen
Munster erwartet auch politische Auswirkungen: «Die Politik wird versuchen, vom amerikanischen Papst zu profitieren.» Die katholische Kirche sei schwer einzuordnen, aber selbst «Progressive» im Vatikan seien nach westlichen Massstäben konservativ – etwa in Bezug auf Frauen oder LGBTQ+. Konservative Kräfte in der Trump-Administration – etwa Vizepräsident JD Vance oder Aussenminister Marco Rubio – sähen darin spirituelle Rückendeckung für ihre Politik. Munster bezweifelt, dass diese Rechnung aufgeht. «Konvertiten wie Vance sehen nur den reaktionären Teil, sie verstehen die Komplexität der katholischen Lehre nicht.»
Aus Sicht des Vatikans sei es bei der Wahl auch ums Geld gegangen, ist Munster überzeugt. Finanzstarke Spender hätten im Vorkonklave Einfluss genommen. «Ein Kardinal sagte mir, die US-Spenden seien unter Franziskus eingebrochen.» Die Grossspender aus dem konservativen Lager seien für den Vatikan unverzichtbar – ein Umstand, der die Wahl Leos XIV. beeinflusst haben könnte.
Zahlen bestätigen diese Annahme: Laut dem Wirtschaftsbüro des Heiligen Stuhls belief sich das Defizit 2023 auf 84 Millionen Euro. In den drei Jahren zuvor waren es je knapp 80 Millionen, wie der Zürcher «Tagesanzeiger» berichtete. Auch die «New York Post» stellte kürzlich einen Zusammenhang zwischen dem strukturellen Defizit und der Papstwahl her. Munster ist überzeugt: Die Kardinäle erwarten von Leo, dass er den amerikanischen Geldfluss wieder in Gang bringt. «Der Vatikan ist darauf angewiesen.»
Yale-Professor: grösste Krise der Kirchengeschichte
Dass Geld ein Faktor war, glaubt auch Carlos Eire (74), Professor für Kirchen- und Religionsgeschichte an der Yale University. Eire weiss aus eigener Erfahrung, wie vermögend das reichste katholische Prozent der USA ist. In der ersten Mai-Woche, die zufällig mit dem Vorkonklaves zusammenfiel, war Eire in Rom. Die «Hortus Foundation», eine Stiftung, die inhaltlich Benedikt XVI. nahesteht, hatte ihn nach Rom geflogen. Dort führte der Professor der Eliteuniversität handverlesene Spender durch die Basilika San Clemente. Die Hortus Foundation finanziert die Renovation der 1200-jährigen Basilika. Wenn diese Leute ihr Portemonnaie öffnen – oder schliessen – merkt man das im Vatikan.
Die Kirche war nie so aus dem gesellschaftlichen Takt wie heute.
Trotzdem glaubt Eire, «dass Geld nicht ganz oben auf der Sorgenliste der Kardinäle stand». Die Finanzen seien zwar ein Problem, aber bei weitem nicht das grösste, so der Historiker. «Die römisch-katholische Kirche befindet sich in der grössten Krise ihrer Geschichte». Und das wolle etwas heissen, denn die Geschichte der Kirche sei eine einzige Krisengeschichte.
Selbst aus den grössten Krisen, wie dem Abendländischen Schisma (1376-1417) und der Reformation (ab 1517), sei die Kirche in der Vergangenheit jeweils gestärkt hervorgegangen. Für die aktuelle Krise ist Eire weniger optimistisch. «Der grösste Unterschied ist der Faktor Zeit», so der Historiker. Die gesellschaftlichen Veränderungen waren noch nie so rasant und die Kirche nie so aus dem gesellschaftlichen Takt wie heute. «Frauen, LGBTQ+, der Zölibat und der damit einhergehende Priestermangel sind die Fragen, die die Kirche unter Zeitdruck lösen muss».
In der Geschichte habe die Kirche auf ihre existenzbedrohenden Krisen mit Ab- und Ausgrenzung reagiert, so Eire. Ein Beispiel sei das Erste Vatikanische Konzil (1870). Mit dem Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit wurde einen jahrzehntelanger Richtungskampf zwischen liberalen und antimodernistischen Kräften beendet. Erstere brachen daraufhin mit Rom und gründeten die christ- bzw. altkatholische Kirche, die bis heute besteht. So ungerne man es lesen will: «Letztlich wird die Kirche – und Papst Leo XIV. – in der aktuellen Krise entscheiden müssen, wen sie ausschliessen will, um weiter zu existieren.»
Wenn er eine Prognose wagen müsste, sähe sie so aus: «Der Zölibat könnte freiwillig werden, wie er es das erste Jahrtausend der Kirche war – empfohlen, aber nicht verpflichtend». Schwieriger wird es bei der Frauen – und der LGBTQ+-Frage. «Diakoninnen ohne Weihe» seien denkbar, «dafür gibt es Hinweise in der Tradition», so Eire.
Das Pontifikat von Franziskus sei eine Herausforderung gewesen, besonders für konservative Kreise in den USA. Franziskus wurde von vielen als unberechenbar wahrgenommen mit seinen Vorstössen, welche die Grenzen des Kirchenrechts austesteten und auf die oft eine Rolle rückwärts folgte. Eire sieht es anders: «Franziskus verhielt sich schlicht jesuitisch: Er ging zwei Schritte vor und einen zurück. Das ist durchaus eine Methode, um Dinge zu bewegen und verändern.»
Traditionelle Katholikin: Weniger Willkür und mehr Lehramt
Auf viele traditionelle Katholik:innen wirkte Franziskus’ Theologie oft weniger jesuitisch als willkürlich. Auch auf die New Yorkerin Bronwen McShea. Die promovierte Historikerin schreibt über Frauen in der Kirchengeschichte und möchte traditionelle Kreise für das Thema sensibilisieren.
Francis Prevost war ihr vor seiner Wahl unbekannt – wohl, weil er viele Jahre in Peru tätig war. «Aber das hat ihn für das Kollegium wählbarer gemacht als jemand wie Timothy Dolan», so McShea, die kürzlich Gast in dessen Radiosendung war. Dolan sei ein typischer Amerikaner: gesellig, intellektuell-meinungsstark, amerikazentrisch – Leo XIV. wirke im Vergleich leiser und zurückhaltender. Darin unterscheide der neue Papst sich auch von seinem Vorgänger, der mit seinen spontanen und nicht immer lehramtlich-fundierten Aussagen Verwirrung gestiftet habe.
Einheit in Vielfalt, das gelte für beide Richtungen
Laut McShea habe Franziskus mit seiner Spontanität zur innerkirchlichen Polarisierung beigetragen. Sie kritisiert besonders die Ablehnung der lateinischen Messe unter Franziskus: „Diese Liturgie hat Kraft. Unter Benedikt XVI. hat sie in den USA zu einem kirchlichen Revival geführt,“ so McShea. Obwohl sie selbst nicht die lateinische Messe besucht, ist sie überzeugt, dass in der Kirche Platz für die tridentinische Liturgie sein muss: Einheit in Vielfalt, das gelte für beide Richtungen.
Von Leo XIV. erhofft sich McShea einen Neustart – theologisch wie politisch. Auf beiden Ebenen waren die Beziehungen zwischen den USA und dem Heiligen Stuhl zuletzt angespannt. Einen Tiefpunkt erreichten die Beziehungen im Februar 2025. Damals kritisierte Franziskus in einem Schreiben die Immigrationspolitik der Trump-Administration ungewöhnlich deutlich.
Für McShea ging die Kritik zu weit. Damit habe sich der Vatikan in eine weltliche, innenpolitische Debatte eingemischt. Sie selbst sehe das Ausmass der Krise jeden Tag in den Strassen von New York. Die Art und der Ton, mit dem Vatikan sich in die Debatte eingemischt habe, seien irritierend gewesen. Schliesslich gehe es nicht um lehramtliche Fragen. Die Einmischung ins politische Tagegeschäft empfanden sie und viele in ihrem Umfeld als übergriffig. Natürlich habe die Migrationsfrage moralische Aspekte, zu denen die Kirche sich äussern könne. Aber dabei gelte es, beide Seiten zu berücksichtigen: «die Rechte der Geflüchteten, aber auch den Schutz der Einheimischen – besonders bei dem Krisenlevel, das hier erreicht ist.». Diese Ausgewogenheit habe dem Schreiben gefehlt.
Finanzkrise und Kirchenkrise lösen durch mehr Lehramtstreue oder mehr Öffnung, durch Inklusion oder Ausschluss, durch Position oder Diskretion? Die Erwartungen an den ersten US-amerikanischen Papst sind auch in seiner Heimat hoch.
—

Annalena Müller ist promovierte Historikerin. Zuletzt war sie Chefredaktorin des «pfarrblatt» des Kanton Bern. Als freie Journalistin schreibt sie unter anderem für die Neue Zürcher Zeitung. Persönliche Webseite: annalenamueller.ch (Foto: Pia Neunschwander)
Beitragsbild: A. Müller, erstellt mit Hilfe von ChatGPT