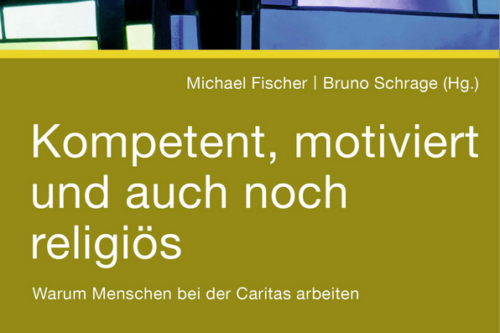Bruno Schrage und Michael Fischer stellen aktuelle Studienergebnisse zum Ethos von Caritas-Mitarbeitenden vor.
Eine zunehmend vielfältigere Mitarbeitendenschaft stellt die kirchliche Identität von Caritas vor große Herausforderungen. Lange Zeit wurde diese Frage auf Grundlage des kirchlichen Arbeitsrechts und damit auf der normativen Ebene bearbeitet. Die Deutschen Bischöfe gaben Loyalitätsobliegenheiten vor und die Caritas und Diakonie formulierten in Leitbildern und Unternehmensverfassungen ihren Markenkern. Doch reicht dies?
Das Ethos der Organisation – kirchlich?
Der Anlass der hier vorgestellten Studie[1] waren die Gerichtsurteile des Europäischen Gerichtshof (EuGH) im Fall Egenberger und das Düsseldorfer Chefarzt-Urteil. Es wurde entschieden, dass entsprechend der Antidiskriminierungsrichtlinie 2000/78/EG das christliche Ethos kirchlicher Organisationen an der Art der jeweiligen Tätigkeit und den Umständen ihrer Umsetzung sichtbar werden muss. Gerade das Egenberger Urteil lenkt den Blick unmissverständlich auf das Ethos der Organisation und die Resonanz des Ethos in der beruflichen Tätigkeit und damit auf das alltägliche Handeln der Mitarbeitenden.
Den Ethos-Begriff der Rechtssprechung ernst nehmen
In Zukunft muss präzisiert werden, was von den Mitarbeitenden in den Einrichtungen der Caritas und Diakonie im Hinblick auf ihre Tätigkeit erwartet wird. Eine allgemeine, christlich-normative Festschreibung als Unternehmensverfassung, die auf der Tätigkeitsebene nicht konkretisiert werden kann, reicht nicht aus. Mit der neuen Grundordnung für kirchliche Arbeitsverhältnisse (GrO 2022) ist das arbeitsrechtlich auf wenige zeitgeschichtlich bedingte Loyalitätsobliegenheiten beruhende System der Identitätssicherung beendet. Es stellt sich die Frage, was dann das katholische Ethos einer Caritas- oder Diakonie-Organisation ausmacht. Wie gelingt es bei zunehmender Pluralität und Säkularisierung zu einem konstruktiven und gewinnenden Prozess der Identitätsgewinnung zu kommen? Könnte die Rechtsprechung des EuGH evtl. hilfreich sein? Dann gilt es den Ethos-Begriff in seiner normativ-praktischen und deskriptiv-analytischen Dimension ernst zu nehmen.[2]
Die Werte der Mitarbeitenden sind Teil der Ethos-Werdung
Wenn künftig alle Mitarbeitenden „Repräsentanten der Liebe Gottes“ sein können[3], dann sind deren Motivationen, Visionen, Werte und Haltungen selbst Teil der Ethos-Werdung caritativ-kirchlicher Organisationen. Wie gelingt es, die notwendige Kohärenz bei Werten und Haltungen zwischen der vielfältigen Mitarbeitendenschaft und den ebenso vielfältigen caritativ-diakonischen Trägern mit ihren jeweiligen kirchlichem Sendungsauftrag zu gestalten? Mit dem Ende der Volkskirche zeigt sich die Notwendigkeit Identität und Identifikation wieder stärker als einen dynamischen Prozess mit spezifischen Rahmenbedingungen im Arbeitskontext zu begreifen. Es braucht einen Ethos-bezogenen Perspektivwechsel, der die Handlungsfelder und die Mitarbeitenden kirchlicher Träger deutlicher wahrnimmt.
Unter dem Vorzeichen der Pluralität und fortschreibenden Säkularisierung wechselt die vorliegende Studie die Perspektive hin zu Identitätsprozessen „von unten“. Sie befragt die Mitarbeitenden caritativer Einrichtungen, welche Werte ihnen in ihrer Tätigkeit wichtig sind, was sie bewegt und motiviert. Auf diesem Hintergrund wurden 34 qualitative Interviews mit Pflegekräften, Ärzt*innen und Ärzten, Sozialarbeiter*innen und Management bei unterschiedlichen Trägern und in verschiedenen Handlungsfeldern geführt und ausgewertet.
Säkularität als Chance
Das christliche Ethos einer kirchlichen Einrichtung speist sich aus vier Ethosformen: Organisations-, Lebens-, Dienst- und Professionsethos. Sie stehen für die strukturierenden Vorüberlegungen der Studie, um die typologischen Merkmale des Selbstverständnisses der Berufe und der Träger in der Caritas zu befragen. Die Studie zeigt, wie hoch die Bedeutung von Werten für die befragten Mitarbeitenden der Caritas sind. Obwohl bewusst religiös und katholisch sozialisierte Mitarbeitende interviewt wurden, steht aus deren Sicht für ihre Tätigkeit weniger der Glaubensbezug als vielmehr der Wertebezug im Vordergrund. Das dogmatisch-institutionelle Selbstverständnis von Kirche als Gemeinschaft von Gläubigen ist offenbar nicht mehr übertragbar auf das Selbstverständnis der kirchlichen Einrichtungen.
Hohe Bedeutung von Werten für die Befragten
Es braucht eine neue Verhältnisbestimmung zwischen Glaubensgemeinschaft (Zugehörigkeit zur katholischen Kirche) und Überzeugungsgemeinschaft (Mitarbeitende am Sendungsauftrag der Kirche).[4] Heutige Mitarbeitende kommen mir ihrer Religiosität oder ohne jegliche Religiosität.[5] Jan Loffeld spricht hier vom rasch zunehmenden Phänomen der „religiösen Gleichgültigkeit“, einem „Apa-Theismus“ und in der Folge von „völlig singularisierten und hybridisierten Glaubensexistenzen, auf die die kirchliche Lehre überhaupt nicht vorbereitet ist.“[6]
Die Ergebnisse zeigen, dass die befragten Mitarbeitenden für ihre beruflichen Motivation und die sie bewegenden sozialen Haltungen synonyme Begrifflichkeiten aus dem christlichen bzw. säkularen Sprachkontext wählen. Udo Schmälzle spricht hier von einem ausgeprägten „christlichen Compassion-Ethos“.[7] Gerade die Gleichniserzählung Jesu vom barmherzigen Samariter im Streitgespräch mit dem Gesetzlehrer ((Lk 10,25–37) macht deutlich, wie selbstkritisch die Kirchen in Deutschland hinsichtlich einer arbeitsrechtlich geführte Identitätssicherung sein müssen. Erneut spricht Jesus zu den Gesetzestreuen mit Blick auf die heutige Vielfalt von sozial engagierten Mitarbeitenden: Dann geh und handle genauso!
Defizitperspektive mangelnder Kirchlichkeit und Religiosität verlassen
Die beispielhaften Motive, die sozialen Haltungen, die in der fachlichen Praxis bereits verwirklichten Werte, gilt es zu entdecken, wahrzunehmen und christlich wertzuschätzen. In diesem Moment scheint die Attraktivität des christlichen Selbstverständnisses auf und wird als Begründung für bereits geteilte Überzeugungen realisiert. Die gemeinsame Entschiedenheit im diakonischen Handeln ist die Basis für das Entdecken der darin geteilten Überzeugungen und gegebenenfalls der Anlass für eine Vertiefung. Die Studie verlässt somit die geübte Defizitperspektive mangelnder Kirchlichkeit und Religiosität und entdeckt gerade im säkularen Sprachjargon der caritativen Tätigkeiten eine diakonische Spiritualität und Motivation.
Religion ist keine Unterbrechung!
Das Management caritativer Organisationen steht vor der Herausforderung auf den Arbeitskontext bezogene christlich geprägte Diskursräume anzubieten. Religion ist hier keine Unterbrechung, sondern die motivationale Grundlage, die Vision von Gerechtigkeit und die ethische Handlungsorientierung. Caritative Tätigkeit lebt das Evangelium, bringt es auf die Straße, ist gelebte Religion. Die und der Nächste ist der Tempel Gottes. In der Tätigkeit begegnen sich die persönlichen wie beruflichen Vorstellungen, Haltungen und Werte der Mitarbeitenden (Lebensethos) mit denen des caritativen Trägers (Organisationsethos) sowie denen der katholischen wie evangelischen Kirche (normatives Ethos der Glaubensgemeinschaft). Grundlage des Diskurses sind die Erfahrungen im Arbeitsprozess des jeweiligen Handlungsfelds der caritativen Dienstleistung (Dienstethos). Die Studie verdeutlicht den neuen Managementauftrag auf dieser Grundlage Identitätsprozesse trägerseits in den Einrichtungen zu gestalten.
Vielfalt ist keine Gefahr
Diese Diskurskultur ist zum einen die Voraussetzung für die wachsende Identifikation der Mitarbeitenden mit dem caritativen Träger und seinem sozial-caritativen Auftrag (Mission) wie auch seiner Vision von gesellschaftlicher Entwicklung. Zum anderen ist es die Voraussetzung für eine Fortentwicklung des jeweiligen kirchlich-caritativen Trägerverständnisses (Mission, Vision, Tradition). Hieran sind die Mitarbeitenden aktiv durch ihr Handeln, ihre Professionalität, ihre Erfahrungen, Werte, Haltungen, Vorstellungen und Visionen beteiligt. Vielfalt ist keine Gefahr, sondern eine Chance für Mitarbeitende und ihre Erfahrung von kirchlichem Handeln wie für die kirchliche Organisation durch die professionell-empathische Tätigkeit der Mitarbeitenden.
Diakonie und Caritas stehen nicht am Nullpunkt!
Dies geschieht in einer christlich geprägten Kultur, die bezogen auf das jeweilige Handlungsfeld eine Befassung mit den ideellen Vorstellungen des Evangeliums, der kirchlichen Werten und Haltungen und Grundlagen der Glaubensgemeinschaft ermöglicht.[8] So kann sich gerade durch die Vielfalt der Mitarbeitenden ein gemeinsames Verständnis für den kirchlichen Sendungsauftrag im Sozial- und Gesundheitswesen entwickeln. Hier wächst aus der Vielfalt eine Dienstgemeinschaft, in der alle als „Repräsentanten der Liebe Gottes“ in der Welt wahrgenommen werden, auch wenn sie nicht der sie begründenden Glaubensgemeinschaft angehören. Auf diese Weise kann eine Überzeugungsgemeinschaft der Samariterinnen und Samariter auf Grundlage der Glaubensgemeinschaft entstehen. Das Ethos der Einrichtung lebt aus beiden Kontexten und wird als ständig zu reflektierender Prozess sichtbar. Identität hat man nicht einfach, wie der eher statische Profilbegriff suggeriert, sondern sie bleibt eine beständige Aufgabe gerade im Sozial- und Gesundheitswesen mit den alltäglichen existenziellen Kontexten.
Identität hat man nicht einfach
Hier stehen die caritativen Träger nicht am Nullpunkt, wie Ansgar Hense schreibt: „Dabei sind es wohl gerade die caritativen Einrichtungen, die hier über einen reflexiven Vorsprung verfügen, da gerade dieser Sektor kirchlichen Wirkens seit langem auch unter institutionellem Rechtfertigungsdruck steht, was denn das religiöse „sur plus“ genau ist![9] Die Studienergebnisse zeigen aber auch, wie sehr Theologie und institutionell verfasste Kirche gefordert sind, diese Prozesse, auch um ihrer selbst willen, in einer Lernpartnerschaft wahrzunehmen.
__
[1] M. Fischer / B. Schrage (Hg.), Kompetent, motiviert und auch noch religiös. Warum Menschen bei der Caritas arbeiten, Freiburg/Brsg. 2025.
[2] Vgl. Bleyer, B. Angesichts des Ethos dieser Kirche oder Organisation: Fischer u. Schrage, Studie. S. 118-129.
[3] Die deutschen Bischöfe, GrO 2022., Art. 3 Abs. 2
[4] Schrage, B., Sie haben den Reset-Knopf gedrückt! Identität wird zur Aufgabe, in: Neue Caritas 124 (19/2023), 9–13.
[5] Vgl. Ebertz, M. N., Segler, L., Spiritualitäten als Ressource für eine dienende Kirche. Die Würzburg-Studie, Echter Verlag, Würzburg 20161. Loffeld, J., Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt. Das Christentum vor der religiösen Indifferenz, Freiburg i.B. 2024.
[6] Loffeld, ebd., 34, 57 u. 89.
[7] Schmälzle, U., Kompetent, motiviert und auch noch religiös! Pastoraltheologische Anmerkungen und Perspektiven zur Studie: Fischer/Schrage, Studie, S. 130-142. hier S. 132.
[8] Vgl. hierzu Giebel, A., Bröckelt das Fundament?: Fischer/Schrage, Studie S.143-157.
[9] Hense, A., Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes, Zwischenschritt oder Meilenstein?: Fischer/Schrage, Studie, S.90-117, hier S. 117
__
Bild:

Bruno Schrage ist Dipl. Theologe, Dipl. Caritaswissenschaftler und Referent für Caritaspastoral und Grundsatzfragen im Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln e.V.

Dr. Michael Fischer ist Professor an der Privaten Universität für Gesundheitswissenschaften und Technologie (Hall in Tirol) und Referat Christliche Identität und Werte, St. Franziskus Stiftung Münster.