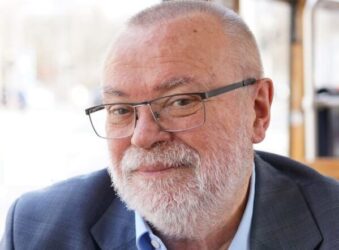Eine schwache Beziehung als pastorale Orientierung? Müsste es nicht heißen: eine starke Beziehung als pastorale Orientierung? Oder umgekehrt: Steckt hinter dem Begriff einer schwachen Beziehung nicht der Trick einer demütigen Macht? Es zeigt sich, dass die Schwäche bestimmungs- und erklärungsbedürftig ist und das Paradox zwischen Stärke und Schwäche nicht als Methode aufgelöst werden darf. Von Bernd Hillebrand.[1]
Phänomenologisch inspirierten mich zu diesem Thema Erfahrungen aus der Jugendarbeit und aus der Zusammenarbeit mit Studierenden, die oft so unberechenbar waren, dass sie zum einen nicht kontrollier- oder beherrschbar und zum anderen Ausgangspunkt unglaublicher Dynamik waren. Im Freigeben und Ermöglichen entstanden großartige Solidaritätsprojekte, aber auch autonome Trinkpartys Minderjähriger. Wie lässt sich im Nachhinein die Beziehungskonstellationen zu den jungen Menschen beschreiben? War es eine schwache Beziehung oder lag gerade in der Schwäche die Stärke oder etwas dazwischen?
Eine weitere phänomenologische Inspiration entdeckte ich bei Klaus Purkarthofer aus Fernitz, der die Firmenstruktur seiner Eisproduktion im Sinne einer schwachen Beziehung radikal umgestaltete. Er erklärt in der Kleinen Zeitung: „Klares Ziel war es, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen – er wollte ein Team formen, das an einer gemeinsamen Vision arbeitet und Solidarität lebt. Die Menschen stärken und ermächtigen. Und selber aufhören, gierig zu sein. Natürlich entschieden die Mitarbeiter auch, was ich als Chef verdienen soll. Alles andere wäre verlogen.“[2] Er erzählt weiter von einer besseren Arbeitsmotivation und weniger Krankenständen. Steckt hinter dieser Erfahrung das Paradox einer schwachen Beziehung oder ist sie am Ende doch nur ein Trick?
Um diesen ersten Fragen und Anfragen gerecht zu werden, werde ich nach und nach die Bestandteile des Untertitels ins Gespräch bringen, also erstens das Phänomen der Beziehung ausgehend von Emmanuel Lévinas. Zweitens versuchen zu begründen, wieso eine machtsensible und urchristliche Beziehung eine schwache sein müsste. Darin liegen drittens paradoxe Konstellationen und viertens stellt sich die Frage, wie diese paradoxale Haltung eine wesentlich pastorale Orientierung werden kann.
1. Beziehung: eine philosophische Differenzierung
Beim Begriff der Beziehung geht es mir um die Beschreibung des Verhältnisses zwischen einem Ich und einem/einer Anderen und darum, wie sie miteinander interagieren. Dass der Mensch eine Beziehungsperson und ein Beziehungssubjekt ist, wird dabei vorausgesetzt. Beziehung ist ein interaktiver Prozess, wie sie die integrative Therapie mit folgenden Begriffen als sukzessiv aufeinander folgende beschreibt: Kontakt, Begegnung, Beziehung, Bindung, Abhängigkeit, Hörigkeit.[3] In dieser Bestimmung eines Relationalitätsprozesses wird deutlich, dass Beziehung zum einen Kontakt und Begegnung voraussetzt und sie zum anderen in ein Abhängigkeitsverhältnis bis zur Hörigkeit münden kann. Beziehung steht also immer in Machtkonstellationen, die nach Michel Foucault eben auch zur Herrschaft werden können. Aufgrund dieser ersten Sensibilisierung von Beziehung im Prozess und im Kontext von Macht verzichte ich auf einen allgemeinen Exkurs in die Beziehungs- und Begegnungsphilosophie, sondern beziehe mich ansatzweise auf einen Begegnungsphilosophen, der das Beziehungsgeschehen in besonderer Weise machtsensibel und dekonstruktiv aufgedeckt hat: Emmanuel Lévinas.
Für Lévinas ist Beziehung nicht das, was entsteht, wenn ich etwas über den/die Andere:n weiß. Ganz im Gegenteil: Wissen kann sogar eine Form der Gewalt sein, wenn ich den/die Andere:n in Begriffe pressen will. Wahre Beziehung ist nur möglich, wenn ich den/die Andere:n in seiner/ihrer Andersheit anerkenne, ohne ihn/sie kontrollieren zu wollen. Lévinas problematisiert also den Modus einer Begegnung, in der eine Person andere Menschen auf sich selbst hin ordnen möchte und sie den eigenen Vorstellungen versucht anzupassen. Für Levinas ist die Beziehung zum/zur Andere:n nicht eine wechselseitige oder symmetrische Verbindung, sondern eine asymmetrische Verantwortung. Die Beziehung ist also nicht zuerst dialogisch oder kommunikativ, sondern ethisch. Man ist in Beziehung, sobald man dem/der Anderen begegnet – und das heißt, man ist ihr/ihm gegenüber verantwortlich, bevor man etwas über sie/ihn weiß. Der/die Andere als Andere:r bleibt immer ein:e Andere:r. Deshalb geht es darum, die gegenseitige Anerkennung konsequent bis in das Anders-Sein des/der Anderen durchzuhalten und auf die Einpassung des/der Anderen in die eigenen Interessen zu verzichten.[4]
Der/die Andere tritt in der Begegnung in das Leben der/des Anderen ein, vor allem durch sein/ihr Gesicht, und stellt eine unausweichliche ethische Forderung. Das „Gesicht“ ist bei Levinas ein zentrales Konzept. Es meint nicht nur das physische Gesicht, sondern steht für die Unverfügbarkeit und die Unendlichkeit des/der Anderen. Das Gesicht spricht nicht mit Worten, sondern durch seine bloße Gegenwart. Es zeigt: Hier ist ein Wesen, das nicht auf ein Objekt, eine Kategorie, eine Funktion reduziert werden darf. Im Bild des Gesichtes bleibt der/die Andere immer die/der Nicht-Verstehbare, der/die Unverfügbare und der/die dem Endlichen Entzogene. „Das Gesicht ist das, was sich nicht in einer Form enthält, das nicht Thema wird, das nicht enthält, sondern das mich betrifft, ohne dass ich es thematisieren kann.“[5] Das Gesicht wird zum Zeichen der Unverfügbarkeit und der Würde des/der Anderen.
Zwei Aspekte aus den Betrachtungen von Lévinas sind für meinen Ansatz einer schwachen Beziehung von Bedeutung. Zunächst zeigt sich in der Beschreibung der Begegnung mit dem/der Anderen, ein entmächtigendes Ausgesetztsein, in der eine ethische Verantwortung entsteht. Schwach ist dabei die eigene Position, da sie einseitig verpflichtend ist. Lévinas überfordert allerdings die eigene normative Verantwortung so, dass der normative Imperativ unerträglich wird. Inspirierend bleibt dennoch die Unverfügbarkeit und die Nicht-Verstehbarkeit des/der Anderen in der mich betreffenden Begegnung und die sich daraus zeigenden Würde des/der Anderen. Inwiefern die Beziehung in der Begegnung selbst schwach ist und auch schwach bleibt, fließt in die späteren Überlegungen ein.
Dann ist noch ein zweiter Aspekt von Bedeutung. Der Auftrag und die Verantwortung entstehen bei Lévinas in der Begegnung mit dem/der Anderen. Ich votiere eher dafür, dass die Verantwortung aus dem Ereignis, einem Prozess der Begegnung entsteht, dass es zuerst einer Begegnung bedarf, aus der heraus eine innere Veränderung entsteht. Man muss doch etwas von dem/der Anderen wissen. Es könnte bei Lévinas der Verdacht entstehen, dass der/die Andere das Objekt einer ethischen Verpflichtung ist. Ich gehe von einer Begegnung aus, in der gleichsam aus der Empathie und dem Prozess der Begegnung Anerkennung des/der Anderen und Verantwortung für ihn/sie entsteht. Dazu bedarf es allerdings einer Absichtslosigkeit in der Begegnung, die eine schwache Beziehung voraussetzt, die gibt, ohne über den Empfang der Gabe zu verfügen. Insofern trifft diese Vorstellung wieder die Beschreibung der Begegnung von Lévinas als eine zumindest zunächst asymmetrische.
2. Schwache Beziehung
Im nächsten Schritt geht es nun um die Bestimmung des Schwachen in der Beziehung. Eine phänomenologische Perspektive soll zunächst die Notwendigkeit der Debatte verdeutlichen und wird gefolgt von einer Entdeckung des Schwachen und mündet in eine Qualifizierung desselben.
2.1. Praktische Dekonstruktionen
Eine Beziehung mit schwachen Möglichkeiten dekonstruiert manche kirchliche und pastorale Logik, die ich anhand von zwei Beispielen kurz anreißen möchte, um die Notwendigkeit der Debatte zum Thema einer schwachen Beziehung zu verdeutlichen. In der Würzburger Synode wurde das „personale Angebot“ als Grundhaltung kirchlicher Jugendarbeit formuliert. Es wurde als ein Angebot der Kommunikation ausgewiesen, das offen ist zum Gespräch und zu echter Teilnahme an den Problemen des jungen Menschen.[6] Was sich nach einem Angebot anhört, das sich vom Anderen her entwirft, wurde in der kirchlichen Jugendarbeit leider auch genutzt, um Machtmissbrauch und sexuellen Missbrauch zu verüben. Die systemische Machtstruktur von Kirche wurde als bedingte Vorgegebenheit unterschätzt und die Machtstruktur von Beziehungen zu wenig kritisch reflektiert.
Ein zweiter problematischer Bereich findet sich im kirchlichen Handeln sozial-diakonischen Helfens. Henning Luther deckte ein defizitorientiertes Handeln beim gutgemeinten Helfen auf, das den/die Andere:n über sein Defizit definiert und dieses Defizit vom eigenen Ich her bestimmt. Diese Logik nährt sich aus der Vorstellung eines starken und heroischen Helfers, der über den/die Andere:n verfügt und die schwache Möglichkeit als starke übergriffig wahrnimmt.[7] Dieser kurze exemplarische Exkurs verdeutlicht, dass pastorale Machtkonstellationen im kirchlichen Handeln oftmals nicht bewusst sind und eine neue bewusste Haltung brauchen. Daher ist zu fragen, inwiefern der Ansatz einer schwachen Beziehung als Paradox eine hilfreiche Figur pastoralen Handelns sein kann.
2.2. Entdeckung des Schwachen
Zunächst definiert sich das Schwache immer in einem Verhältnis zu einem/einer Anderen, das scheinbar stärker oder stark ist. Wenn das Schwache tatsächlich immer in einem komparativen Beziehungsverhältnis zu einer Norm steht, dann wäre eine Person, eine Sache oder eine Position von sich aus und aus sich heraus nicht schwach. Beziehungskonstellationen hingegen sind nie machtfrei und es ist deshalb notwendig, über schwache und starke Beziehungen nachzudenken.
Einer, der das Schwache in den letzten Jahren in der Philosophie thematisiert hat, ist Gianni Vattimo. Sein Konzept des „schwachen Denkens“ schließt an die postmoderne Logik an, dass es keine „starken“ absoluten und zeitlosen Wahrheiten mehr gibt. Vattimo spricht von einer Ontologie des Verfalls, die angesichts Heideggers geschichtsphilosophischer Idee die Seinsgeschichte als Auflösungsgeschichte versteht. Was bleibt ist die Pluralität von Interpretationen.[8] Das „schwache Denken“ überträgt Vattimo auf die christliche Religion und wird für unsere Fragestellung interessant. Er interpretiert das Christentum in erster Linie als Offenbarwerden der Kenosis Gottes. Die Kenosis, d.h. die Selbsteinschränkung oder Selbstentäußerung Gottes sei der Hauptzug des Christentums. Darin sieht Vattimo einen frühen Appell an die Abwendung von den „starken“ Strukturen des Denkens und eine erste Hinwendung zu „schwachen“ Prinzipien. In der Kenosis Gottes, in der erlösenden Hingabe des Christus offenbart sich folglich ein „schwacher“ Gott der selbstlosen Liebe in der Geschichte. Der christliche Gott ist somit ein Gott der Geschichte, die jede vergegenständlichte Vorstellung über ihn ständig schwächt und dekonstruiert.[9]
Diese Schwäche stellt für Vattimo eine Skepsis und eine Ungewissheit dar, die es gilt durchzuhalten, um offen für die Möglichkeiten zu sein, die es dann zu ergreifen oder zu verwerfen gilt. Darin liege nach Vattimo mit Bezug auf 2Kor 12 die Stärke, worauf wir noch bei der pastoralen Orientierung zu sprechen kommen. Die Stärke der Christen liegt nach Vattimo also in einem Strukturmoment des Lebensvollzugs, der sie in die Lage versetzt, die Schwäche, die Skepsis durchzuhalten und mit der Möglichkeit der Auferstehung als Stärke zu rechnen. Ob in dieser Schwäche nicht schon eine kalkulierte Stärke liegt, werden wir später nochmals diskutieren.[10]
2.3. Qualifizierung des Schwachen als bedingungslose Anerkennung
Interessant ist, dass Vattimo im Übertragen des „schwachen Denkens“ auf die Kenose Gottes als Selbsteinschränkung die Schwäche methodisch als produktiven Relativismus charakterisiert, aber die Schwäche selbst noch nicht inhaltlich bestimmt. Jean-Luc Marion hingegen versteht die Kenose von der Trinität her und qualifiziert sie inhaltlich aus seinem Gabe-Hingabe-Verständnis. Marion betont die selbstlose Liebe in der Kenose deutlicher als Vattimo, als deren Konsequenz die Selbstschwächung in der Kenose folgt. Die Entäußerung beschreibt er als Hingabe, als Nicht-Festhalten und als Aufgeben. Dahinter steckt ein gnadentheologisches Vertrauen und Übergeben der eigenen Sorge als Verzicht auf Selbsterlösung. In der Kenose findet also ein bewusster Verzicht statt, über den Empfang einer Gabe zu verfügen. Die Gabe des/der Anderen erhalte ich dann nur im Raum einer Möglichkeit, dass ich sie möglicherweise erhalte. „Sie kann aber auch zur Enttäuschung werden. Sie setzt voraus, dass ich mich auf die Möglichkeit einlasse, mich ihr aussetze, sie nicht zunichtemache durch Besitznahme oder Besitzanspruch. Die Gabe gibt und verlangt nicht – sie setzt nur voraus, dass ich mich ihr hingebe.“[11] Das Geben der Gabe ist also ein Freigeben, eine freigebende Hingabe, über das der/die Andere selbst bestimmt und seine/ihre Freiheit voraussetzt.[12]
So fasst Marion zusammen, dass alles verloren geht, was nicht weggegeben wurde und gleichzeitig voraussetzt, dass das freigegebene Gegebene im Risiko der Annahme oder Ablehnung steht. Ohne an dieser Stelle das Verständnis im Horizont des dreifaltigen Gottes weiter ausführen zu können, zeigt sich in dem Verständnis der Kenose von Marion zum einen eine bedingungslose Anerkennung des/der Anderen im Kontext von Gabe und Hingabe. Zum anderen deutet sich bereits eine Paradoxie in diesem Verständnis einer schwachen Beziehung an, dass die Gabe nur durch Hingabe möglicherweise überlebt, worin also eine Stärke liegt, aber dass die Hingabe den Empfang der Gabe nicht garantiert, gleichsam unverfügbar ist.[13]
3. Paradoxale Konstellationen einer schwachen Beziehung
Im Durchgang von Levinas, über Vattimo bis zu Marion definiere ich nun eine schwache Beziehung über das Risiko einer bedingungslosen Anerkennung des/der Anderen, die eben unbedingt und unabhängig von einem möglichen Empfang ist. Durch die eigene Entmächtigung wird eine Ermächtigung des/der Anderen als ermöglichendes Lebenspotenzial eröffnet. In der bedingungslosen Qualität der Beziehung liegt also eine gewisse Schwäche, die zur Stärke für den/die Anderen wird. Darin liegt die Grundparadoxie einer schwachen Beziehung, die ich versuche zu charakterisieren. Theologische Quelle und Hintergrund dieser Definition sind die Inkarnation und die sich darin ereignende Kenose, die eine bedingungslose Anerkennung zugrundelegen.
Dieses Paradox einer schwachen Beziehung schließt an das Paradox einer machtvollen Ohnmacht bei Hans-Joachim Sander[14] an oder an das Verschwendungsparadox bei Hildegund Keul[15]. Ob es nun bei der schwachen Beziehung um eine schwache Position (Vattimo) oder eine schwache Ausweichmöglichkeit des normativen Imperativs gegenüber dem/der Anderen (Levinas) oder um eine bedingungslose Anerkennung des/der Anderen geht (Marion), steht die schwache Beziehung immer in der Gefahr, das eigene Risiko nicht offen zu halten und die Nutzlosigkeit der schwachen Beziehung für sich zu funktionalisieren. Im Ansatz des Paradoxes einer schwachen Beziehung liegt nämlich auch eine zirkuläre Problematik.
Die eine Seite der Problematik liegt in einer kalkulierten Stärke der schwachen Beziehung. Wenn das Paradox einer schwachen Beziehung nicht mehr das Risiko der Bedingungslosigkeit aufrechterhält, sondern mit der Stärke als verfügbare Methode rechnet, wird unter der Vorgabe einer schwachen Beziehung mit Macht über Andere verfügt. Daher ist es vor allem im Kontext sozialer Organisationen besonders perfide, wenn sich Macht hinter einer sich bescheiden gebenden und schwachen Demut verbirgt. Die andere Seite der Problematik einer schwachen Beziehung liegt in einer altruistischen Selbstverachtung. In diesem Verständnis wird die Paradoxie der schwachen Beziehung als vordergründige Selbstaufgabe zugunsten dem/der Anderen begründet, was jedoch durch die absolute Selbstrelativierung eine Immunisierung zur Folge hat. Ein innerer Rückzug in die absolute Selbstrelativierung entzieht sich der Beziehung und der Verantwortung für den/die Andere:n und steht in der Gefahr zur immunisierten Macht zu werden.
Beide Problematiken missachten den gnadentheologischen und letztlich spirituellen Aspekt der schwachen Beziehung, da sie sie für sich funktionalisieren. Es stellt sich dann jedoch die Frage, wie man in der schwachen Beziehung den eigenen Platz zur Ermächtigung des/der Anderen freigeben kann und ihn gleichzeitig nicht aufgibt. Damit es nicht zu einer Funktionalisierung des Paradox einer schwachen Beziehung in seiner Absichtslosigkeit kommt, müssen wohl zwei Dinge miteinander in der Schwebe bleiben: die Selbstfürsorge und die Selbstentmächtigung.
Diese Schwebe bedarf jedoch der Begegnung mit dem/der Anderen und mit sich selbst. Denn in der Begegnung kann es zur inneren Berührung, zum inneren Ergriffensein und zur Verantwortung kommen, was eine gleichermaßen empathische Selbstfürsorge und Selbstentmächtigung im Bezug auf den/die Andere hervorrufen kann. Es geht also nicht ohne Liebe oder setzt sie gleichsam voraus. Darin liegt eine Spur des Unendlichen, das sich in seiner Unverfügbarkeit jeder Machbarkeit entzieht und somit Absichtslosigkeit in der Schwebe offenhält.
4. Pastorale Orientierung aus dem Paradox einer schwachen Beziehung
Der Ansatz des Paradox einer schwachen Beziehung ist so verstanden selbst ein schwacher Ansatz, da er keine Methode ist, sondern als Grundhaltung in der Schwebe und im Risiko bleibt, die keine Garantie auf Erfolg oder Stärke in sich birgt. Vielmehr muss dieser Ansatz sich ständig selbst hinterfragen, ob er in seiner paradoxalen Logik noch absichtslos und zweckfrei ist. Daher kann er nur eine Orientierung darstellen. Welche Auswirkung er als pastorale Orientierung haben könnte, soll nun in einem letzten Schritt zur Sprache kommen. Dazu kommen eine biblische Orientierung, die Frage nach einem pastoralen Haltungswechsel und pastorale Konsequenzen in Blick.
4.1. Biblische Orientierung
Dass nun der biblische Bezug erst recht spät in meinen Betrachtungen erfolgt, liegt nicht an einer womöglichen nachrangigen Bedeutung der Heiligen Schrift, sondern am pastoralen Ansatz. Danach hat die biblische Orientierung, auch wenn sie an dieser Stelle nur sehr knapp ausfallen kann, immer den zentralen Part eines kriteriologischen Korrektivs, einer Inspiration und Irritation für die eigenen Überlegungen als zentraler Ort theologischer Erkenntnis. Mit diesen Überlegungen kommt nun vor allem das bereits angesprochene Zitat nach Paulus ins Spiel.
Ausgangspunkt für das Paradox einer schwachen Beziehung war das Pauluszitat in 2Kor 12,10: denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Dieses entstammt der sogenannten Narrenrede und darin dem zweiten Teil. In beiden Teilen der Narrenrede geht es um den Selbstruhm, der unnütz, aber nötig sei (2Kor 12,1). Mit der Narrenrede geht es um seine Autorität in Korinth, wo sich seine Gegner durch das Darstellen eigener spiritueller Erlebnisse selbst rühmen. Dabei betont Paulus, dass Selbstruhm notwendig (2Kor 11,30), aber gleichzeitig unnütz sei. Mit dieser Wendung deutet er eine gewisse Ambivalenz des Selbstruhms eigener Stärke an.[16]
Der Darstellung des eigenen Ruhms als Zeichen von Autorität stellt Paulus in 2Kor 12,5 die eigene Schwäche entgegen. Die Schwachheit helfe ihm, sich selbst nicht zu überhöhen. Er führt als Schwächen vor allem den Stachel in seinem Fleisch an, bei dem es sich um seine persönliche Krankheit handelt. Darüber hinaus bezieht er sich bei seinen Schwächen auf die in V.9f genannten Schwachheiten, also auf alle in der Narrenrede benannten Situationen der Niedrigkeit, insbesondere die Flucht aus Damaskus. All diese Orte ordnet er dann aber als Orte der Erfahrung von Stärke ein.[17]
Zur Schwachheit kommt also die Stärke, die für ihn natürlich Christus ist. Sie wird jedoch nicht kreuzestheologisch ausgelegt. Die Schwäche schlägt nicht in Stärke über, sondern sie ist innerlich mit ihr verbunden. Die Dimension der Schwäche zeigt gerade in der Flucht aus Damaskus und seinem körperlichen Stachel, dass er am Ende ist. Dennoch gehen sein Leben und seine Mission weiter und bringen Frucht, was offensichtlich der göttlichen Kraft zu verdanken ist. Gott wirkt also auch in seiner Schwachheit. Dies fasst Paulus in seinem Fazit von 2Kor 12,10 zusammen. Die Schwäche ist dabei nicht notwendige Bedingung seiner Stärke, sondern hotan und tote lassen sich am besten mit einem empathischen „gerade dann, …bin ich stark“ übersetzen.[18]
Paulus beschreibt hier seine rühmliche Stärke so, dass sie mit seiner Schwäche koexistieren kann. In diesen Schwächungen lässt er Gott zu Wort kommen und deutet sie als Beweis der Kraft Gottes um.[19] Der Triumph in der Schwäche liegt nicht an seiner starken Persönlichkeit, sondern allein an der Gnade. Er möchte also zeigen, dass die göttliche Kraft in der Stärke und in der Schwäche wirkt, denn gerade sein großes Durchhaltevermögen und seine Offenbarungserfahrungen werden zu Zeichen göttlicher Kraft.[20] Zusammenfassend bringt Paulus Stärke und Schwäche im Kontext des eigenen Ruhms miteinander ins Spiel und zeigt zunächst auf, dass Gott in beidem zu finden ist und dass es zwischen beiden eine Verbindung gibt. Die Schwäche wird im Bezug zur Stärke bei ihm gerade zum Zeichen für die Gnade Gottes und zum Zeichen göttlicher Kraft.
Die Logik der Kenosis, in der durch Entmächtigung göttliches Leben im Sinne neuer Ermächtigung entsteht, ist hier nicht unmittelbar erkennbar. Paulus ist wohl in seiner Theologie so sehr kreuzestheologisch ausgerichtet, als dass er den ermöglichenden Zusammenhang zwischen Stärke und Schwäche nicht kenotisch erschließen kann. Dennoch spürt er, dass es einen inneren Zusammenhang gibt und dass es nicht nur um eine Rechtfertigung der eigenen Schwäche als Ort der Kraft Gottes geht. Ansonsten hätte er nicht beide miteinander in eine Verbindung gebracht, sondern sieht in der Schwäche eine Möglichkeit neues Lebens, ohne die Schwäche zu verharmlosen, da er selbst am Ende seiner Kräfte ist und somit die Schwäche sein Leben riskiert. Daher beschreibt Paulus an dieser Stelle eigentlich eine kenotische Beziehung als Paradox einer Schwäche, auch wenn er sie für sich nicht so deutet, sondern die eigene Rechtfertigung viel mehr im Vordergrund steht, als eine inkarnationstheologische Betrachtung seiner schwachen Position in Erwägung zu ziehen. Dennoch ist interessant, dass er die Schwäche nicht als Scheinschwäche oder als Gegenpol zur Stärke beschreibt, sondern sie in einer inneren Verbindung als Ort der Kraft Gottes gleichsam in der Schwebe hält.
Auf diesem Hintergrund ließen sich noch weitere Schwäche-Stärke-Konstellationen im Neuen Testament ausgehend von der Inkarnation Jesu und unterschiedlichen Heilungsbegegnungen darstellen und auch im Alten Testament wären Schwäche-Stärke-Zusammenhänge wie beispielsweise Mose im Binsenkörbchen in die Überlegungen einzubeziehen, die gerade die angesprochene Schwebe zum Ausdruck bringen.
4.2. Pastoraler Haltungswechsel
Spätestens jetzt stellt sich die Frage, ob und wie das Paradox einer schwachen Beziehung, die aus der Logik der Kenosis als bedingungslose Ermächtigung des/der Anderen verstanden wird und die somit einen Grundzug christlicher Beziehung aus selbstloser Liebe darstellt, die pastorale Haltung kirchlichen und außerkirchlichen Handelns bestimmen sollte. Die Perspektive pastoralen Handelns würde sich jedenfalls von einer Institutions- zu einer Existenzorientierung verändern, die sich endgültig vom Kirchenbild einer Societas perfecta verabschiedet und sich als Volk Gottes mit den Menschen versteht. Es ist eine Haltung, die sich einreiht in ein postheroisches und postkoloniales Verständnis. Ich möchte in der notwendigen Kürze drei Haltungen andeuten, die aus dem Paradox einer schwachen Beziehung als bedingungslose Anerkennungsgabe resultieren, wie sie eben entwickelt wurde.
Die erste Haltung überschreibe ich mit dem Begriff der Demut, die vielfach auch als verdeckte Macht missbraucht wurde, aber in ihrem Ursprung neu entdeckt werden sollte. Rainer Bucher hat sie folgendermaßen beschrieben: „Demut ist erst einmal schlicht die Selbstverpflichtung zum Realismus, zum Realismus über die eigene Existenz, vor allem auch darüber, dass all unsere Leistungsfähigkeit nichts ist im Vergleich zu unserem Scheitern, nichts im Vergleich ist zur Wahrheit der Sünde und des Todes, nichts ist im Vergleich zu dem, worauf es ankommt. […] Demut ist die Einsicht in die eigene Endlichkeit in jeder Hinsicht.“[21] Demut relativiert auf diese Weise produktiv und öffnet für eine schwache Beziehung, die Raum und Platz freigibt.
Aus dieser Demut kann ein Zweites entstehen. Es ist ein Lernen von Anderen möglich, weil ich selbst um meine eigenen Grenzen und Schwächen weiß, die gerade im Lernen nicht eliminiert werden, sie aber ergänzen. Nur so ist ein Lernen von anderen Religionen, von säkularen Kulturen und vom zufälligen Ereignis möglich. Und eine dritte Haltung ist gleichsam die Grundlage für eine produktive Demut und eine Bereitschaft zum Lernen. Es ist die Haltung einer bedingungslosen Anerkennung, die sich erst aus einer Begegnung ergibt, die mich verändert und ergreift, weil ich mich selbst freigebe für etwas unkontrollierbar Drittes. Diese Begegnung drängt dann zum Engagement für die Schwachen und für die Nicht-Anerkannten.
4.3. Pastorale Konsequenzen
Die Beziehung von Kirche zu den Anderen verändert sich durch eine schwache Beziehung, indem die Anderen nicht mehr auf sich bezogen werden, sondern Kirche sich von den Anderen her entwirft. Auch diese Bewegung möchte ich anhand von drei Handlungsbereichen konkretisieren.
Wenn sich das Kirchenbild aufgrund einer schwachen Beziehung von einer gesellschaftlichen Vormachtstellung verabschiedet, beginnt sie unter der Prämisse bedingungsloser Anerkennung im Sozialraum da zu sein, Präsenz nicht aufzugeben, aber eigene Räume zur Verfügung zu stellen. Gemeindehäuser, Kirchen und Gärten stehen den Menschen im Sozialraum als Begegnungsorte und diakonische Nutzungsräume zur Verfügung. Ämter verlieren im Kontext einer schwachen Beziehung ihre ontologische Vormachtstellung und stellen sich in einen öffentlichen Dienst. Haupt- und Ehrenamtliche suchen Begegnungsorte gegenseitigen Austausches, die wiederum im eigenen Wirken Plätze freigeben und aus einer schwachen Beziehungen agieren. Ämter haben dann nicht mehr Kontrollfunktion, sondern handeln aus der Sorge für alle, „immer gratis, nie umsonst“[22], aber ohne Rendite.
In globaler Perspektive geht es bei Partnerschaften mit der Weltkirche nicht mehr um Entwicklungshilfe, sondern um eine Leben ermöglichende Verbindung, die das Wohl aller Menschen möchte und die sich solidarisiert mit der Sorge um die Möglichkeit und Bedrohtheit des Lebens auf dem Planeten Erde. Darauf verweist auch Klaus Kießling in seinem Buch zu Andinen Kosmovisionen.[23] Dabei ist die Pluralität von unterschiedlichen Kosmovisionen, also unterschiedliche Deutungen und Umgang mit dem Kosmos, eine komplementäre Stärke gegenüber einer universellen Vereinnahmung, die durch eine schwache Beziehung bedingungsloser Anerkennung ermöglicht und gefördert wird.
5. Ausblick: stärken und schwach sein dürfen
Für mich steckt hinter dem Paradox einer schwachen Beziehung letztlich die Ermutigung, Andere stark zu machen und selbst schwach sein zu dürfen. Beides setzt die Erfahrung und die Bedingung voraus, selbst bedingungslos anerkannt zu sein. Es ist gleichzeitig die wesentliche Botschaft des Christentums, die in Ritualen und Begegnungen in aller Vorläufigkeit zum Ausdruck kommen sollte.
Menschen, die versucht haben, genau diese Haltung im Paradox einer schwachen Beziehung zu leben, waren die Arbeiterpriester. Von Christian Herwartz SJ, einem Arbeiterpriester, stammt das Zitat: „Wer sich nicht verändern will, kann nicht begegnen.“[24] Stark machen und selbst schwach sein dürfen im Sinne einer schwachen Beziehung setzt eine Begegnung voraus, die verändert. „Bisheriges kommt in die Schwebe, und zwar in Gegenseitigkeit, um darin gemeinsam Neues (oder das Alte auch) neu zu entdecken.“[25]
Die Schwebe auszuhalten zwischen einen Platz freigeben und einen Platz nicht aufgeben ist die Bedingung dafür, dass im Paradox einer schwachen Beziehung tatsächlich etwas Drittes entstehen kann – darin liegt die eigentliche Stärke.

[1] Antrittsvorlesung am 12.04.2024 an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Graz.
[2] Nina Müller, Hier entscheiden die Mitarbeiter, was sie verdienen – und was der Chef, in: Kleine Zeitung 14.09.2023, https://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/6321875/Purkarthofer-Eis-in-Fernitz_Hier-entscheiden-die-Mitarbeiter-was (letzter Aufruf 15.04.2025).
[3] Vgl. Petzold, Modalitäten der Relationalität, http://www.fpi-publikation.de/images/stories/downloads/textarchiv-petzold/petzold_mueller_modalitaeten_der_relationalitaet_2005-2007.pdf (letzter Aufruf 15.04.2025), 41ff.
[4] Vgl. Emmanuel Lévinas, Humanismus des anderen Menschen, Hamburg 1989, 111-117, 129-221.
[5] Emmanuel Lévinas, Totalität und Unendlichkeit. Versuch über die Exteriorität, 5. Auflage (Alber-Studienausgabe), Freiburg – München 2014, 221.
[6] Würzburger Synode, 299.
[7] Vgl. Henning Luther, Religion und Alltag. Bausteine zu einer Praktischen Theologie des Subjekts, Stuttgart 1992, 224ff.
[8] Martin Weiß, Die Religion der Schwäche. Gianni Vattimos Interpretation des Christentums im Kontext des Schwachen Denkens, in: Ludwig Nagl (Hg.), Essays zu Jacques Derrida and Gianni Vattimo, Religion, Frankfurt a.M. 2001, 145-167.
[9] Martin Weiß, Kenosis und Caritas.Die Postmoderne als Einlösung der christlichen Botschaft. Gianni Vattimo und Paulus, in: Christian Strecker, Joachim Valentin (Hg.), Paulus unter den Philosophen, 153-175, https://www.researchgate.net/publication/258883178_Kenosis_und_Caritas_Die_Postmoderne_als_Einlosung_der_christlichen_Botschaft (letzter Aufruf 15.04.2025), 158ff.
[10] Weiß, Kenosis und Caritas, 169f.
[11] Jean-Luc Marion, Kenose und Trinität, in: IKaZ 45 (2016) 161–174, 168.
[12] Marion, Kenose und Trinität, 167ff.
[13] Marion, Kenose und Trinität, 169.
[14] Hans-Joachim Sander, Macht in der Ohnmacht. Eine Theologie der Menschenrechte, Freiburg 1999.
[15] Hildegund, Keul, Das neue Dispositiv der Vulnerabilität – eine österliche Chance, 4. April 2021, https://www.feinschwarz.net/das-neue-dispositiv-der-vulnerabilitaet-eine-oesterliche-chance/ (letzter Aufruf 15.04.2025).
[16] Vgl. Thomas Schmeller, Der zweite Brief an die Korinther (2 Kor 7,5 – 13,13) (Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament; Bd. VII/2), Göttingen 2015, 276f.
[17] Schmeller, Der zweite Brief an die Korinther, 322f.
[18] Schmeller, Der zweite Brief an die Korinther , 323.
[19] Vgl. Jacob Kremer, 2. Korintherbrief, in: Paul-Gerhard Müller (Hg.), Stuttgarter Kleiner Kommentar – Neues Testament 8, Stuttgart 1990, 106ff.
[20] Vgl. Schmeller, Der zweite Brief an die Korinther, 326.
[21] Rainer Bucher, Diakonisch Kirche sein, Vortrag auf der Pastoraltagung der Diözese Rottenburg-Stuttgart 29.06.2017, 9f.
[22] Ottmar Fuchs, Sakramente – immer gratis, nie umsonst, Würzburg 2015.
[23] Vgl. Klaus Kießling, Andine Kosmovisionen. Kirche mit indigenem Gesicht, Würzburg 2022.
[24] Vgl. Michael Johannes Schindler, Gott auf der Straße. Studie zu theologischen Entdeckungen bei den Straßenexerzitien, Münster 2016.
[25] Ottmar Fuchs, Momente einer Mystik der Schwebe. Leben in Zeiten des Ungewissen, Ostfildern 2023, 82.