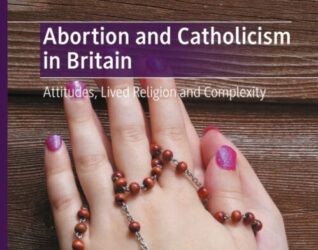In den Tagebüchern Etty Hillesums spielt das Thema Scham eine wichtige Rolle. Maria Magdalena Stüttem stellt dar, welche Formen der Scham bei Hillesum begegnen und wie sie sich entwickeln.
Etty Hillesum, die jüdisch-niederländische Schriftstellerin, hat in ihren Tagebüchern und Briefen, die zwischen 1941 und 1943 entstanden, tiefgründige Einblicke in ihre innere Welt und ihre spirituelle Entwicklung gegeben.[1] Ihre erstaunliche und unkonventionelle Biographie zeichnet einen Lebensweg, in dem ihre Suche nach dem tiefverschmolzenen Einheitsgrund als überkonfessionell oder transreligiös beschrieben werden kann. In einer Zeit, die von zunehmendem Judenhass und schließlich von Verfolgung, Deportation und Vernichtung durchdrungen ist, bewegt sich ihre wegweisende Gottsuche in der Spannung zwischen innerster Gottesbeziehung und tätiger Eingebundenheit für andere.
Ihre Tagebucheinträge – als individuelle Erfahrung in existentiell verdichteter Sprache – lassen sich nicht ohne weiteres auf bestimmte Kategorien hin abstrahieren. Es fällt jedoch auf, dass das Phänomen Scham in vielfältigen Perspektiven eine Rolle spielt und im Verlauf des knapp zweijährigen Schreibens einer spürbaren Entwicklung unterliegt: Zunehmend gelingt es ihr, sich von einer schambesetzten Haltung zu lösen und Schamnischen zu überwinden. Im Folgenden soll zwei Fragen nachgegangen werden: Wie beschreibt Etty Hillesum ihre eigene Scham? Und welche Entwicklung zeichnet sich in Bezug auf ihren Umgang mit Scham ab?
Das Phänomen Scham spielt in Etty Hillesums Tagebüchern eine wesentliche Rolle. Die Texte spiegeln eine Entwicklung zu einer Integration von Scham – im Sinne einer Selbstannahme. Insgesamt zeigt sich in der Lektüre ihrer Tagebücher eine abnehmende Tendenz in der Verwendung des Begriffs Scham.
Scham spielt in Etty Hillesums Tagebüchern eine wesentliche Rolle
Diese unterschiedlichen Zugänge, mit denen Etty Hillesum dem Phänomen Scham in ihren Tagebüchern begegnet, sind eng miteinander verwoben. Im Folgenden versuche ich, sie zu systematisieren: Zum einen setzt sich Etty Hillesum in intensiver Weise selbstreflexiv mit ihrer eigenen Persönlichkeit auseinander, einschließlich ihrer Schwächen und innerer Konflikte. Sie beschreibt, wie sie manchmal Scham gegenüber ihrer eigenen Unvollkommenheit empfindet:
„Hauptsächlich ist es, glaube ich, ein Schamgefühl. Große Hemmung, wage nicht, die Dinge preiszugeben, frei aus mir hinausströmen zu lassen, und doch muss es sein, wenn ich auf Dauer das Leben zu einem angemessenen und zufriedenstellenden Ende bringen will. […] Intellektuell bin ich in der Lage, alles zu ergründen, […], und doch: Dort sehr tief sitzt ein zusammengeballter Knäuel, er hat mich etwas fest im Griff, und ich bin ab und zu doch nur ein ängstlicher, armer Tropf, trotz des klaren Denkens.“[2]
In ähnlicher Weise beschreibt sie Scham auch in Bezug auf einen von ihr empfundenen Egoismus, auf emotionale Abhängigkeiten, auf menschliche Unzulänglichkeit oder kleinliche Gedanken. Ebenso formuliert sie, dass sie Scham gegenüber den Erwartungen der anderen empfindet, ihnen nicht zu genügen oder gegenüber der eigenen Vulnerabilität.[3]
Zum anderen thematisiert Etty Hillesum Scham auch angesichts des kollektiven Leidens der Menschheit. Sie meint hier eine tiefere, existenzielle Form von Scham, die aus der brutalen Realität der Deportation und Vernichtung resultiert. In ihren Texten spricht sie oft darüber, wie sie die Entmenschlichung durch die Nazis und das damit einhergehende Leid als eine Schande für die gesamte Menschheit erlebt.[4] Sie reflektiert über die Abgründe menschlicher Grausamkeit und schreibt, dass die Verantwortung für diese Schande nicht nur den Tätern, sondern in gewisser Weise auch allen Menschen zukomme, da sie Ausdruck eines kollektiven moralischen Versagens sei. Dabei bleibt sie jedoch nicht im Gefühl der Scham stecken, sondern versucht, dieser Schande mit Liebe und Menschlichkeit zu begegnen.
Entmenschlichung durch die Nazis als Schande für die gesamte Menschheit
Darüber hinaus bildet bei Etty Hillesum die eigene körperlich-sexuelle Selbstwahrnehmung einen weiteren Aspekt von Scham. Vor allem in ihren frühen Tagebüchern reflektiert sie offen ihre sexuellen Beziehungen und ihre körperlichen Erfahrungen – häufig begleitet von einem Gefühl der Ambivalenz oder Scham. Sie zeigt sich hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch nach Freiheit und der Angst, in oberflächliche Begierden zu verfallen. Sie beschreibt ein Schamgefühl:
„Wie auch beim Geschlechtsverkehr der letzte befreiende Schrei immer scheu in der Brust stecken bleibt. In erotischer Hinsicht bin ich raffiniert […], um zu den guten Liebhaberinnen zu zählen, und die Liebe erscheint denn auch vollkommen, aber doch bleibt es Spielerei um das Wesentliche herum, es bleibt tief in mir drin etwas gefangen.“[5]
Im Laufe ihres Schreibprozesses gelingt es ihr, die eigene Körperlichkeit und Sexualität als Teil ihres Lebens anzunehmen. Sie verliert den schambesetzen Umgang mit ihrer eigenen gelebten Sexualität. Sie gibt übermächtigen Moralvorstellungen keinen Raum und schafft Schamnischen in Bezug auf ihre Sexualität ab. Wir können bei ihr lesen, wie sie alles angstfrei in Mannigfaltigkeit, Polarität und Ambivalenz vor Gott trägt. Es kann bei ihr gar von einer lustbetonten Spiritualität gesprochen werden: Sie verknüpft Sexualität – wenn sie bewusst gelebt wird – auf beeindruckende Weise mit ihrer Spiritualität.
Zugleich erkennt sie die Gefahr, sich in rein körperlichen Beziehungen zu verlieren, wenn diese nicht mit einer tieferen emotionalen und geistigen Verbundenheit einhergehen. Dieser Balanceakt zwischen körperlicher Leidenschaft und spiritueller Tiefe wird zu einem zentralen Thema ihrer Reflexionen. Auffallend ist, dass sie immer wieder die Verknüpfung zwischen ihrer Sexualität und der Ausdrucksform im Glaubensakt herstellt. In zahlreichen Tagebucheinträgen beschreibt sie das Knien als göttliche Gebärde. Ergriffen durch die Begegnung mit der Ahnung der Unermesslichkeit Gottes findet sie sich in einer Gebärde wieder, die sie mit der Gebärde der Sexualität vergleicht – jenseits einer Schambehaftung:
„Gestern Abend, kurz vor dem Zubettgehen, kniete ich auf einmal mitten in diesem großen Zimmer zwischen den Stahlstühlen auf dem hellen Binsenteppich. So ganz von allein. Zu Boden gezwungen durch etwas, das stärker war als ich selbst. Vor einiger Zeit sagte ich zu mir selbst: Ich übe mich im Knien. Ich genierte mich noch zu stark wegen dieser Gebärde, die genauso intim ist wie die Gebärden der Liebe, über die man auch nicht sprechen kann […].“[6]
In ihren späteren Tagebucheinträgen gilt ihre Scham vielmehr dem Glaubensakt als der Sexualität.
Insgesamt kann im Verlauf von Etty Hillesums Tagebüchern eine Entwicklung von Selbstzweifel zur Selbstliebe abgelesen werden: In den frühen Tagebucheinträgen ist sie oft von einer starken Selbstbeobachtung geprägt, die häufig in Selbstkritik und Scham mündet. Sie reflektiert viel über ihre Unsicherheiten in Beziehungen, ihre Körperlichkeit, ihre Vulnerabilität und ihre vermeintlichen Unzulänglichkeiten. Hier zeigt sich eine innere Zerrissenheit. In dieser Phase ist Scham für sie eng mit dem Gefühl verbunden, nicht zu genügen – sowohl in ihrer eigenen Wahrnehmung als auch im Vergleich zu äußeren Idealen.
eine Entwicklung von Selbstzweifel zur Selbstliebe
Mit der Zeit entwickelt Etty Hillesum ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass Scham kein Hindernis sein muss. Scham wird für sie zu einer Art Wachstumswahrnehmung, mit der sie beginnt, die Schamempfindungen und Unzulänglichkeit zu hinterfragen. In dieser Phase sind ihr die Tagebücher ein Werkzeug, um sich selbst ehrlich und immer tiefer zu erkennen. Scham wird dabei zu einer Art Katalysator, der ihr hilft, sich von Illusionen und Selbsttäuschungen zu befreien.
Im weiteren Verlauf ihrer Tagebücher zeichnet sich eine wachsende Gelassenheit und Selbstannahme ab. Etty Hillesum lernt, ihre Schamgefühle nicht mehr zu verdrängen, sondern sie zu integrieren.[7] Das Annehmen der eigenen Menschlichkeit – in all ihren Widersprüchen und Unvollkommenheiten – führt bei ihr zu einer tiefen inneren Freiheit.
In der letzten Phase ihrer Tagebücher weitet sich ihr Verständnis von Scham aus. Scham ist für sie weniger eine persönliche Erfahrung, sondern wird zu einer kollektiven, existenziellen Dimension. Sie empfindet Scham angesichts der Grausamkeit und Entmenschlichung, die sie durch die Nazis erlebt. Zugleich weigert sie sich, in Bitterkeit, Verzweiflung oder Hass zu versinken. Sie hat gelernt, Scham in Mitgefühl und Stärke zu transformieren, indem sie sich selbst als Teil eines größeren Ganzen versteht.
Innerhalb des Schreibprozesses ihrer Tagebücher erkennt sie Scham als einen natürlichen Teil des Menschseins an, sieht darin jedoch auch das Potenzial für Wachstum, Transformation und innerer Freiheit. Ihre Schriften zeigen, wie sie versucht, Scham durch Selbstannahme, Liebe – Selbstliebe, Gottliebe, Menschenliebe, gar Feindesliebe – und einen tiefen Glauben an die Menschheit zu integrieren.
Scham als einen natürlichen Teil des Menschseins
Die inspirierende, intellektuelle und verblüffend moderne Frau, Etty Hillesum, ermächtigt sich in einer Zeitspanne von nicht einmal zwei Jahren ihrer eigenen Scham im Schreiben ihrer Tagebücher, die für sie als eine Art Handwerkzeug dienen und in denen sie ihre tiefgreifenden und differenzierten Gedanken in Worte kleiden kann. Im eigenen Schreibprozess kehrt sie ihr Innerstes nach außen, findet Worte und trägt so all ihre innerlichen Gedanken vor Gott. An ihrer Entwicklung, die in den Tagebüchern aufbricht, kann ein positiver und wertschätzender Zugang zu Scham abgelesen werden. Sie erlebt eine paradoxe Einheit von Scham und Nicht-Scham, die konventionelle Einschränkungen durch das Schamgefühl überwindet, ohne die Scham selbst zu verletzen oder zu leugnen. In dem sie sich ihrer verletzlichen schambesetzten Seite widmet, sich selbst aussetzt, gelingt es ihr, sich aus normativ aufgeladenen Schamnischen zu befreien.
___

[1] Hillesum, Etty, Ich will die Chronistin dieser Zeit werden. Sämtliche Tagebücher und Briefe 1041-1943. Hg. von Klaas A. D. Smelik, München 2023. Sämtliche Zitate sind aus dieser Ausgabe. Vgl. hierzu auch den Beitrag von Christina Siever vom 25.08.2023 (https://www.feinschwarz.net/etty-hillesum-uebersetzen/) und von Ursula Rapp vom 20.09.2023 (https://www.feinschwarz.net/ernst-machen-mit-den-dingen-des-koerpers/).
[2] Hillesum, Etty, Ich will die Chronistin dieser Zeit werden, 24 1.
Beitragsbild: Michael Wittenbruch; Büste von Ans Joosten, „With a golden mask“.