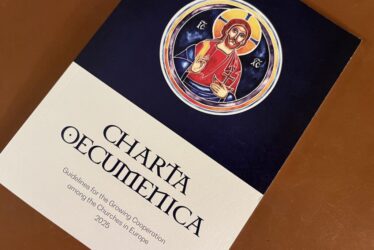In Irland und den USA ist der heutige St. Patrick’s Day ein Fixtermin im Festkalender. Dara Straub wirft anlässlich seines Gedenktags einen differenzierenden Blick auf den Heiligen Patrick zwischen religiöser Verehrung und nationalistischer Vereinnahmung.
„St. Patrick’s Day – a day on which we celebrate a great British Saint.“ Mit diesen Worten leiten die Moderatoren des Podcasts „The rest is history“[1] eine Folge zu St. Patrick ein. Ich gebe es nur ungern zu, aber St. Patrick, der nach Bono und dem Leprechaun (und manchmal in Vermischung mit diesem) möglicherweise die irische Galionsfigur schlechthin ist, war römischer Brite und kam von Britannien nach Irland.
Diese erste „Spannung“ gibt bereits einen Hinweis darauf, dass St. Patrick im weiteren Kontext irischer Geschichte eine verhältnismäßig komplexe Figur darstellt und nicht unbedingt ein ecken- und kantenloses christliches Idol. Gängige Betrachtungsweisen fokussieren sich häufig auf beispielsweise St. Patrick den Bischof, Missionar und Archetypen irisch-christlicher Frömmigkeit. Oder auf St. Patrick als Personifizierung dessen, was sich im Mainstream als „irische Kultur“ durchgesetzt hat und was am 17. März jedes Jahr einen Anlass gibt sich einen Shamrock anzustecken, den Chicago River grün zu färben und jede Menge Guinness zu trinken. Generally nothing wrong with that! Im Folgenden werde ich einen Blick darauf werfen, inwiefern in der Figur Saint Patrick die Bedeutung, aber auch die Ambivalenzen eines solchen religiösen und nationalen Identitätsstifters sichtbar werden.
St. Patrick als komplexe Figur
Wie wurde der britisch-römische Patricius also zum irischen Pádraig? Vermutlich lebte Patrick gegen Ende des 4. Jahrhunderts beziehungsweise im 5. Jahrhundert. Er hinterließ zwei Schriften: die Confessiones and den Epistola. Während diese wichtige historische Quellen für die „britischen Inseln“ des 4./5. Jahrhunderts sind, können sie nicht als Tatsachenberichte verstanden werden. Wie bei autobiographischen Schriften meistens der Fall, müssen sie als Patricks Interpretation seines eigenen Lebens gelesen werden. Dieser Interpretation zufolge wurde er von irischen Piraten nach Irland verschleppt und dort versklavt. Es war wohl keine Seltenheit zu dieser Zeit, dass irische Plünderer in den Teil Britanniens eindrangen, der römisch war. Während diese Verschleppung also plausibel wäre, mutet seine Fluchtgeschichte quer durch Irland etwas spektakulär an. Historiker*innen fachsimpeln dementsprechend, dass er möglicherweise aus anderen Gründen in Irland war (vielleicht ganz unromantisch aus Steuergründen!).[2]
Legendenbildungen um St. Patrick
Wirklich bemerkenswert ist allerdings, dass er später als Bischof nach Irland zurückkehrte. Spätestens hier verschwimmen die vielen, vielen Mythen, die sich um Patrick ranken mit dem, was sich tatsächlich in historischen Quellen findet. Manche dieser Legenden zeigen Patrick als wenig geduldig gegenüber der heidnisch-gälischen Bevölkerung, die sich nicht an die neuen christlichen Bräuche anpasste. Falls sich schon mal jemand gewundert hat, warum ihm*ihr in Irland noch nie eine Schlange begegnet ist: Saint Patrick hat sie alle vertrieben. Und auch wenn die Christianisierung Irlands wohl eher als group effort betrachtet werden muss, wird nur Patrick die Genialität zugeschrieben, die Trinität anhand der drei Blätter des Shamrock erklärt zu haben. Was der botanische Unterschied zwischen einem Shamrock und einem Kleeblat (engl. clover) ist, ist für mich schwer nachzuvollziehen, aber man kann vermutlich festhalten, dass ein vierblättriges Kleeblatt nicht hilfreich wäre, um die Trinität zu erläutern.
ein Heiliger im Dienst irisch-nationaler Unabhängigkeitsbemühungen
„Saint Patrick hat das Christentum nach Irland gebracht“ lautet demnach die einfache Formel. Die Bedeutung dessen wird deutlich, wenn man bedenkt, welche politische Bedeutung religiöse Identität in den letzten paar Jahrhunderten in Irland hatte. Während sowohl Katholik*innen als auch Protestant*innen Patrick als Legitimationsfigur ihrer jeweiligen Ansprüche auf Irland benutzten, lässt sich festhalten, dass Patrick und vor allem auch Saint Patrick’s Day durchaus zum Ausdruck irisch-nationaler Unabhängigkeitsbemühungen von der britischen Imperialmacht stilisiert wurden. Die gängige Interpretation dieser Unabhängigkeitskämpfe als rein katholisches Projekt ist nicht ganz akurat. Einer der wichtigsten Unabhängigkeitskämpfer des 18. Jahrhunderts, Theobald Wolfe Tone, war beispielsweise Protestant. Nichtsdestotrotz stellt die Sozialwissenschaftlerin Gladys Ganiel einen Zusammenhang her zwischen dem Bestreben die irische Identität in Zeiten von Unterdrückung zu schützen und zu erhalten und dem Konzept einer absoluten und reinen Katholizität. Katholische Frömmigkeit anzufragen kam der Infragestellung einer eigenständigen, nicht-britischen, irischen Identität gleich. Ganiel zufolge ist das Ausmaß und die Vertuschung sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern in der irischen katholischen Kirche eine Konsequenz aus dieser puristischen Verschmelzung von Katholizität und irischer nationaler Identität[3]: weil es nicht sein konnte, passierte es angeblich auch nicht. Die Verschmelzung von Irisch-sein und irisch-christlicher Frömmigkeit in der Figur Patricks, muss in solchen Narrativen also kritisch betrachtet werden.
Konzept einer absoluten und reinen Katholizität
Saint Patrick ist so sehr mit irischer Identität verstrickt, dass „Paddy“ lange Zeit als abwertender Name für Iren verwendet wurde. Prägnant in einer Szene aus dem Film „The wind that shakes the barley“, der den Übergang vom irischen Unabhängigkeitskrieg (irisch: Cogadh na Saoirse = Freiheitskrieg) zum Bürgerkrieg erzählt: Als die britischen „Truppen“ bei ihrem Abzug durch die Straßen marschieren sitzt einer der irischen Protagonisten mit einem Pintglas ausgestattet am Straßenrand, schaut zu und ruft ihnen hinterher: „One way ticket now lads“. Einer der britischen Soldaten antwortet mit „Fuck off Paddy“ woraufhin besagter „Paddy“ mit „And I’ll see you in hell“ antwortet. Ziemlich witzig, wenn es nicht so tragisch wäre.
Neben den geäußerten Bedenken, nationale Identität zu eng mit religiösen Persönlichkeiten zu verknüpfen, ist es gleichzeitig die verständliche Reaktion eines Volkes unter Besatzung, all das hochzuhalten, was die eigene Identität festigt. Es ist nicht schwer nachzuvollziehen, dass in Zeiten, der Repressionen gegen die irische Sprache, irische Sportarten, aber auch ganz konkret gegen Katholik*innen einer Figur wie Saint Patrick besondere Bedeutung in Bezug auf Sinngebung und Durchhaltevermögen zugeschrieben werden.
St. Patrick als Gallionisfigur der Unabhängigkeit – auch über Irland hinaus
Saint Patrick’s Day ist nicht lediglich ein Anlass für Ir*innen weltweit ihre Herkunft zu feiern, sondern bedeutet für den modernen irischen Staat vor allem auch eine Plattform sich als Teil der Völkergemeinschaft zu präsentieren – auch und vor allem in einer Zeit, in der jegliche Behauptung von katholischer Reinheit ihre Plausibilität verloren hat. Für Saint Patrick’s Day 2022, wenige Wochen nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, veröffentlichte das Irische Außenmisiniterium ein Video, das die Saint Patrick’s Day Feier in diesem Jahr hauptsächlich als einen Deklaration der Solidarität Irlands mit der Ukraine interpretierte.[4] Die spirituellen Narrative von Saint Patrick als Inbegriff irischer Frömmigkeit und Christlichkeit ist in der weiteren Diskussion um die politische Relevanz von theologischen Motiven und der Frage nach der Rolle von christlicher Theologie und Kirche in den Herausforderungen durchaus kritisch zu betrachten und eine vertiefte Auseinandersetzung wäre wohl lohnenswert. Nichtsdestotrotz bleibt sein Festtag meines Erachtens ein Tag, an dem Irland und seine komplexe Geschichte sichtbar werden können – auch wenn das manchmal zugegebenermaßen in sehr extravaganten und weithergeholten Ausdrucksweisen resultiert. In diesem Sinne: Lá Fhéile Pádraig sona duit!
—
[1] https://open.spotify.com/episode/6VErwfmSEIKp2Y54Ytxh1s?si=4c3aa77097034bf8
[2] Vgl. Flechner, Roy (2019). Saint Patrick Retold. The Legend and History of Ireland’s Patron Saint. Princeton, NJ, Princeton University Press, 106f.
[3] Vgl. Ganiel, Gladys (2016). Transforming post-Catholic Ireland. Religious practice in late modernity. Oxford, Oxford University Press.
[4] https://www.youtube.com/watch?v=2vRx6CczPGg
Beitragbild: Dara Straub

Dara Straub ist Mitglied der Research Unit of Systematic Theology an der KU Leuven und promoviert bei Michael Schüßler (Tübingen) und Judith Gruber (Leuven). Ihre Forschung beschäftigt sich vornehmlich mit Macht-Wissens-Strukturen in und der Kontextualität von christlich-theologischer Wissensproduktion.