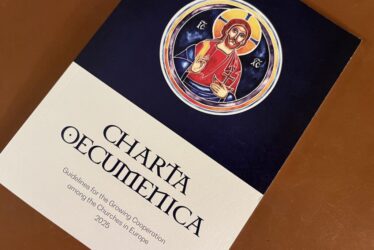David Neuhold wirft zum 1700-jährigen Jubiläum einen Blick auf das Konzil von Nizäa und die Interessen Kaiser Konstantins bei der Festlegung des Ostertermins.
In einem Jubiläumsjahr wird herkömmlich viel geschrieben. Umso mehr ist das der Fall, wenn es so mächtig ist und gleich 17 Jahrhunderte umfasst wie das diesjährige Erinnern an Nizäa. Obgleich die Dokumentationslage zum Konzil nicht überbordend üppig sich zeigt, versteht sich das Erinnern gewissermassen von selbst.
Und doch: Es geht immer zugleich um die Magie der Zahlen, der wir tagtäglich folgen. Wer kann sich den Umfang von 1700 Jahre, also an die 70 Generationen Menschenleben, wirklich exakt vorstellen?
Rezeption und Intentionen im Rahmen einer Wirkungsgeschichte
Nizäa, im Jahre 325 abgehalten, gilt als Startpunkt bzw. als Auftakt der so bezeichneten ökumenischen Konzilien. Auch das ein Konstrukt. Denn das «ökumenische Konzil» hat weniger mit der Bischofsversammlung in der Zeit zu tun als mit dessen Rezeption und den Intentionen im Rahmen einer Wirkungsgeschichte. Wichtig ist, was an- und aufgenommen wird. Schon davor hatte es nämlich Konzilien gegeben. Das frühe Christentum zeichnete sich durch intensive Synodalität aus. Konzilien machten als Knotenpunkte die kirchlichen Netzwerke strukturell attraktiv. Synodalität jedoch auf Bischofssynoden – wie jene von Nizäa – zu verkürzen, wäre zu kurz gegriffen.
Was Nizäa 325 anbelangt, ist es wohl so, dass im Blick der Nachwelt entscheidende Fragen verhandelt wurden. Aus diesem Grund wurde Nizäa zu diesem oben so genannten wichtigen Startpunkt in einer Zeit des Umbruchs. 324 nämlich hatte Konstantin seinen Rivalen und Mitkaiser im Osten besiegt – im Konzilsjahr wurde der Konkurrent Licinius beiseitegeschafft. Zumindest was den Mittelmeerraum betrifft, stand Konstantin vor einer Art Weltherrschaft, die Tetrarchie als kollektive Exekutive aus vier Regenten mit jeweiligen Hauptstädten war passé.
Konstantin war auf Einheit im Reich bedacht, aber auch auf kirchliche Einheit.
Damit ist schon angedeutet, dass wir neben den Bischöfen mit dem römischen Kaiser einen wichtigen Player sehen, dem letztlich dieses spezifische Konzil mitzuverdanken ist. «Engelsgleich» betrat er seinem «Biografen» zu Folge die Aula. Konstantin war auf Einheit im Reich bedacht, aber auch auf kirchliche Einheit – Einheit kann ein gefährliches Wort sein, wie die Geschichte zeigt. Ohne formell Mitglied der Kirche zu sein, denn Konstantin war (zu diesem Zeitpunkt) nicht getauft, redete er als Pontifex Maximus ein Wörtchen in Kirchenbelangen mit. Diese Freiheit hat er sich genommen und keiner hat ihm gross widersprochen. Widerspruch hätte wohl rasche Kopfkürzung, zumindest aber dauerhaftes Exil bedeutet.
Nicht nur für die Einberufung und den Rahmen des Konzils war der Kaiser federführend. Das kaiserliche Post- und Transportwesen wurde aktiviert. Eusebius spricht ausdrücklich von der Bereitstellung von Lasttieren, die wohl dem Transport von Personal und Unterlagen dienten. Kurz: Offizielle, «staatliche» Strukturen arbeiteten dem Unterfangen zu. Eine logistische Mobilisierung ist zu ersehen – Gegner dieser Massnahmen meinten polemisch, das hätte die Staatspost in den Ruin getrieben. Ein idyllischer kaiserlicher Sommersitz war zudem Austragungsort. Darüber hinaus liess es sich der «Apostelgleiche» nicht nehmen, auch inhaltlich mitzureden.
Fülle und Vollständigkeit wird signalisiert und suggriert.
Mehr als 200 Bischöfe waren zur Bischofsversammlung angereist. Der Tradition nach handelte es sich um 318 Gottesmänner. Darin ist eine Anspielung an die Knechte Abrahams zu ersehen: In Genesis 14,4 heisst es, dass Abrahams gesamte Gefolg- und Sippschaft diese Zahl umfasste. Ob sich Konstantin in diesem Bild verbleibend als neuer Abraham sah, das habe ich weder irgendwo gelesen und auch nicht nachgeprüft. Auf jeden Fall wird Fülle und Vollständigkeit signalisiert und suggeriert. Auch ein Konzil will ja verkauft werden!
Aber mit der Unschuld ist es gleich einmal vorbei: Man müsste eigentlich nicht so weit in der Kirchengeschichte zurückgehen, um zu sehen, dass Konzilsentscheide keineswegs durchgehend harmlos sind. Mit folgendem Beispiel von Nizäa kann dies illustriert werden. Dieses geht über den dort zentral verhandelten Arius-Streit hinaus – und zugleich ist es irgendwie mit der Frage zutiefst verbunden. Denn in beiden Angelegenheiten werden Verbindungen gekappt bzw. andersrum gesagt: Es vollziehen sich Kreationen eines eigenen, unabhängigen Selbstverständnisses. Schauen wir das im Detail an. Die Festlegung eines gemeinsamen Ostertermins wurde also debattiert.
Kaiser Konstantin legte Wert auf die Kalenderfrage.
Vor allem der Moderator und informelle Vorsitzende des Konzils, Kaiser Konstantin, legte Wert auf die Kalenderfrage. Als kultur- und religionspolitischer «Revolutionär» (Paul Veyne) betonte er den Kalender. Er wollte sich in ihn einschreiben: Ostern sollte zum für ihn «richtigen» Zeitpunkt gefeiert werden. Kosmische, theologische und politische Motive durchdrangen sich bei der Terminierung unweigerlich. Zu welchem Schluss kam also die Bischofssynode in Nizäa und welche Implikationen hatte dies?
Dass das damals wie heute wichtigste Fest der Christenheit im Frühjahr gefeiert werden sollte, das war klar und ist gesetzt. Referenz war und blieb das Pessah-Fest, welches Jesus selbst vor seinem Tod feierte. Probleme aber gab es, weil im Rahmen des Mondkalenders es gar nicht immer so einfach war, den Frühjahresmonat als solchen zu bestimmen. Dieser Punkt kam auf jeden Fall auf und stand zur Debatte. Aber um die komplexe Bestimmung solcher Details soll es an dieser Stelle nicht gehen. Wichtiger sind uns Folgeimplikationen. Nicht das Verlaufsprotokoll, das wir nicht kennen, ist hier von Belang, sondern die Ergebnisse.
Ostern sei nach dem ersten Frühlingsvollmond im Frühjahr zu feiern.
Als Produkt der Konzilsdebatten kommunizierte der Kaiser, dass das jährliche Osterfest nach dem ersten Frühlingsvollmond zu feiern sei – und zwar im ganzen Erdkreis! Bescheidenheit war als Tugend nicht ausdrücklich in Konstantins Personalausweis vermerkt. Mit dieser Festlegung kommt zum Ausdruck, dass einerseits der Wunsch nach einem gemeinsamen Termin stark ins Zentrum gerückt wurde – etwas anderes würde man von einem Bischofskonzil auch kaum erwarten – und dass andererseits die bestehende Praxis der «Quartodezimaner» als eine überholte betrachte wurde. Diese christlichen Gruppierungen feierten mit den jüdischen Glaubensgeschwistern das Hochfest jeweils am 14. Nisan, zum Zeitpunkt des ersten Frühlingsvollmondes also.
Der Tag der Sonne, zugleich Herrentag, wurde favorisiert … und favorisierte einen Bruch mit dem Judentum.
Das Konzil von Nizäa orientierte sich nun deutlich auffälliger an dem Gestirn der Sonne. Der Konstantin sehr liebe «Sonntag» kam dabei ins Spiel. Der Tag der Sonne, zugleich Herrentag, wurde favorisiert: Ostern ist an einem Sonntag zu feiern, nicht an einem willkürlich dahergelaufenen Wochentag! Das hat Konstantin gefallen, denn seiner solaren Frömmigkeit kam es enorm entgegen. So hatte er eine besondere Freude an der Verlautbarung dieser neuen disziplinar-liturgischen Bestimmung.
Diese erwünschte bzw. ersehnte Regelung, die implizierte, dass es noch nicht überall so gehandhabt wurde und eine Art Pluralität gab, favorisierte aber zugleich einen Bruch mit dem Judentum. Ein Emanzipationswunsch wird deutlich, weil zentrale Festkalender nunmehr stärker divergierender Gruppen damit voneinander gekoppelt werden.
Innovation bietet Reibeflächen, ja noch mehr: Abgrenzungsgeschehen.
Ähnlich wie in der Debatte zu Arius kam es damit auf dem Konzil zu einer Akzentverschiebung. Die Aufwertung des Göttlichen in Jesus, seine deklarierte «Ungeschaffenheit» und «Wesensgleichheit» bewirkte für jüdisches Denken und Empfinden eine ähnliche Distanzierung wie die postulierte neue Feierkultur, die sich von Bestehendem ablöste. Innovation bietet Reibeflächen, ja noch mehr: Abgrenzungsgeschehen.
Beide Ideen, die «Wesensgleichheit» als auch der (neue) Osterfesttermin, sollten sich auf lange Sicht in der Geschichte als «erfolgreich» erweisen. Freilich hat sich dieses Gedankengut nicht unmittelbar und ohne Gegenwind durchsetzen lassen. In einer longue-durée Betrachtung aber wurde gerade durch solche Akzentuierungen das Konzil in der Rezeption geadelt, kurz zu dem, was es heute ist und warum es eigentlich ein Jubiläum gibt. Apropos: Nach einem gemeinsamen Ostertermin wird – auf andere Weise – noch immer gesucht. Papst Franziskus setzt sich dafür ein, nachdem dies z.B. schon intensiv der Konzilspapst Paul VI. tat.
die griechische Siegesgöttin im Namen der Sommerresidenz des Kaisers
Interessanterweise findet sich die griechische Siegesgöttin im Namen der Sommerresidenz des Kaisers, in welcher die zum Teil noch von der Verfolgungszeit malträtierten Bischöfe zusammenkamen: Die Nike. So könnte uns der Anblick von spezifischen, sehr geläufigen Sportschuhen gleichen Namens immer wieder an dieses Konzil erinnern – und gerade seine Ambivalenzen. Ob das Jubiläum von Nizäa in 100 Jahren auch noch gross begangen wird? Das vermeintliche Toleranzedikt von 313, dessen Jubiläum 1913 in der katholischen Welt eifrig begangen wurde, stand 2013 in wenigen Festagenden. Man bzw. frau darf also gespannt sein!
Beitragsbild: Brad Hostetler auf Wikimedia Commons

David Neuhold, verheiratet, Vater zweier erwachsener Kinder, nach Studium in Graz und Freiburg i. Ue. wurde er 2023 zum Professor für Kirchengeschichte an die Theologische Hochschule Chur berufen. Seit Herbstsemester 2024 ist er Professor für Kirchengeschichte an der Universität Luzern.
Bild: Noemi Neuhold