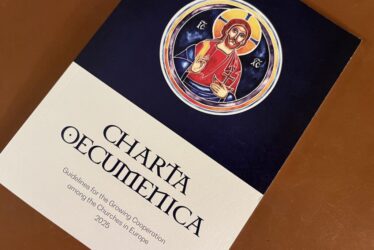Das „Heilige Jahr“ 2025 steht unter dem Motto „Pilger der Hoffnung“. Roland Stadler (Gurk-Klagenfurt) ist Experte für Pilgerseelsorge. Er sucht nach den pastoralen Anknüpfungspunkten eines aktuellen Trends.
Das Motto des Heiligen Jahres 2025 „Peregrinantes in Spem“ – Pilger der Hoffnung – lenkt den Blick auf ein Phänomen, das einerseits im Trend der Zeit zu liegen scheint und andererseits über alle Zeiten hinweg zu den Grundvollzügen aller Religionsgemeinschaften gehört: das Pilgern und Wallfahren. Darin lassen sich vielfache pastorale Anknüpfungspunkte sowie Chancen und Herausforderungen finden.
Ganzheit von Körperlichkeit, alltäglich Menschlichen und eine Erfahrung des Transzendenten.
Menschen brechen mit unterschiedlichsten Motiven auf um sich selbst, Gemeinschaft und/oder spirituelle Erfahrungen zu finden. So ist es für die einen die Suche nach der Begegnung mit dem eigenen Selbst, für die anderen die Suche nach der Begegnung mit dem Göttlichen, weshalb sie sich auf den Weg machen. Nicht selten, so berichten Pilgernde, ist es jedoch am Ende gerade die Ganzheit von Körperlichkeit, alltäglich Menschlichen und eine Erfahrung des Transzendenten, welche das Glück des Pilgerns ausmacht.
So verschieden wie die Motive des Aufbrechens sind auch die Formen des Unterwegsseins: von individuellen Alleingängen über kleine Grüppchen bis hin zur großen Wallfahrtsgruppe spannt sich der Bogen. Mit diesen unterschiedlichsten Zugängen ist eine Pastoral für Pilgernde Chance und Herausforderung für die Kirche und erfordert eine hohe pastorale Sensibilität für all jene, welche losgehen, um letztlich zur Fülle des Lebens zu gelangen.
Pilgern ist im Gegensatz zum Wallfahren stärker vom individuellen Charakter mit den dazugehörenden Freiheiten geprägt.
Obwohl es in der Geschichte immer schon Individualpilger:innen gab, war das Bild der gemeinsamen Pilgerwanderung und -reise vorherrschend. An dieser Stelle ist auf eine Einzigartigkeit der deutschen Sprache hinzuweisen. Hier gibt es die beiden Begriffe Pilgern und Wallfahren. In ein Bild gebracht: Beide Begriffe (oder Phänomene) gleichen Geschwistern – sie sind einander verwandt, ähnlich und doch einzigartig. Wallfahren beschreibt meist das wiederholende, rituelle Unterwegssein in einer Gruppe auf ein Wallfahrtsziel zu. Pilgern ist hingegen stärker vom individuellen Charakter mit den dazugehörenden Freiheiten geprägt. Zudem wurde und wird für gewöhnlich ein längerer Pilgerweg nur einmal im Leben absolviert.
Insofern verwundert es nicht, dass entsprechend unserer Zeit, welche das Individuelle stark betont, meist vom Pilgern und weniger vom Wallfahren die Rede ist. Empirisch deckt sich dieser Befund mit der Tatsache, dass auf Nachfrage hin die Verantwortlichen großer Wallfahrts- bzw. Pilgerziele wie Altötting oder Mariazell bestätigen, dass die Ankünfte von klassischen Wallfahrtsgruppen eher rückläufig, die Ankünfte von Individualpilger:innen eher im Steigen sind. Allein der Blick auf die Zahlen von Santiago de Compostella zeigt: waren es vor drei Jahrzehnten nur einige Tausend, welche sich die Pilgerurkunde holten, sind es 2024 bereits knapp eine halbe Million gewesen.[1]
Das Thema des Heiligen Jahres 2025 kann nun Ermutigung sein, die gemeinschaftlichen wie die individuellen Dimensionen spirituellen Unterwegsseins zu vertiefen und pastoral fruchtbar zu machen.
Bild des wandernden Gottesvolkes und der pilgernden Kirche
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, wie das gemeinsame Unterwegssein bereits von Anfang an die Geschichte des Gottesvolkes geprägt hat. Es ist der Verdienst des Zweiten Vatikanischen Konzils, das Bild des wandernden Gottesvolkes und der pilgernden Kirche wieder neu ins Bewusstsein des kirchlichen Lebens gebracht zu haben. Beispielhaft seien dazu Lumen Gentium 8, Unitatis Redintegratio 6, Dei Verbum 7 oder Ad Gentes 2 genannt.[2]
Als kirchliche Gemeinschaft gemeinsam unterwegs zu sein, ganz konkret in der Schöpfung vor unserer Haustür, in kühlenden Wäldern und im Staub der Feldwege, aber ebenso als Metapher für das pastorale Unterwegssein der Pfarrgemeinde gesehen, hat belebenden Charakter in seiner innerkirchlichen Dimension wie in seiner Außenwirkung. Es ist erfahrungsgemäß ein lohnendes pastorales Unterfangen, an alte Wallfahrtstraditionen anzuknüpfen und deren Inhalte mit einer zeitgemäßen Form und Sprache neu zu bekleiden. So verzeichnen in Österreich viele pfarrliche und diözesane Pilgerangebote, ein- oder mehrtägig, einen regen Zulauf. Vielfach gelingt es dabei, das individuelle Element in Form von Impulsen, Gebetstexten oder persönlicher Stille mit dem gemeinschaftlichen Element im Gehen, Singen, Austauschen und ähnlichem zu verbinden. Es scheint den Nerv der Zeit zu treffen, dass der Mensch individuell und in Gemeinschaft unterwegs sein möchte. Dafür eine gute Balance zu finden ist eine echte Chance pastoralen Lebens, sowohl für Pfarrgemeinden als auch für die Ansprache von Menschen, die der Kirche eher distanziert gegenüberstehen.
Es ist ein Merkmal der Gastfreundschaft, dass sie bereichert.
Menschen unterwegs benötigen immer wieder einmal Unterstützung. So ist die urchristliche Tugend der Gastfreundschaft (vgl. dazu Hebr 13,2) eine weitere Chance – wie Herausforderung – für unsere Gemeinden. Gastfreundschaft kann hier in vielfältiger Weise ausgebaut werden: vom konkreten Trinkbrunnen neben der Kirche oder einem kleinen Pilger:innenzimmer im Pfarrhof bis hin zu einem Gespräch, bei dem ausreichend Zeit für einen Austausch im Geiste ist. Es ist ein Merkmal der Gastfreundschaft, dass sie bereichert: sowohl den Gast als auch den Gastgeber, die Gastgeberin. Hier ist die Frage zu stellen, inwieweit unsere Kirchen ‚Rastplätze der Seele‘ sind – in ihrer äußeren Gestaltung und Ästhetik als auch in der inhaltlichen Aufbereitung der steinernen und künstlerischen Botschaften des Glaubens. Im Motu Proprio ‚Sanctuarium in Ecclesia‘ schrieb Papst Franziskus 2017 an die Verantwortlichen der Wallfahrtsorte, die Rolle dieser „Zufluchtsorte“ zu stärken. Bedeutsam seien sie deshalb, da sie für die Pilgernden „eine Stütze für ihren täglichen Weg in der Pfarrei“ seien (Art. 3). Dieses gilt selbstverständlich nicht nur für die großen Wallfahrtsorte. Das Mindestmaß an Gastfreundschaft einer Pfarrgemeinde sollte eine geöffnete Kirche sein. Gar nicht so selten berichten Pilgerinnen und Pilger, dass sie vor verschlossenen Türen gestanden seien.
Viele sind unterwegs mit dem Motiv der Sinnsuche, der Neuorientierung, des Fragens nach der Fülle des Lebens.
Erfahrungen gelebter Begegnungskultur führen zu einem nächsten Aspekt – der evangelisierenden und missionierenden Dimension. Damit ist heute selbstverständlich ein behutsames, situations- und personengerechtes Bezeugen des Evangeliums in Tat und Wort zu verstehen. Viele sind unterwegs mit dem Motiv der Sinnsuche, der Neuorientierung, des Fragens nach der Fülle des Lebens. Pilgerinnen und Pilger sind in der Regel offen für Gespräche am Wegrand ‚über Gott und die Welt‘. Dies ist eine gute pastorale Gelegenheit, mit den Suchenden und Fragenden in Kontakt zu kommen und mit dem, was sie bewegt. Diesen Grundauftrag hat Papst Franziskus 2017 bereits in ‚Sanctuarium in Ecclesia‘ betont und mit der Eingliederung der Agenden für Pilger- und Wallfahrtsseelsorge im Dikasterium für Evangelisierung 2022 nochmals unterstrichen.
Transformativer Charakter des Pilgerns in digitalen Zeiten,
Abschließend noch ein Gedanke zum transformativen Charakter des Pilgerns in digitalen Zeiten. Pilgern ist heute wieder genau das, was Hippokrates, der berühmte Arzt der Antike, mit dem Zitat „Gehen ist des Menschen beste Medizin“ verdeutlicht: eine ganzheitliche Bewegungskur für Leib und Seele. Es ist das erneute Zusammenfinden von Körper, Geist und Seele, von Individuum und Gemeinschaft.
Im Unterwegssein, im Eintauchen in die Schöpfung und in die Lebendigkeit menschlicher Begegnungen scheint Pilgern und Wallfahren ein guter Gegenpol zu Arbeit und Leben mit unseren digitalen Begleitern zu sein. All dies kann helfen, wieder sich selbst und das Menschsein in allen Dimensionen zu erfahren und sich heilsam zu wandeln. Das Wesentliche kann wieder neu entdeckt werden. „Manche brechen auf um Gott zu suchen und finden sich selbst, andere brechen auf um sich selbst zu suchen und finden Gott“, wie ein altes Pilgerwort sagt.
Digital Detox tut dem Menschen gut, bedeutet es doch das Handy abzuschalten und die Sinne neu zu schärfen. Wissend, dass die Dosis das Gift macht, gilt jedoch auch: für die Vorbereitung können die digitalen Helfer durchaus dienlich sein. Pilgern bedeutet in seiner Wortwurzel „über die Felder, Äcker gehen“. Viele Pilgerwege verbinden grenzüberschreitend Länder, Regionen, Völker, Kulturen, Sprachen – in der Vorbereitungszeit sich dazu online schlau zu machen, mag bestimmt hilfreich sein. Und nicht zuletzt: sollte wirklich unterwegs ein Notfall eintreten ist das ausgeschaltete Handy im Rucksack noch immer eine gute, sinnvolle Rückversicherung, um Hilfe zu holen und auch um vielleicht zu fragen – sollte gerade keine Menschenseele am Wegesrand sein –, wo für die „peregrinantes in spem“ die nächste Messe gefeiert wird…
—

[1] https://oficinadelperegrino.com
[2] Vgl. dazu: www.wallfahrtsservice.de/aktuelles/detail/ansicht/warum-nennt-das-ii-vatikanische-konzil-die-kirche-das-volk-gottes-unterwegs-2/ (24.3.2025)
Beitragsbild: Shutterstock