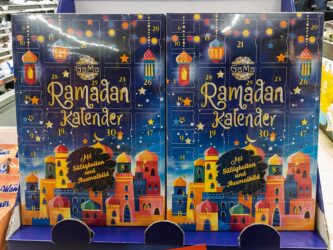Eine religionspädagogische Lektüre von Gerlinde Feines Texten zwischen Gefühl und Indifferenz. Von Matthias Gronover.
Gerlinde Feines Texte sind keine theologischen Traktate. Sie sind literarisch durchpulste Meditationen über das Menschliche – in seinem Verstummen, seinem Staunen, seiner Sehnsucht. Zwei Texte aus ihrem Band Habseligkeiten ragen für mich heraus: „Farben im Grau“ und „Gottes Blockade“. Beide nehmen je auf eigene Weise die religiöse Gegenwartskrise ernst – nicht als Problem mangelnder Dogmentreue, sondern als Frage nach der Gefühlsfähigkeit des Glaubens. Und sie tun das mit poetischer Wucht, die zugleich tröstlich und entlarvend ist.
nehmen je auf eigene Weise die religiöse Gegenwartskrise ernst
In diesem Beitrag möchte ich diese beiden Texte unter einem religionspädagogisch zugespitzten Gesichtspunkt lesen: Wie lässt sich mit einem solchen Schreiben in der religiösen Bildungsarbeit umgehen – in Zeiten, in denen religiöse Indifferenz nicht Abwehr, sondern Normalfall ist? Und: Welche didaktischen Potenziale liegen in dieser Weise des Schreibens, die Gefühle evoziert, ohne sie zu instrumentalisieren?
Wenn Sprache das Grau nicht übermalt, sondern ernst nimmt
Der Text „Farben im Grau“ (21-24) beginnt mit einer schlichten Szene: eine Bergwanderung im Geröll, inmitten sommerlicher Tristesse. Doch was sich zunächst als Naturbeschreibung ankündigt, kippt bald in eine existentielle Erkundung der „Sorge“, dieses grauenhaften Grundtons des Lebens. Die Sorge bekommt Farbe, Geruch, Klang – und schließlich ein Gesicht. Und doch bleibt sie diffus, ungreifbar, nicht abschließbar.
„Grau wäre die Sorge, wenn sie eine Farbe wäre.“
Feines Kunstgriff liegt darin, dass sie die Leser:innen nicht belehrt, sondern mitführt – sprachlich durch kurze, apodiktische Sätze, durch Rhythmus, Wiederholung, Lautlichkeit. Die Alliteration wird dabei zum dramaturgischen Mittel der Erschütterung. „Grau wäre die Sorge, wenn sie eine Farbe wäre. […] Sie röche nach Desinfektionsmittel und Urin und fauligen Verbänden. Sie klänge wie eine Durchsage in einer fremden Sprache an einem Ort, von dem du wegwillst und weißt nicht wie“ (21). Und noch einmal. Und wieder. Kein Trost durch Farbe, sondern Aufmerksamkeit im Grau. „Unter meinen Schuhen verändert sich die Farbe der Steine. Ich sehe genauer hin. Im Grau-in-Grau des Gerölls entdecke ich Farben. Ein Stück Marmor. Bunte Einschlüsse von Glimmer, Asbest und Eisen. Tiefes Schwarz von Schiefer und Feuchtigkeit“ (22). Peter Sloterdijk hat zum Grau auch schon ein Buch gefüllt, aus einer theologisch unverdächtigen Perspektive.
Das ist religionspädagogisch entscheidend. Feine verklärt nicht religiös, sondern sie arbeitet mit dem Ernst des Lebens. Die Theologie, so scheint es, kommt nur noch hinterher – sie kann den Steinmännchen folgen, die Kinder an den Bach gestellt haben, nicht aber selbst die Wegmarken verschieben.
Die Theologie kommt nur noch hinterher – sie kann nur den Steinmännchen folgen, die Kinder an den Bach gestellt haben.
Gott als Gefühlsfigur – oder: der Einbruch der Transzendenz im digitalen Raum
Noch radikaler greift der Text „Gottes Blockade“ (69-71) in unsere Gegenwart hinein. Feine entwickelt hier ein raffiniertes Spiel mit digitalen Metaphern, um eine geistliche Erfahrung zu beschreiben: Gottesnähe und Gottesferne, projiziert in die Mechanik von Follower-Logiken und Plattform-Diskursen. „Launig twitterte Gott über seine Schäfchen und ihre Eigenheiten. Verteilte Lob und Tadel, blieb aber immer locker. Ließ seine Gemeinde wissen, wenn er mit Allah und Buddha in der Kneipe saß und dass der Regen neulich etwas mit einer ausschweifenden Geburtstagsparty für irgendeinen Planeten zu tun hatte. Ärgerlich wurde er nur, wenn ihm Dinge unterstellt wurden, die so gar nicht zu ihm passten. Wer ihn für rachsüchtig hielt, für kleinlich oder moralinsauer, der musste ja ein gewaltiges Brett vor dem Kopf haben“ (70).
Gott, der nicht mehr zuhört, Gott, der überzieht, Gott, dem nicht mehr zu folgen ist.
Gott wird zum Account, zum ironischen Begleiter, zur Stimme der Kritik – und schließlich zur überfordernden, zornigen Instanz. Die Autorin ringt mit der Enttäuschung: Gott, der nicht mehr zuhört, Gott, der überzieht, Gott, dem nicht mehr zu folgen ist.
Diese spirituelle Erschöpfung trifft sich mit einer Erfahrung, die viele junge Menschen machen: der Erfahrung, dass religiöse Sprache oft nicht mehr trägt – nicht, weil sie falsch wäre, sondern weil sie das affektive Maß verliert. Wenn Gott nur noch brüllt, nur noch zürnt, keine Ambivalenz mehr zulässt, dann kann man ihm nicht mehr folgen. Dann kippt Beziehung in Überforderung. Entlastung geschieht durch Perspektivenumkehr. Nicht mehr der Wille, dass Gott einem folgt, ist entscheidend, sondern die eigene Nachfolge: „Ich folge Gott seit Jahren. Er hat mir alles beigebracht. Den Weg, die Richtung und dass der Raum oben der Beste ist. Da will ich hin. Und so Gott will, folgt er mir“ (71).
Entlastung geschieht durch Perspektivenumkehr.
Religiöse Indifferenz als hermeneutischer Schlüssel
Was macht diese Texte nun so anschlussfähig – auch in einer Bildungslandschaft, die längst von religiöser Indifferenz geprägt ist?
Es ist ihre Uneindeutigkeit. Ihre Bereitschaft, auszuhalten, dass Glaube nicht immer überzeugt, nicht immer spricht, nicht immer trägt. Ihre Kraft liegt in der Evokation – nicht in der Instruktion. Sie erzeugen Situationen, in denen das Religiöse nicht erklärt, sondern erfahren wird. Und sie zeigen: Gefühl ist nicht bloß ein weiches Pendant zur rationalen Theologie, sondern ein epistemologischer Raum, in dem sich Gottesbeziehung ereignen oder eben auch abbrechen kann.
Ihre Bereitschaft, auszuhalten, dass Glaube nicht immer überzeugt.
Daraus lässt sich religionspädagogisch lernen – vor allem im Umgang mit indifferenten Schüler:innen, die sich längst außerhalb kirchlicher Sprachspiele bewegen. Feines Texte provozieren keine Bekenntnisse, sie provozieren Wahrnehmung. Sie helfen, über das eigene Grau zu sprechen, die eigenen Erfahrungen zu erzählen – ohne dass ein fertiges System schon das Vokabular vorgibt.
In meinem eigenen Beitrag zur offenen Konfessionalität habe ich dafür plädiert, konfessionellen Religionsunterricht als Ort einer dialogischen Positionalität zu verstehen – nicht im Sinne einer Verwässerung, sondern als lernfähige Praxis, die das Fragmentarische anerkennt. Feines Texte sind solche Fragmente. Sie bringen keine Glaubenssicherheit, aber sie eröffnen ein Feld der Deutung – und das ist, wie Fritz Breithaupt gezeigt hat, der eigentliche Ort religiöser Emotionalität: in der erzählten Geschichte, die mich berührt, weil sie nicht fertig ist.
konfessioneller Religionsunterricht als lernfähige Praxis, die das Fragmentarische anerkennt
Texte wie leere Kirchenbänke
„Farben im Grau“ und „Gottes Blockade“ sind keine pädagogischen Texte – und gerade deshalb sind sie es. Sie funktionieren wie leere Kirchenbänke: Sie zwingen niemanden zum Sitzen, aber sie laden ein, Platz zu nehmen. Ihre Kraft liegt in der Nähe zum Gefühl – nicht sentimental, sondern verdichtet. In ihrer Sprachkunst liegt ein Potenzial für religiöse Bildung, die das Zuhören wichtiger nimmt als das Erklären.
Potenzial für religiöse Bildung, die das Zuhören wichtiger nimmt als das Erklären
Vielleicht ist das die eigentliche Pointe: Wo religiöse Indifferenz herrscht, braucht es keine stärkeren Argumente, sondern empfindsamere Texte. Und davon hat die Pfarrerin und Trägerin des Deutschen Predigtpreises Gerlinde Feine einige geschrieben, die lesenswert und inspirierend sind.

Viele der Texte sind Predigten, die sie gehalten hat und die am Ende des Buches im liturgischen Kalender verortet werden (115-119). Zahlreiche Abbildungen begleiten die Texte.

Prof. Dr. Matthias Gronover ist Stiftungsdirektor und Pädagogischer Vorstand der Stiftung Katholische Freie Schule der Diözese Rottenburg-Stuttgart.
Beitragsbild: Sharissa Johnson / unsplash.com