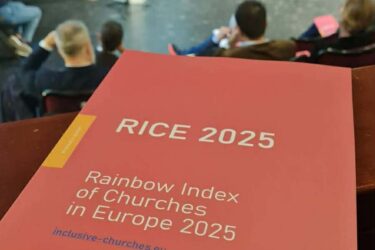In wenigen Tagen starten die UCI Road World Championships in Ruanda. Eine (friedens)ethische Reflexion von Maximilian Schell angesichts eines umstrittenen Austragungsortes.
2025 ist ein geschichtsträchtiges Jahr für viele Radsportbegeisterte weltweit: Erstmals in der mehr als 100-jährigen Austragungsgeschichte der Straßenrad-Weltmeisterschaft findet der Wettkampf nicht wie zumeist in Europa oder einem Land des globalen Nordens, sondern auf dem afrikanischen Kontinent statt, und zwar in Ruanda, einem kleinen Land im Herzen Afrikas. Vom 21.–28. September werden im sogenannten „Land der 1000 Hügel“ viele Stars der Tour de France wie Pauline Ferrand-Prévot, Liane Lippert und Tadej Pogačar den Mont Kigali erklimmen, die Kopfsteinpflaster der Mur du Kigali überwinden und je nach Strecke auf relativ kurzer Distanz zwischen 3.000 und 5.000 Höhenmeter zurücklegen. Die Routen gelten als anspruchsvoll, an manchen Gipfeln könnte die Luft dünn werden – wie gemacht für Kletterinnen und Kletterer, wie gemacht für radsportbegeisterte Zuschauende in Afrika und weltweit.
Alles nur „Sportswashing“?
Dass dieses Event überhaupt stattfinden kann, ist alles andere als selbstverständlich und war monatelang Gegenstand hitziger Diskussionen in Öffentlichkeit und Politik. Grund dafür ist der Austragungsort Ruanda. Das Land wird von Präsident Paul Kagame mit harter Hand regiert, die Presse- und Meinungsfreiheit ist eingeschränkt und verschiedenste Menschenrechtsverletzungen durch die Regierung sind gut dokumentiert. Ruanda ist zudem involviert in den unmittelbar angrenzenden Konflikt im Osten der DR Kongo, in dem die von Ruanda unterstützte Rebellengruppe M23, die kongolesische Armee und eine Vielzahl weiterer lokaler Milizen blutige Feuergefechte austragen – trotz verhandelter Friedensabkommen und mit einer Vielzahl ziviler Opfer und Menschenrechtsverletzungen, v.a. an Frauen.[1] Angesichts solcher Zustände wurde durch verschiedene Stimmen lautstark der Rückzug der Rad-WM aus Ruanda und damit Afrika gefordert. Nicht nur sei es zu unsicher für die Fahrerinnen und Fahrer und seien die Transportkosten für die Teams enorm, sondern man unterstütze auch ein autoritäres Regime beim „Sportswashing“. Sogar das Europaparlament forderte mit Blick auf den Ostkongo-Konflikt im Februar in einem Entschließungsantrag die Rad-WM in Ruanda abzusagen, „wenn Ruanda seinen Kurs nicht ändert“.[2] Hier mag man doch als lupenreine/r Europäerin und Europäer schnell und gut und gerne zustimmen: Kein Sportevent in einem solchen Land! So oberflächlich, so gut …
Willkommen auf dem rauen, ethischen Kopfsteinpflaster
Betrachtet man nämlich den Sachverhalt sowie den Kontext näher, wird die Sache sehr schnell komplexer. Ein Rückzug der WM aus Ruanda würde zuallererst die Entwicklung des Radsports in Ruanda und ganz Afrika nachhaltig schwächen, nicht zuletzt, weil das falsche Narrativ des „gefährlichen Kontinents Afrikas“ im globalen Maßstab nacherzählt wird. Dass aber innerhalb von Ruanda trotz des Konfliktes im Ostkongo für die Sicherheit der Fahrerinnen und Fahrer gesorgt ist, zeigt die seit Jahren erfolgreich stattfindende „Tour du Rwanda“ als größtes und wichtigstes Radsportevent Afrikas. Eine Absage träfe auch die afrikanischen Sportverbände hart. Sie unternehmen jedes Jahr große Anstrengungen mit erheblichen finanziellen Mitteln, damit ihre inzwischen mehr als 110 Profifahrerinnen und -fahrer die nötigen Lizenzen und Visa erhalten und ins nicht-afrikanische Ausland reisen können. Es wäre ein verheerendes Signal für ganz Afrika, wenn sich die Teams des globalen Nordens nun v.a. aufgrund hoher Transportkosten und übersteigerter Ideale nicht nach Ruanda bewegen.
Um hier nicht falsch verstanden zu werden: Es ist gut und richtig, dass Fragen über fehlende Presse- und Meinungsfreiheit, Menschenrechtsverletzungen und die Beteiligung Ruandas im Kongokonflikt öffentlich diskutiert werden. Es ist gut, wenn durch internationale Sportevents über die Politik vor Ort und das globale Common Good diskutiert wird. Doch wie so oft ist auch hier genaues Hinsehen gefragt – und wer sich mit der Geschichte Ruandas und der DR Kongo auseinandersetzt, der wird mit Blick auf vermeintliche ethische Eindeutigkeiten schnell demütig. Wer näher hinschaut, erfährt über den Genozid an den Tutsi durch Hutu im Jahr 1994 und seine Auswirkungen auf das ganze Gebiet der Großen Seen bis in die Gegenwart hinein. Der erfährt über die von der kongolesischen Regierung unterstützte Miliz FDLR, die bis heute aus Hutu-Genozidären besteht und vom Kongo aus revisionistische und genozidale Ideen bis nach Ruanda hinein verbreitet. Der erfährt über die viel zu oft verschwiegene Mitschuld Europas am gegenwärtigen Konflikt – es waren deutsche und belgische Kolonialmächte, die das zerstörerische ethnische Spaltungsdenken zwischen Hutu und Tutsi nachhaltig befeuerten; es war die große Radsportnation Frankreich, die 1994 nach der Befreiung des Landes den Hutu-Tätern ihre Flucht ins kongolesische Exil überhaupt erst ermöglichte. Und wer näher hinschaut, der erfährt über eine aus liberal-demokratischer Perspektive zwar nicht perfekte, aber doch beachtliche Stabilität und Entwicklung, die das Land Ruanda seit den Trümmern des Genozids in kurzer Zeit zurückgelegt hat. Kurz: Wer genau hinschaut, erfährt sehr schnell von all den Grautönen fernab des Schwarz-Weiß-Denkens.
Den Frieden kontextsensibel und im Prozess denken
Wer alles verdammt, was nicht den höchsten Idealen einer guten, gerechten und freien Gesellschaft entspricht, könnte nicht nur ganz schnell ortlos in der Welt werden, sondern könnte trotz bester Absichten Konflikte sogar verschärfen. Denn mit lupenreiner weißer Weste lassen sich die komplexen Realitäten, alltäglichen Kämpfe und fragilen Konflikt- und Friedensprozesse der Menschen und Gesellschaften vor Ort nicht wahrnehmen. Gut gemeinte Ideale wirken so zerstörerisch, denn sie bedenken nicht die verheerenden Folgewirkungen ihrer gesinnungsethischen Entscheidungen und führen so zu noch mehr Entfremdung und Konflikt zwischen allen Beteiligten.
Damit sind wir mitten im Feld der theologischen Friedensethik angekommen. Man könnte meinen, dass auch die theologische Friedensethik mit ihrem Leitbild eines „Gerechten Friedens“ und seinen vier Sachdimensionen „Schutz vor Gewalt“, „Abbau von Ungleichheiten“, „Förderung von Freiheit“ und „Umgang mit Pluralität“ eine idealistische Friedensethik ist. In dieser Lesart würde alles, was nicht vollumfänglich den vier Dimensionen entspricht, dem Frieden abträglich sein. Und tatsächlich wurde in der theologischen Friedensethik der Vergangenheit zu wenig diskutiert, wie sich die vier Sachdimensionen eigentlich in der konkreten Lebenswirklichkeit operationalisieren lassen – und zwar auch in nicht-demokratischen Kontexten wie Autokratien, Transformationsgesellschaften oder Minderheitenregimen. Eine realistische Friedensethik wird sich also verstärkt damit auseinandersetzen müssen, dass der Verwirklichung der vier Sachdimensionen kein Automatismus unterliegt und sie in konkreten Kontexten ungleichzeitig und spannungsvoll verlaufen wird. Eine zukunftsfähige theologische Friedensethik sollte damit mehr denn je betonen: Das Leitbild des Gerechten Friedens ist nicht idealistisch, sondern kontextsensibel und prozessual gedacht. Theologisch ist hervorzuheben, dass der Mensch in der bleibend erlösungsbedürftigen Welt den Gerechten Frieden niemals aus sich heraus und vollumfänglich schaffen wird. Der Gerechte Friede gilt damit als Orientierungspunkt auf rauem Kopfsteinpflaster, auf dem ethische Güter und Ideale zuweilen auch in Spannung zueinander stehen werden. Je nach Kontext und Situation muss hier verantwortungsethisch abgewogen werden – nicht einfach zwischen „gut“ und „böse“, sondern oft zwischen „schlecht“, „weniger schlecht“ und „annehmbar“. Auf dieser Linie gilt es dann auch verstärkt zu reflektieren, ob und inwiefern entwicklungspolitische Programme, kirchliche Kooperationen oder sportliche Großevents mit und in autoritären Regierungen ethisch legitimierbar sind. Die Rad-WM in Ruanda lässt jedenfalls Stimmen und Geschichten hörbar und sichtbar werden, die nur selten im Fokus der globalen Aufmerksamkeit stehen. Sie fördert nachhaltig den afrikanischen Radsport und lässt im besten Falle Machtasymmetrien zwischen Nord und Süd sichtbar werden. Nicht zuletzt befeuert sie den globalen Diskurs um Menschenrechte im Angesicht des komplexen Friedens- und Konfliktkontextes im Gebiet der Großen Seen. Die Rad-WM in Ruanda abzusagen, wäre ein klassischer Fall westlicher Arroganz und Bigotterie. Wer hier mit großen Idealen und einer weißen Weste agieren möchte, wird mehr zerstören als er aufbaut.

Maximilian Schell ist Postdoktorand am Lehrstuhl für Systematische Theologie, Ethik und Fundamentaltheologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Er forscht zur Friedensethik, Medizinethik und Wissenschaftsethik, ist Mitautor der neuen EKD-Friedensdenkschrift und bereist Ruanda und das Gebiet der Großen Seen im Zuge seiner Forschung seit mehr als 10 Jahren. Er ist leidenschaftlicher Radfahrer und wird im September die Teams in den Straßen Kigalis anfeuern.
Mehr Infos zum Radsport in Afrika lassen sich auf den Homepages der Teams „BikeAid“, „Team Africa Rising“ und „Team Amani“ finden: https://www.bikeaid.de; https://teamafricarising.org/; https://www.teamamani.com
[1] Vgl. den Amnesty Bericht „DRC: ‚They said we would die‘. M23 and Wazalendo abuses in Eastern Congo“, Research Briefing Amnesty International, August 2025, abrufbar unter: https://www.amnesty.ch/de/laender/afrika/demokr-rep-kongo/dok/2025/neuer-amnesty-bericht-dokumentiert-gruppenvergewaltigungen-entfuehrungen-und-toetungen/democratic-republic-of-congo_they-said-we-would-die.pdf (letzter Abruf am 05.09.2025).
[2] Europäisches Parlament, Gemeinsamer Entschließungsantrag RC-B10-0102/2025, Ziff. 29. Abrufbar unter https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-10-2025-0102_DE.html (letzter Abruf am 05.09.2025).
Beitragsbild: Maico Amorim, unsplash.com