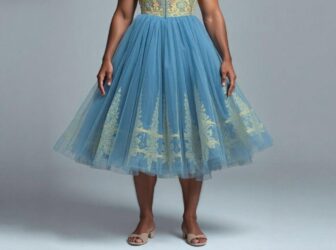Gerade wer die eigenen Kinder täglich im Blick hat, möchte ihnen eine lebenswürdige Zukunft ermöglichen. Doch klimasensibles Handeln stösst im turbulenten Familienalltag schnell an seine Grenzen. Ein Beitrag von Anna Karger-Kroll.
Familien spüren in besonderem Maße die Verantwortung, ihre Kinder für ein klimabewusstes Leben zu sensibilisieren und somit selbst nachhaltig zu handeln. Schließlich, so schreibt es auch Elisabeth Zschiedrich, haben sie „diejenigen konkret vor Augen, für die es die Erde zu erhalten und das Klima zu schützen gilt“[1]. Und so ist ihnen sehr wohl bewusst, dass Nichthandeln heute die Kosten in die Zukunft auf die heutigen Kinder und Jugendlichen verschiebt, während gleichzeitig deren Handlungsfähigkeit in der Zukunft eingeschränkt wird. Den Familienalltag möglichst nachhaltig zu gestalten, entspricht auch einer Erwartungshaltung, die zumindest implizit zunehmend an Eltern herangetragen wird: Familien sollen durch ihr Alltagsverhalten, ihre Konsumentscheidungen und ihre Mobilität einen Beitrag zur ökologischen, sozialen und ökonomischen Nachhaltigkeit leisten. Ihr kommt quasi die Funktion der „Keimzelle nachhaltiger Lebensführung“ zu. Doch wie kann sie dem damit verbundenen Anspruch gerecht werden? Wie gut kann das angesichts der bestehenden Gegebenheiten gelingen? Zeit für einen Realitätscheck.[2]
Familien als „Keimzellen nachhaltiger Lebensführung“?
Blicken wir auf das weite Feld des nachhaltigen Konsums fällt auf, dass nachhaltige Alternativen oftmals aufwändiger, meist auch teurer und deswegen für viele Familien nur schwer umsetzbar bzw. alltagstauglich sind. So finden sich beispielsweise Bio-Läden oder verpackungsfreie Läden meistens nur in Großstädten bzw. Großstadtnähe. Wohnt man als Familie nicht in solch einem Ballungsraum, ist das Aufsuchen derartiger Geschäfte mit längeren Wegen und damit mit einem deutlich höheren Zeitaufwand verbunden – im Vergleich zum „schnellen“ Einkauf im Supermarkt vor Ort. Sicherlich bietet dieser mittlerweile auch Bio-Produkte an. Diese sind jedoch meist teurer als konventionelle Produkte. Solche Preisunterschiede zeigen sich insbesondere bei nachhaltiger Mode. Alternativ gibt es natürlich diverse Second-Hand-Plattformen, aber mal ehrlich: Was, wenn man nach einem anstrengend Tag zwischen Job und Familie (mit wahlweise kranken Kindern, Kita-Schließungen, Kinder-Geburtstagskuchenbacken, …) nicht auch noch einen Kleiderkreisel oder Flohmarktbesuch organisieren möchte, nicht auch noch jedes einzelne Kleidungsstück, aus dem die Kinder rausgewachsen sind, abfotografieren möchte, um es schließlich für 5,-€ hochzuladen, um dann gegen Mitternacht völlig müde und erschöpft ins Bett zu fallen?[3] Sicherlich wäre es auch noch super, Anziehsachen selbst zu nähen oder zu flicken. Grundsätzlich mangelt es sowohl online als auch offline nicht an Do-it-youself- und Upcycling-Ideen. Aber auch das muss man sich als Familien zeitlich leisten können.
Nach einem Alltag mit kranken Kindern, Kita-Schließungen und Kuchenbacken noch Anziehsachen selbst nähen?
Ähnliche Überlegungen kann man im Bereich der Mobilität anstellen: Die im Rahmen der sozial-ökologischen Transformation geforderte Mobilitätswende geht mit dem Apell einher, bestenfalls auf den eigenen PKW zu verzichten und auf den ÖPNV umzusteigen. Hierfür bedarf es aber ein entsprechendes und zuverlässiges Angebot, insbesondere in ländlichen Regionen. Aktuell ist der Fahrplan an der Bushaltestelle meist nur schwer mit dem eng getakteten Familienalltag vereinbar, die Ticketpreise nicht wirklich attraktiv. Denn wenn die Kosten für die Einzelticketpreise die Parkhausgebühren deutlich übersteigen, scheint die Rechnung nicht zugunsten des ÖPNV aufzugehen. Ohne Zweifel müssten Benzinkosten sowie Anschaffungs- und Unterhaltkosten mitberücksichtigt werden, doch diese Rechnung wird im familiären Alltag oftmals ausgeblendet. Ähnliches gilt für die Deutsche Bahn. Spätestens nach der Abschaffung der Familienreservierung stellt sich die Frage, inwiefern Bahnfahren für Familien wirklich noch eine Alternative zum Auto darstellt. Auf die Frage nach der Barrierefreiheit von Haltestellen und Bahnhöfen (Stichwort: Kinderwagen) oder nach der Sicherheit der Radwege als Alternative zum ÖPNV möchte ich lieber nicht näher eingehen.
…scheint die Rechnung nicht zugunsten des ÖPNV aufzugehen.
Es mangelt also an entsprechenden (Infra-)Strukturen bzw. scheinen die bestehenden zumindest ausbaufähig, damit sie mit den Realitäten des Familienalltags besser vereinbar sind und diesen nicht durch einen Mehraufwand zusätzlich belasten. Angesichts der übergeordneten Ziele von Nachhaltigkeit greift eine rein private Input-Output-Logik natürlich zu kurz, doch ist nicht zu leugnen, dass sich die Investitionen – rein ökonomisch betrachtet – auf den ersten Blick nicht wirklich zu lohnen scheinen: Die Verluste wie der Verzicht auf einen eigenen PKW oder auf Fernreisen sind deutlich spürbar, die Gewinne dagegen eher vage. Sicherlich kann hier im Sinne eines Bewusstseinswandel für ein suffizientes und genügsameres Leben plädiert werden und die mit diesem Lebensstil durchaus positiven Aspekte wie Selbstwirksamkeit hervorgehoben werden. Dies wirkt angesichts der alltäglichen Herausforderungen vieler Familien oftmals aber eher wie blanker Hohn der meist Bessergestellten. Finanzielle Kompensationsleistungen und gute (infra)strukturelle Rahmenbedingungen sind aber allein nicht ausreichend, um Familien einen nachhaltigen Alltag zu ermöglichen.
Die Verluste wie der Verzicht auf einen eigenen PKW oder auf Fernreisen sind deutlich spürbar, die Gewinne dagegen eher vage.
Ein nachhaltiges Familienleben darf nicht nur auf einen ressourcenschonenden Lebensstil reduziert werden. Zeitstrukturen, die den (auch unvorhersehbaren) Bedürfnissen des Familienalltags entsprechen, sind notwendig; ebenso Zeitrhythmen, die einen nachhaltigen Lebensstil, der oftmals mit einem höheren Zeitaufwand verbunden ist, ermöglichen. Zeit ist eine Voraussetzung für Nachhaltigkeit. Das Familienleben nachhaltig zu gestalten bedeutet zudem, Zeit für Familie als Familie zu haben – ganz ohne to-do-Listen. Familien brauchen Zeit, um sich als Familie zu erleben, sich in ihrer Selbstwirksamkeit zu erfahren und sich für die gemeinsamen Werte einzusetzen. Familie ist nicht lediglich als Organisations- oder Betreuungseinheit aufzufassen, schließlich ist sie kein ökooptimierter Familienbetrieb. Entsprechend gilt es ein Mehr an Zeitwohlstand im Sinne von Zeitsouveränität zu ermöglichen; anderenfalls bleibt der Anspruch einer nachhaltigen Familienpolitik unvollständig. Nur durch solch ein höheres Maß an Zeitwohlstand kann es schließlich gelingen, dass Familien sich gegen die schnelleren Konsum- und Mobilitätslösungen entscheiden könnten.
Zeit ist eine Voraussetzung für Nachhaltigkeit.
Unsere Kinder werden bereits mit neuen klimatischen Realitäten konfrontiert werden. Umso wichtiger ist es, dass sie nachhaltiges Handeln nicht als Zusatzbelastung, sondern als selbstverständlichen Teil ihres Alltags erleben können und so auch ihre Zukunft als gestaltbar erfahren. Hierfür gilt es aber nicht nur entsprechende Infrastrukturen zu schaffen, sondern Familien ebenso die dafür notwendige Zeitsouveränität zu ermöglichen. Gerade Familien wollen doch Nachhaltigkeit gestalten, damit die nächste Generation nicht mehr mit dem inneren Konflikt zwischen eigenem Anspruch an Nachhaltigkeit und gegebener Realität aufwachsen muss.

Anna Karger-Kroll, Dr. theol., ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Systematische Theologie und Fachvertreterin für Theologische Ethik an der Universität Siegen.
Bild: Nadine Saupper
[1] Zschiedrich, Elisabeth, Auf Kinder verzichten für Mutter Erde?, https://www.feinschwarz.net/auf-kinder-verzichten-fuer-mutter-erde/.
[2] Herzlichen Dank an Ivonne Famula (https://familienbund.org/%C3%BCber-uns/bundesgesch%C3%A4ftsstelle) für den intensiven fachlichen Austausch zu diesem Thema, der mich letztlich zu diesem Artikel motiviert hat.
[3] Vgl. hierzu auch Goldschmidt, Nils/Wolf, Stephan, Gekippt. Was wir tun können, wenn Systeme außer Kontrolle geraten, Freiburg i. Br. 2021, 76.
Beitragsbild: Filip Urban, unsplash.com