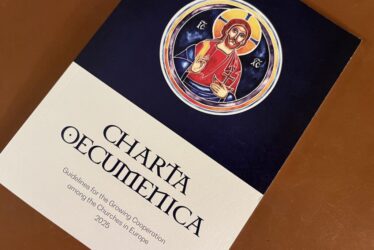Lucas Leal, ehemaliger Ordensmann, Theologe und LGBTIQ*-Aktivist, setzt sich in seiner jüngsten Veröffentlichung Creyentes y diverses mit der Diskriminierung und dem Glauben queerer Katholik:innen in Argentinien auseinander und schreibt damit ein Stück argentinischer Kirchengeschichte. Eine Rezension von Robert Renner.
Es gibt Bücher, die etwas in Bewegung bringen, das sich nicht mehr umkehren lässt. Dies ist bei der jüngsten Veröffentlichung des argentinischen Theologen Lucas Leal mit dem Titel „Creyentes y diverses“ (deutsch: „Gläubige und Diverse“) zweifelsohne der Fall. Leal versammelt in seiner Publikation die Lebenszeugnisse von zehn queeren Katholik*innen und legt damit für Argentinien ein historisches Buch vor – gerade in der Zeit von Argentiniens Kettensägen-Präsident Javier Milei. Stilistisch geschickt rahmt Leal die queeren Lebenszeugnisse und elementarisiert im zweiten Teil der Veröffentlichung auf rund 60 Seiten die empirischen Erkenntnisse seiner Promotionsschrift über den Coming-out-Prozess queerer Jugendlicher innerhalb der katholischen Kirche in Argentinien.
Ähnlich wie #OutInChurch
Ähnlich wie die deutschsprachige Bewegung „#OutInChurch – Für eine Kirche ohne Angst“ deckt Leal damit ein Tabu auf, das bis dato in Argentinien kaum Beachtung fand: Die strukturelle Diskriminierung queerer Menschen innerhalb der katholischen Kirche. Leal bleibt jedoch nicht bei der Anklage stehen. Er schildert ebenso, wie queere Sexualität und Identität den christlichen Glauben bereichern, erweitern und beflügeln können. Die „pareja extraña“ (deutsch: ungewöhnliches Paar), wie Leal die wechselseitige Bezogenheit von Queerness und christlichem Glauben nennt, erscheint nicht nur als Ausgangspunkt der Anklage, sondern auch als Quelle des Neuanfangs.[1]
Bis ihn die Spannung zerriss
„Creyentes y diverses“ ist Produkt eines jahrzehntelangen Prozesses, den Leal auch persönlich durchlaufen hat. Geboren in Tucumán, einer ländlichen Provinz in Nordargentinien und aufgewachsen als Sohn streng katholischer Eltern fand Leal früh Halt in seiner Kirchengemeinde. Nach Jahren des Engagements in der kirchlichen Jugendarbeit entschied er sich mit 18 für den Eintritt in die Ordensgemeinschaft der Mercedarier. Dafür zog er in das Ausbildungsseminar der Gemeinschaft nach Buenos Aires, rund 1.200 Kilometer entfernt von seinem Heimatort. Zehn Jahre blieb er in der Gemeinschaft, bis ihn die innerliche Spannung zwischen Religiosität und sexueller Orientierung zerriss. Leal schreibt in „Creyentes y diverses“, dass er schon in seiner frühen Kindheit seine Homosexualität gespürt habe. Dennoch dauerte es Jahrzehnte, bis er sie benennen konnte: Erst als er sich im Rahmen der Ordensausbildung verliebte, fand er die Kraft seine Sexualität anzunehmen und wertzuschätzen. Er entschied sich für den Ausstieg aus dem Orden – für ihn ein Befreiungsschlag. Heute ist er 45, Vizerektor einer katholischen Schule in Córdoba, hat 2020 seine Promotionsschrift[2] vorgelegt und publizierte nun mit „Creyentes y diverses“ seine zweite große Veröffentlichung.
Theologie in der ersten Person
Leals neuestes Buch ist in Inhalt und Form der Aufbereitung einzigartig: Während im ersten Teil die Lebenszeugnisse queerer Katholik*innen im Vordergrund stehen, gelingt es ihm im zweiten Teil die autobiografischen Inhalte auf eine theologische Makroebene zu heben und sie mit den Ergebnissen seiner Dissertation zu verknüpfen. Das mit „Creyentes y diverses“ verbundene Anliegen benennt Leal präzise: „[…] es ist notwendig, dass LGBTIQ*-Gläubige beginnen, Theologie in der ersten Person zu betreiben, sich sichtbar zu machen und mit der marginalisierenden Komplizenschaft zu brechen.“[3].
Geschichte der Transfrau Lorena Ariatna
Diese Theologie in der ersten Person ist fesselnd. Exemplarisch sollen hier zwei Zeugnisse herausgegriffen werden. Da ist zum Beispiel die Geschichte der Transfrau Lorena Ariatna: Sie berichtet von der dramatischen Ablehnung ihrer Familie nach ihrem Coming-out. Gefangen in einer ausweglosen Situation ist sie gezwungen sich zu prostituieren. Ungeschönt nimmt sie die Leser*innen mit hinein in ihre Welt und Erfahrungen von Diskriminierung, Gewalt und Glauben. Zusammen mit weiteren Transfrauen gründet sie den ersten kirchlichen Begegnungsort für Transpersonen in der Provinz Mendoza. Um den Sprung aus der Prostitution zu schaffen, baut sie sich eine Selbstständigkeit als Näherin auf und verwirklicht sich ihren langjährigen Traum eines Geschichtsstudiums. Ariatnas Reflexion über ihre Lebensgeschichte und die Frage, was ohne all diese Erfahrungen aus ihr geworden wäre, spiegelt eindrücklich ihren Schmerz, die Ablehnung und ihr Empowerment.
Geschichte von Diego Álvarez
Auch die Geschichte von Diego Álvarez, von dem ein weiteres Lebenszeugnis in „Creyentes y diverses“ stammt, macht nachdenklich. Er berichtet von einem langen Weg der Selbstheilung. Noch minderjährig begann er seine Laufbahn als Priesterseminarist in einem Bistum in Nordargentinien. Zum Zeitpunkt seines Eintritts war das Priesterseminar ein Zufluchtsort für ihn, „ein Refugium für jemanden, der nirgendwo rein passte“.[4] Nachdem er dem Rektor gegen Ende seines Studiums von seiner Homosexualität erzählt, wird er des Seminars verwiesen, denn – so die Begründung – Álvarez’ sexuelle Orientierung sei eine „Todsünde“. Als Vollwaise und ohne Studienabschluss, bis zu dem ihm nur noch wenige Monate gefehlt hätten, steht er obdachlos da. Es folgt ein langer Überlebenskampf, der ihm nur unter größter Anstrengung gelingt. Erst als er Jahrzehnte später eine Anstellung an einer kirchlichen Schule erlangt, kann er seine traumatischen Erlebnisse verarbeiten:
„So viele Jahre nach diesen Ereignissen, die mich in Stücke gerissen haben, blicke ich einfach zurück und verstehe, dass nichts von dem, was ich bin und worauf ich stolz bin, nichts von dem, was ich für mich und andere getan habe, nichts, was ich tun werde, die gleiche Wärme und Liebe hätte, die ich heute gebe, wenn ich nicht barfuß, gebrochen und dem Regen ausgesetzt worden wäre und nicht erneut hätte lernen müssen zu leben. […]
Heute lasse ich Gott Gott sein, so wie Er/Sie meine sexuelle Orientierung und Identität liebt und mich sein lässt, uns alle sein lässt und uns feiert. Heute bin ich ein solidarischer Schwuler, wie man es nur sein kann, wenn man Ausgrenzung, Schläge und Einsamkeit kennt. Heute bin ich ein Jünger des Reiches und des Lebens Gottes, wie auch immer man ihn/sie sich vorstellen mag, heute bin ich ein Pilger und ewig Lernender.“[5]
Erlebte Gewalt
Es ist die Klarheit und Ehrlichkeit, mit der die in „Creyentes y diverses“ versammelten Lebenszeugnisse bestechen. Gleichwohl darf nicht unerwähnt bleiben, dass die erlebte Gewalt explizit und zum Teil auch szenisch geschildert wird und dies für Leser*innen eine Herausforderung darstellen kann. Dennoch ist diese radikale Transparenz, mit der die theologischen Überlegungen ins Licht der eigenen Lebensgeschichte gestellt werden, auch eine große Stärke der Veröffentlichung. Denn so wird erfahrbar, dass Theologie nicht im luftleeren Raum entsteht, sondern aus konkreten Biografien, Beziehungen und Auseinandersetzungen erwächst.
Das in den Lebenszeugnissen aufscheinende Erfahrungswissen wird von Leal reflektiert und eingeordnet. Durch seine theologische Metareflexion wird den Leser*innen klar: In all der Diskriminierung und Ausgrenzung formierte sich eine Art christlichen Glaubens, die es verdient gesehen und gefeiert zu werden. Welche Form dieser queeren Art christlichen Glaubens angemessen ist, wird in der Veröffentlichung zwar diskutiert, doch hütet sich Leal vor schnellen Schlüssen.[6] In seinem Fazit unterstreicht er dennoch: „der Glaube ist ein Recht, auch für Personen der sexuellen Vielfalt und Dissidenz, das niemand leugnen oder wegnehmen darf.“[7]
‚Weltkirchen-Argument‘
Die Veränderungsbedarfe hinsichtlich der überfälligen Inklusion queerer Personen und Themen in die katholischen Kirche, die Leal im letzten Teil der Veröffentlichung aus den Ergebnissen seiner empirischen Dissertation ableitet und mit den autobiografischen Zeugnissen verknüpft,[8] decken sich einmal mehr mit den Forderungen von „#OutInChurch“.[9] Die Lektüre von „Creyentes y diverses“ kann also vor allem jenen Vertreter*innen von Theologie und Kirche empfohlen werden, die im kirchenpolitischen Diskurs dem verführerischen wie gleichsam pauschalisierenden Narrativ einer monolithischen und homogenen „Weltkirche“ verfallen. Leal zeigt stattdessen für den argentinischen Kontext: Auch „die Weltkirche“ ist plural und divers. Es scheint daher geboten, genauer hinzuschauen, bevor das „Weltkirchen-Argument“ bemüht wird, um kirchenpolitische Positionen anderer vorschnell zu delegitimieren.
Robert Renner studierte katholische Theologie und Soziologie in Münster und Buenos Aires. Neben seiner Tätigkeit als Referent im Ressort Kirchenentwicklung des Bistums Essen promoviert er am Lehrstuhl für Pastoraltheologie und Homiletik der Universität Münster. In seiner vom Cusanuswerk geförderten Dissertation setzt er sich mit dem Engagement kirchlicher Akteur*innen hinsichtlich der Einführung der queeren Zivilehe in Argentinien (2010) auseinander.
Einfügen: Alle in diesem Beitrag zitierten Passagen aus „Creyentes y diverses“ wurden eigens durch den Autor übersetzt. Das Motiv der „pareja extraña“ entlehnt Leal der Veröffentlichung von Barbero-Di Stéfano und Pichardo Galán. Vgl. Barbero-Di Stéfano, Matías/Pichardo Galán, José Ignacio: La extraña pareja. Religión y LGBT en España. In: Parisi, Rosa (Hg.): Coreografie familiari fra omosessualità e genitorialità. Pratiche e narrazioni delle nuove forme del vivere assieme. Rom 2017, 31–50.
[2] Leal, Lucas: ¿Lo digo o no lo digo? La salida del armario en varones gays de la iglesia católica de Córdoba. Córdoba 2024.
[3] „[…] es necesario que les creyentes LGTBIQ+ comiencen a hacer teología en primera persona, visibilizándose para romper con la complicidad que margina.“ Leal, Lucas: Creyentes y diverses. Buenos Aires 2025, 25.
[4] „[…] un refugio para alguien que no encajaba en ningún otro lado.“ Leal, Lucas: Creyentes y diverses. Buenos Aires 2025, 35.
[5] „Tantos años más tarde de aquellos sucesos que me partieron en pedazos simplemente miro hacia atrás y entiendo que nada de lo que soy, y de lo cual me siento orgulloso, nada de lo que hice por mi y por otrxs, nada de lo que haré, tendría el calor y el amor que doy ahora si no hubiese tenido que salir a caminar descalzo, roto y a la intemperie mientras aprendía a vivir de nuevo. […]
Hoy dejo que Dios sea Dios, así como Él/Ella ama mis mariconadas y me deja ser, nos deja ser y nos celebra. Hoy soy una marica solidaria como solo nosotrxs podemos serlo entendiendo de exclusiones, golpes y soledades. Hoy soy un discípulx del Reino y la Vida, de Dios(a) como quiera que se conciba, peregrino y, eternamente, aprendiz.“ Leal, Lucas: Creyentes y diverses. Buenos Aires 2025, 40f.
[6] Leal vertieft beispielsweise die Frage, ob exklusive kirchliche Begegnungsorte für queere Personen der Inklusion queerer Menschen in allen kirchlichen Gruppierungen vorzuziehen sind. Dabei hebt er treffsicher die verschiedenen Paradigmen hervor, die für Vertreter*innen der Katholischen Kirche im Rahmen der Annäherung an die LGBTIQ*-Community handlungsleitend waren: I. Angst, II. Mitleid, III. Anerkennung. Vgl. Leal, Lucas: Creyentes y diverses. Buenos Aires 2025, 121–145.
[7] „La fe es también un derecho para las diversidades y disidencias sexuales que nadie puede negar ni arrebatar.“ Leal, Lucas: Creyentes y diverses. Buenos Aires 2025, 177.
[8] „Creyentes y diverses“ fordert: 1. Participación plena de las personas LGBTIQ+ en espacios eclesiales (deutsch: Volle Teilhabe von LGBTIQ+-Personen in kirchlichen Räumen). 2. Visibilización de las personas LGBTIQ+ en la iglesia (deutsch: Sichtbarkeit von LGBTIQ+-Personen in der Kirche). 3. Acompañamiento espiritual a las personas LGBTIQ+ por parte de personas idóneas (deutsch: Spirituelle Begleitung von LGBTIQ+-Personen durch geeignete Personen). 4. Coherencia de vida en el testimonio de sacerdotes, religiosos y religiosas (deutsch: Kohärenz des Lebens im Zeugnis von Priestern und Ordensleuten). 5. Una nueva comprensión de la diversidad sexual desde la antropología teológica. (deutsch: Ein neues Verständnis der sexuellen Vielfalt aus theologisch-anthropologischer Sicht). Vgl. Leal, Lucas: Creyentes y diverses. Buenos Aires 2025, 121–180.
[9] Vgl. #OutInChurch – Für eine Kirche ohne Angst: Forderungen. Online unter: https://www.outinchurch.de/forderungen/ (Stand: 10.11.2025).