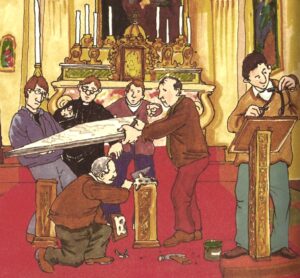Heute vor genau 60 Jahren wurde das Zweite Vatikanische Konzil feierlich beendet – und dann kam erst einmal das römische Rollback. Christian Bauer erinnert an seine Zukunft.
Bitte schließen Sie für einen kurzen Moment die Augen. Stellen Sie sich einen nächtlichen Sternenhimmel vor und betrachten Sie die funkelnden Himmelslichter. Mit ihnen verhält es sich wie mit den sechzehn Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965). Diese sind wie Leuchtpunkte am Nachthimmel, an denen man sich auch im 21. Jahrhundert noch orientieren kann, wenn man sie zu einem Sternbild zu verbinden weiß. Von dieser bildhaften Vorstellung aus ist es nicht mehr weit bis zum Begriff der Konstellation (von lat. stella = Stern). Eine ‚konstellative Lesart‘[1] des Zweiten Vatikanums ermöglicht es, darin eigene Schwerpunkte zu setzen (= Option erster Ordnung), solange man die Spannung zu den anderen Schwerpunkten hält (= Option zweiter Ordnung). Gelänge es, diese ‚zweifache Optionalität‘ von eigenem Teil und großem Ganzen synodal zu kultivieren, so ergäbe sich ein ebenso pluralitätsfähiges wie differenzsensibles Format des Umgangs nicht nur mit Konzilstexten, sondern auch untereinander.
1. Sternbild des Konzils
Im Zentrum des Konzils stehen vier Konstitutionen, die sich mit den Grunddimensionen kirchlicher Pastoral überblenden lassen: die Liturgiekonstitution Sacrosanctum concilium (SC = Liturgia), die dogmatische Kirchenkonstitution Lumen gentium (LG = Koinonia), die Offenbarungskonstitution Dei verbum (DV = Martyria) und die pastorale Kirchenkonstitution Gaudium et spes (GS = Diakonia). Alle vier Haupttexte des Zweiten Vatikanums wurzeln in vorkonziliaren Aufbrüchen der Pastoral: SC in der Liturgischen Bewegung („Actuosa participatio“), LG in der Laienbewegung („Die Kirche erwacht in den Seelen“), DV in der Bibelbewegung („Réveil évangélique“) und GS in der Missionsbewegung („Kirche muss aus sich herausgehen“).
Theologische Schieflage
Diesen Weg, das Zweite Vatikanum über seine vier Konstitutionen zu erschließen, hatte bereits die römische Bischofssynode zum Konzilsjubiläum 1985 vorgeschlagen – allerdings mit einer anderen Schwerpunktsetzung als im Folgenden. Die Kurzformel, auf die diese von Joseph Ratzinger dominierte Sondersynode das Konzil brachte, weist nämlich eine konzilstheologische Schieflage auf. Sie reduziert den konstellativen Plural seiner Lehrtexte auf einen liturgiezentrierten Singular: Die Kirche (LG) – unter dem Wort Gottes (DV) – feiert die Geheimnisse Christi (SC) – zum Heil der Welt (GS). Das sinngebende Verb dieser Konzilsformel bezieht sich auf die Liturgie als wesensbestimmende Haupttätigkeit von Kirche („feiert die Geheimnisse Christi“).
Weltfühlige Kirche
Die Dynamik des Konzils selbst legt eine andere Schwerpunktsetzung nahe: bei der Pastoralkonstitution Gaudium et spes[2]. In ihr stand die pastorale Grundfrage des Zweiten Vatikanums final zur Debatte: Kirche in der Welt von heute – wie geht das? Eine authentische Zusammenfassung des Konzils wäre daher eigentlich: Die Kirche (LG) – dient dem Heil der Welt (GS) – aus den Mysterien Christi heraus (SC) – unter dem Wort Gottes (DV). Diese Kurzformel wird in jenen beiden Rahmentexten bestätigt, die als erstes und letztes vom Konzil beschlossenes Dokument nicht nur in historischer, sondern auch in systematischer Hinsicht dessen Pointe darstellen: die Botschaft an die Welt (20. Oktober 1962) und die Pastoralkonstitution (7. Dezember 1965). M.-Dominique Chenu, der nicht nur die genannte Botschaft inspirierte, sondern auch die spätere Pastoralkonstitution, umreißt das Zielbild einer auf neue Weise ‚weltfühligen‘ Kirche:
„Das Konzil wird das Problem der Kirche […] nach dem Maß der Welt bestimmen müssen […]. Man muss dabei die Wichtigkeit […] der Liturgiereform, der Renaissance wahrhaft christlicher Gemeinschaften, der Erneuerung der Methoden des Apostolats und der Wiederherstellung der Bischofsfunktion nicht herabstufen, die allesamt zurecht auf der Tagesordnung des nächsten Konzils stehen – aber all diese wichtigeren Angelegenheiten finden ihr Licht […] in der Vision einer neuen Welt […].“[3]

2. Restaurative Wende
Am 8. Dezember 1965 wurde das Konzil feierlich beendet – und bereits am 9. Dezember begann der römische Kampf gegen das Konzil. Während des überaus langen Doppelpontifikats von Johannes Paul II. und Benedikt XVI. (1978-2013) gewann diese Richtung dann sogar weltkirchlich „kulturelle Hegemonie“ (A. Gramsci). Nach dem kurzen Konzilsfrühling unter Johannes XXIII. und Paul VI. (1958-1978) begann nun eine „winterliche Zeit“ (Karl Rahner), die sich erst unter den Päpsten Franziskus und Leo XIV. (2013-heute) in Richtung eines Tauwetters wandelt – und deren jahrzehntelange Frostperiode auch das Kirchengefühl des Verfassers dieser Zeilen prägte. Wie viele andere, so hatte auch er gelernt, in kognitiv dissonanter Schizo-Ekklesiologie zwischen der eigenen Gemeindeerfahrung vor Ort und einer global agierenden Kirchenpolitik zu unterscheiden, deren theologische Aufarbeitung noch gar nicht begonnen hat.
Neuevangelisierung
Ein Schlüsselmoment in diesem römischen Rollback war die genannte Sondersynode zum Konzilsjubiläum 1985. Sie etablierte eine römische Lesart des Zweiten Vatikanums, die – ausgehend von einer negativen Deutung der Nachkonzilszeit – die damaligen weltkirchliche Aufbrüche einhegen sollte: in Bezug auf politische Befreiung (Lateinamerika), christliche Inkulturation (Afrika), interreligiösen Dialog (Asien) und gesellschaftliche Säkularisierung (Europa, Nordamerika). Das Jahr 1985 hatte bereits mit einem kirchenpolitischen Paukenschlag begonnen: Joseph Ratzingers Rapporto sulla Fede, wo von einer notwendigen ‚Restauration‘ die Rede war. In deren Zentrum stand die Idee einer rechristianisierenden Neuevangelisierung, die zugleich eine manifeste Abkehr vom ganzheitlichen, mit kirchlicher Selbstbekehrung beginnenden und im Zeichen reichgottesfroher Jesus-Nachfolge stehenden Evangelisierungsbegriff[4] Papst Pauls VI. in Evangelii nuntiandi bedeutete. Die römische Sondersynode zum Konzilsjubiläum steht für massive Konflikte zwischen Ortskirchen und Kirchenzentrale, die alle Ebenen des Volkes Gottes betrafen:
- BISCHÖFE: Ein zentrales Instrument dieser restaurativen Kirchenpolitik waren höchst umstrittene Bischofsernennungen (inklusive eines Fragebogens zu Romtreue, Empfängnisverhütung, Frauenordination, Zölibat etc.). Missliebige Bischöfe wurden, wie 1995 Jacques Gaillot in Frankreich, ihres Amtes enthoben.
- PRIESTER: Es kam zu einer umfassenden Reklerikalisierung – bis hin zu strengeren Kleidervorschriften. Auf normal gekleidete ‚Konzilspriester‘ folgten ‚JPII-Benedikt-Priester‘ mit römischem Kragen. Das Lehrschreiben Ordinatio sacerdotalis rückte zudem 1994 das Verbot der Frauenordination in die Nähe einer unfehlbaren Doktrin.
- ORDEN: Auch hier gab es autoritative Eingriffe, am prominentesten war die Einsetzung eines neuen Jesuitengenerals 1981. Man setzte in Rom nun vor allem auf Neue Geistliche Bewegungen wie Comunione e Liberazione oder das Neokatechumenat sowie das mächtige, 1982 zur Personalprälatur erhobene Opus Dei.
- LAIEN: In Christifideles laici warnte Johannes Paul vor „Nivellierungen zwischen dem gemeinsamen Priestertum und dem Amtspriestertum“ (CL 23). Nichtgeweihte kirchliche Amtsträger:innen wie die deutschen Pastoralreferent:innen wurden mit der ‚Laieninstruktion‘ von 1997 in die Schranken gewiesen.
- THEOLOG:INNEN: 1979 wurde Hans Küng die Lehrerlaubnis entzogen – der Beginn einer ganzen Reihe von Lehrverurteilungen. 1989 unterzeichneten über 700 Theologieprofessor:innen weltweit die Kölner Erklärung. Im selben Jahr veröffentlichte Rom eine verpflichtende Professio fidei in der Tradition des Antimodernisteneides.
Auf den Protest der Theolog:innen folgte jener der engagierten Laien. Ein Beispiel war das österreichische ‚Kirchenvolksbegehren‘ von 1995, dessen Auslöser der Missbrauchsskandal um den Wiener Erzbischof Groër war. Die spätere Aufdeckung des weltweiten sexuellen Missbrauchs durch Kleriker (und seiner Vertuschung durch Bischöfe, die Täter deckten statt Opfer zu schützen), läutete eine neue Phase der Nachkonzilszeit ein, die das Pontifikat Benedikts XVI. prägte. Dieser war 2005 zum Nachfolger Johannes Pauls II. gewählt worden, weil er größtmögliche Kontinuität im Kampf gegen die ‚Diktatur des Relativismus‘ versprach. Seinen ultimativen Tiefpunkt erreichte dieses Pontifikat am Osterfest des Priesterjahres 2010, als Kardinaldekan Angelo Sodano, der bereits als Nuntius während der rechtsextremen Militärdiktaturen in Lateinamerika eine ungute Rolle spielte, dem Papst in einer Solidaritätsadresse versicherte, die Kirchenkritik angesichts der Missbrauchsfälle sei nicht mehr als ein chiacchiericcio del momento.
3. Aufbruch in der Krise
Auch wenn Papst Benedikt in Sachen sexueller Missbrauch weniger nachsichtig als sein Vorgänger war, so ging doch erst sein Nachfolger Franziskus die systemischen Ursachen dieser epochalen Kirchenkrise wirklich an. Er benannte den Klerikalismus als strukturellen Hauptgrund von Missbrauch und empfahl Synodalität als ein probates Gegenmittel: Missbrauch, Klerikalismus und Synodalität sind zutiefst miteinander verbunden. Im Zuge einer entsprechenden synodalen Wende vollzog Papst Franziskus dabei im Abkehr vom restaurativen Kirchenkurs seiner Vorgänger gleich mehrere Paradigmenwechsel – auch wenn vieles davon nicht weit genug ging: Begrenzung des römischen Zentralismus im Sinne einer ‚heilsamen Dezentralisierung‘, Einbeziehung des gesamten Volkes Gottes in synodale Prozesse (inklusive Stimmrecht), Öffnung für ‚irreguläre‘ Lebensformen (z. B. wiederverheiratete Geschiedene, Homosexuelle), Bruch mit der klassischen Sozialdoktrin zugunsten eines befreiungstheologischen Ansatzes (inkl. Rehabilitierung von Gustavo Gutièrrez, Leonardo Boff bzw. Heiligsprechung Oscar Romeros) u.v.m.
Blick durchs Schlüsselloch
Was nun auch im deutschen Sprachraum ortskirchlich folgte, war kein Aufbruch aus, wohl aber einer in der selbstverschuldeten Kirchenkrise – und dieser ermöglicht eine neue Phase der Konzilsrezeption. Die weltpastorale Weite einer im Innen wie nach Außen offenen Kirche des Konzils wurde im hiesigen katholischen Mainstream nämlich bislang noch kaum rezipiert. Fragt man deutschsprachige Katholik:innen, was das Konzil an Neuem gebracht habe, dann werden sie vor allem nach Innen gerichtete Reformen nennen: sogenannte ‚Volksaltäre‘ wurden errichtet und die Messe wurde in der Landesprache gelesen. Oder: Die Laien wurden aufgewertet und ein Pfarrgemeinderat wurde eingerichtet. Folgendes Bild ermöglicht einen Blick durch das mikrohistorische Schlüsselloch in den Alltag einer nachkonziliaren Pfarrei:
Konzilsrezeption bestand im deutschen Sprachraum vor allem in einem internen Kirchen-Umbau (im Sinne von Liturgia und Koinonia) statt in externer Welt-Mission (im Sinne von Diakonia und Martyria): Gottesdienst konstituiert Gemeindewerden. Man konzentrierte man sich auf die beiden Konstitutionen Sacrosanctum concilium und Lumen gentium. Erst mit dem Pontifikat von Papst Franziskus rückten die beiden Konstitutionen Gaudium et spes und Dei verbum immer mehr ins Zentrum – eine extrovertierte Dynamik der Sendung in die Welt, welche die introvertierte Dynamik der Sammlung in der Kirche im Wortsinn heraus-fordert: Menschendienst als Gotteszeugnis. Das Konzil kehrt somit in einer lateinamerikanischen Wendung nach Europa zurück. Denn eine Kirche in konziliarem Sinn ist nicht nur ‚drinnen daheim‘, sondern auch „draußen zuhause“ (Jack Wolfskin). Doch Vorsicht: Es geht dabei keinesfalls um einen ‚missionarischen‘ Appel im Sinne der Neuevangelisierung, der von einer dringend notwendigen Bearbeitung systemischer Kirchenprobleme ablenken soll („Wir dürfen nicht nur um uns selber kreisen“)!
Kreative Treue zum Konzil
Vielmehr gilt das Missions-Paradoxon: Wer nach draußen geht, wird dort mit den Pathologien des eigenen Innen konfrontiert („Wie, Du bist von der Kirche? Damit will ich nichts zu tun haben“). Man kann einer kirchlichen Selbstbekehrung als der Voraussetzung neuer Glaubwürdigkeit nicht ausweichen. Denn eine klerikale und koloniale, homophobe und misogyne, identitäre und autoritäre Kirche ist ein manifestes Evangelisierungshindernis. Strukturfragen reflektieren Glaubensinhalte – oder sie sind nicht evangeliumsgemäß. Und das heißt: keine „Opferkonkurrenz“ (Regina Ammicht-Quinn) zwischen gesellschaftlich und kirchlich Marginalisierten. Daher steht auch der deutsche Synodale Weg in kreativer Treue zum Konzil.
Selbstevangelisierung
Es geht hier wie bereits auf dem Zweiten Vatikanum um kirchliche Selbstevangelisierung im Sinne von Evangelii nuntiandi, dessen 50-Jahre-Jubiläum heute ebenfalls zu feiern ist. Letztlich ist es wie bei den französischen Arbeiterpriestern nach dem Zweiten Weltkrieg, die unter jenen Arbeitern, die sie eigentlich zur Kirche bekehren wollten, das Evangelium überhaupt erst verstanden haben – auf eine weitere Kurzformel gebracht: Priester (SC) verlassen das Innen von Kirche (LG), gehen hinaus in die Welt (GS) und entdecken dort Spuren Gottes (DV). Den Weg dorthin weist Ad gentes, ein anderer Konzilstext zur Welt-Mission der Kirche:
„Wie Christus selbst den Menschen direkt ins Herz geblickt und sie durch ein wahrhaft menschliches Gespräch zum Licht Gottes geführt hat, so sollen auch seine Jünger:innen […] die Menschen kennen, unter denen sie leben […]. In aufrichtigem und geduldigem Zwiegespräch sollen sie lernen, was für Reichtümer der freigebige Gott unter den Völkern verteilt hat – und zugleich sollen sie versuchen, diese Reichtümer durch das Licht des Evangeliums zu erhellen […]. […] Wie Christus durch die Städte und Dörfer zog, um zum Zeichen der anbrechenden Gottesherrschaft Krankheiten und Gebrechen zu heilen, so verbündet sich auch die Kirche […] mit Menschen jedweden Standes, besonders aber mit den Armen und Bedrängten […]. Sie nimmt an ihren Freuden und Schmerzen teil, sie weiß um die Sehnsüchte und Rätsel des Lebens und leidet mit in den Ängsten des Todes.“ (AG 11; 12).
[1] Vgl. Ch. Bauer: Optionen des Konzils? Umrisse einer konstellativen Hermeneutik des Zweiten Vatikanums, in: Zeitschrift für katholische Theologie 134 (2012), 141-162.
[2] Der römische Kardinal Brandmüller reagierte kürzlich auf traditionalistische Konzilskritik selbst mit einem traditionalistischen Argument (vgl. die Dissertation „Pastorale Lehrverkündigung“ von Florian Kolfhaus), das die dogmatische Bedeutung der Pastoralkonstitution prinzipell übergeht: „Die wirklich wichtigen Dokumente, also die Konstitutionen zur Liturgie, zur Kirche, zur Heiligen Schrift, haben Bestand, und sie stehen ganz im Strom der kirchlichen Überlieferung. […] Merkwürdig ist, dass die Traditionalisten gerade gegen die Texte Sturm laufen, die anders als die genannten Konstitutionen den geringsten Verbindlichkeitsgrad haben und lediglich ‚Deklarationen‘ sind. Ich spreche hier von ‚Nostra aetate‘ über die Elemente der Wahrheit in den anderen Religionen und über ‚Dignitatis humanae‘ zur Glaubens- und Gewissensfreiheit.“
[3] M.-D. Chenu: Vie conciliaire de l’Église et sociologie de la foi, in: Ders. : La foi dans l’intelligence. La parole de dieu II, Paris 1964, 371–383, 381.
[4] Vgl. Ch. Bauer: Vom Lehren zum Hören. Offenbarungsmodelle und Evangelisierungskonzepte im Übergang vom Ersten zum Zweiten Vatikanum, in: J. Knop, M. Seewald (Hg.): Das Erste Vatikanische Konzil. Eine Zwischenbilanz 150 Jahre danach, Darmstadt 2019, 95-116.
Bildquellen: Ch. Bauer (Beitragsbild), J. Windischer (Bild 1) sowie Kirchengeschichte in Bildern. Die Gegenwart (Bd. 10), Düsseldorf 1982 (Bild 2).
Dieser Beitrag ist eine gekürzte Version von Ch. Bauer: Testimonianza cristiana in un mondo secolare? Il futuro del Concilio Vaticano II in una prospettiva europea, in: A. Grillo, S. Massironi (Hg.): Geofuturo di un Concilio. Sguardi periferici sul Vaticano II, Rom 2025.
In den nächsten Tagen erscheint eine italienische Übersetzung dieses Beitrags auf Settimana News sowie eine spanische auf Religión Digital.