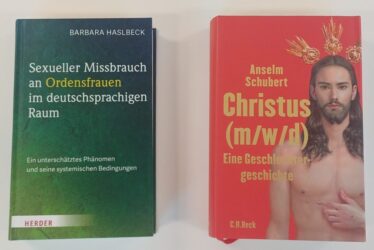Angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen hebt Max Josef Schuster die Taufwürde als zentrales Moment gegen die Instrumentalisierung von Menschen und Religion hervor. In einem ersten Teil erläutert er dogmatische Grundlagen und kirchlich-gesellschaftliche Hintergründe. Der zweite Teil folgt morgen.
Zwei machtvolle globale Entwicklungen fordern die Kirchen heraus. Der freikirchliche US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und der katholische AfD-Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah sind prominente Beispiele einer weltweiten Bewegung, die gegen die angebliche Ideologie von „Diversity“ und „Gender“ ein „neues“, kriegerisch-aggressives Männerbild setzt, das auf alte Rollenmuster zurückgreift.
Hegseth ist eng mit der reformierten Rekonstruktionismus-Bewegung verbunden, einer Gruppierung, die die Anwendung ‚biblischer Gesetze‘ in der Gesellschaft fördert, aggressive maskulinistische Werte hochhält, ausschließlich männliche Führungsstrukturen befürwortet und an die aktive Vorbereitung der Welt auf die prophezeite Rückkehr Jesu glaubt. In einem Video auf TikTok gab Krah Männern den Tipp, sie sollten sich nicht einreden lassen, ‚lieb, soft, schwach und links‘ sein zu müssen. ‚Echte Männer‘, sagte Krah, seien rechts“.
Parallel dazu findet die „Tradwife-Bewegung“ Zulauf, die Frauen wieder vorrangig als traditionelle Hausfrauen definiert, die den Männern dienen sollen. Konservative Influencerinnen instrumentalisieren Religiosität und erklären, „dass Männer und Frauen unterschiedliche, aber heilige Rollen haben. Dadurch nutzen sie religiöse Botschaften, um christlich-nationalistische Ideen zu verankern, besonders rund um das Konzept der traditionellen Kernfamilie“ – und fordern, „dass westliche Gesellschaften auf christlich-nationalistischen Werten basieren sollten.“1
Abschied von Empathie, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Menschlichkeit?
Eine zweite Entwicklung verkörpern US-amerikanische Tech-Milliardäre. Mit der Behauptung „Die Schwäche des Westens ist Empathie“ verabschiedet sich Elon Musk aus einer christlich-jüdischen und aufgeklärt-demokratischen Tradition, in der bis heute Empathie, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Menschlichkeit tragende Säulen eines gelingenden Zusammenlebens sind. Für Musk und seine Milliardärs-Kollegen geht es weniger darum, „die Welt zu einem besseren Ort zu machen, sondern eher darum, das menschliche Dasein überhaupt hinter sich zu lassen.“2 Auch sie vertreten ein aggressives Männerbild, verbunden mit unbedingter sexueller Dominanz und Abwertung von Frauen, sowie mit einer eiskalten Geringschätzung von Unterlegenen: „Die Armen werden für ihre Armut verantwortlich gemacht.“3 Inzwischen finden sich Elemente dieser empathiefreien Haltung auch in deutschen Debatten über Flüchtlinge, Randgruppen und Arme – nicht nur bei der AfD.
Innerhalb der katholischen Kirche treffen diese beiden Entwicklungen auf eine oft weiterhin klerikale Kultur. Zu dieser Kultur gehört auch ein Co-Klerikalismus von engagierten „Laienchristen“, der im Blick auf Priester tief verwurzelte Rollenbilder und -erwartungen pflegt: beispielsweise verstehen sich manchmal sogar Männer und Frauen, die in ihrem Beruf Leitungsverantwortung übernehmen, immer noch als „Befehlsempfänger*innen“ des Pfarrers oder der Hauptamtlichen (die sie als ihre „Chefs“ betrachten) – und nicht, dogmatisch korrekt, als freie „Mitarbeiter*innen Gottes“.
Wie kann diese klerikale Kultur überwunden werden?
Als Antwort auf diese Zukunftsfrage wird oft auf die Bedeutung der Taufe verwiesen: Kleriker und „Laien“ sind ja allesamt getauft und gehören gemeinsam zum „heiligen Volk Gottes“. Doch ist die eigene Taufe wirklich mit einer lebendigen und prägenden Erfahrung verbunden? Nicht nur die meistens praktizierte Kindertaufe(im Säuglings-, Kindergarten- oder Grundschul-Alter), sondern auch die oft bei Erwachsenentaufen geübte Praxis lassen Zweifel aufkommen. Es ist bezeichnend, dass in der frühen Kirche Bischöfe vor der Kindertaufe gewarnt haben, weil sie keine prägenden und bewussten Tauf-Erfahrungen ermögliche. Erwachsene werden beispielsweise meistens – wie Säuglinge – nur mit einigen Wasserspritzern benetzt. Auch die rituellen Salbungen fallen recht bescheiden aus. Und nach einer Viertelstunde oder höchstens 20 Minuten ist die Taufe vorbei. Und für Kleriker ist der Ritus ihrer Diakonats- oder Priesterweihe eine viel eindrucksvollere Erfahrung als die Taufe. Kein Wunder, wenn Kleriker eher ihre Weihe als Kraftquelle und tragendes Fundament für ihr Leben bezeichnen als ihre Taufe.
Einerseits geht es also – innerkirchlich – um die Frage: Wie können die Getauften die Bedeutung ihrer eigenen Taufe zumindest nachträglich erfahren, um so ihre Würde zu entdecken und den (Co-)Klerikalismus zu überwinden? Andererseits – im Blick auf die Gesellschaft – geht es um die Frage: Wie kann die Suche der Getauften nach stärkenden Rollenbildern angestoßen werden? Diese Fragen haben mehr miteinander zu tun, als es auf den ersten Blick scheint: Für die Antwort auf beide Fragen ist ein dialogischer Freiraum notwendig. Und beide Fragen können mit einem dogmatischen Rückgriff auf die Theologie der Taufe beantwortet werden.
Aufgabe der Kirche: Aufbau der menschlichen Gesellschaft.
Die zentrale Aufgabe der Kirche ist ja seit dem Zweiten Vatikanum „die Rettung der menschlichen Person“ und der „rechte(…) Aufbau der menschlichen Gesellschaft“.4 Um diese Aufgabe erfüllen zu können, formuliert das Konzil mit lehramtlicher Autorität, die Kirche bedarf bei ihrer Evangelisierung „der besonderen Hilfe der in der Welt Stehenden, die eine wirkliche Kenntnis der verschiedenen (…) Fachgebiete haben (…), gleichgültig, ob es sich um Gläubige oder Ungläubige handelt.“ (GS 44) Dabei sollen „auch die Ergebnisse der profanen Wissenschaften, vor allem der Psychologie und der Soziologie, wirklich beachtet und angewendet werden“ (GS 62). Es ist kein Zufall, dass traditionalistische Kirchenkreise dieses Konzil ganz ablehnen oder zumindest behaupten, „Gaudium et Spes“ sei „nur“ eine unverbindlich-seelsorgliche Meinungsäußerung eines Konzils, dessen angebliche Fortschrittsgläubigkeit sich als zeitbedingte Ideologie erwiesen habe.
Deshalb sind Männer- und Frauenrollen nicht autoritär „von oben“ oder als „unveränderlich-heilige Tradition“ zu dekretieren, sondern sie sind miteinander auszuhandeln. So kommt eine Vielfalt von Perspektiven ins Spiel, so können auch heutige Rollen in die kirchliche Tradition eingeschrieben werden, und so wird vor allem verhindert, dass Männer (Kleriker, Hauptamtliche) den Frauen ihren Platz in Kirche und Welt anweisen – so, wie das Jahrhunderte lang kirchlich üblich war (und mancherorts immer noch üblich ist).
Taufe als Erleben radikaler Statusgleichheit.
Wer die frühchristlichen Zeugnisse zur Taufe von Erwachsenen genauer studiert, begreift, warum die Osternacht (als liturgische Nachtwache vom Sonnenuntergang bis zum Sonnenaufgang) im 4. und 5. Jahrhundert allmählich zur „Taufnacht“5 der Gemeinde wurde, – greift sie doch die Grundstruktur der in vielen alten Kulturen üblichen Initiation6 auf: Die Wache in der „Wüste der Nacht“ entsprach der Verschleppung der Initiant*innen an einen wilden Ort, an dem für sie nichts mehr gewohnt und bekannt war. Kontrollverlust und Ausgeliefert-Sein waren prägende Erfahrungen, und gleichzeitig erlebten alle Teilnehmer*innen des Rituals in diesem Zeitraum eine radikale Statusgleichheit – vor der Taufe ausgedrückt durch das Ablegen aller Kleidung (die ja auch den sozialen Status der Personen markiert) und des Schmucks bis zur vollständigen Nacktheit – und nach der Taufe durch das weiße Gewand aller Neugetauften.
Dazu passt, dass die exklusive (nur Königen oder Priestern vorbehaltene) Salbung aus theologischen Gründen „demokratisiert“ wurde: Im königlichen und priesterlichen Volk Gottes (vgl. 1 Petr 2,9) gilt sie allen getauften Frauen und Männern – unabhängig von ihrem Stand. Diese Statusgleichheit gründet im Glauben, dass alle Getauften Anteil bekommen an den drei Ämtern Christi: Wie Jesus, der Messias, sind sie König*in, Priester*in und Prophet*in. Der Franziskaner-Theologe Richard Rohr bezeichnet die drei Ämter Christi als Archetypen.7 Er hat in seiner Arbeit mit Strafgefangenen erkannt, dass verunsicherte und verletzte Männer „giftigen“ Männerbildern auf den Leim gehen, um sich endlich (wieder) „groß“, „stark“ und „sicher“ zu fühlen.
Alte Weisheit gegen ‚Mindset‘ heutiger Tech-Miliardäre.
Deshalb hat sich Richard Rohr jahrelang mit männlichen Archetypen beschäftigt und weltweit Initiationsriten für Männer angeboten8, die ein Gegengewicht gegen solche Männerbilder setzen, indem sie die Weisheit der wesentlich religiösen Ur-Welt des Menschen fruchtbar machen.9 Die von Richard Rohr zusammengefassten „fünf Wahrheiten“ der männlichen Initiation zeigen, wie weit diese alte Weisheit beispielsweise vom „Mindset“ der heutigen Tech-Milliardäre entfernt ist:
Das Leben ist schwer – Du bist nicht so wichtig – In deinem Leben geht es nicht um dich – Du hast nicht die Kontrolle – Du wirst sterben.
Die drei Ämter Jesu Christi können als Impulse für positive Wachstumskräfte verstanden werden. Allerdings können sie auch „gekapert“ werden, – um angeblich heilige traditionelle Geschlechter-Rollen als ewig gültige Normen durchzusetzen. In Zukunft ist damit zu rechnen, dass sich diese Auseinandersetzung noch zuspitzt. Deshalb sollten Veranstaltungen zum Thema ausdrücklich als dialogische Bildungsveranstaltungen im Sinn des Zweiten Vatikanischen Konzils konzipiert werden: als hilfreiches Angebot, um ohne Denkverbote, kreativ und selbstbewusst eigene Potenziale zu entdecken und zu stärken. Diese Erfahrung eröffnet nicht nur einen Zugang zur Taufwürde, sondern schützt auch davor, in autoritär vorgegebene Rollenmuster zu verfallen oder andere Menschen abzuwerten und auf bestimmte Geschlechter-Stereotypen festzulegen, um selbst groß rauszukommen.
___
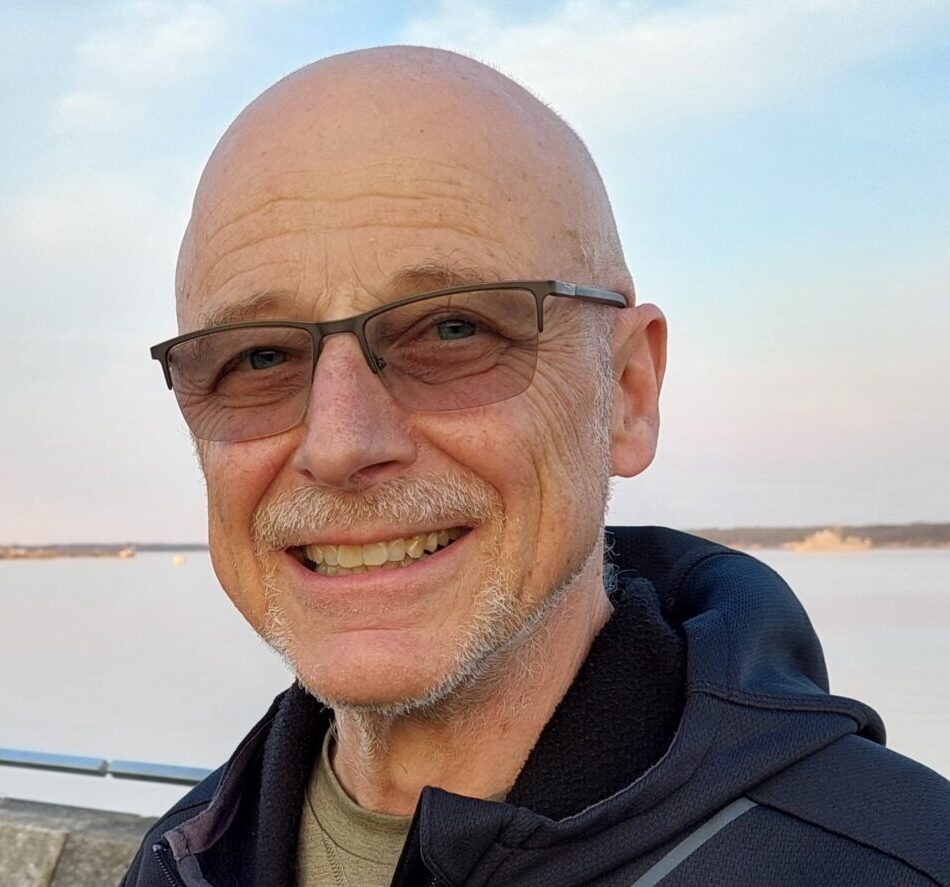
Beitragsbild: Markus Krauth, Tauffeier in der Kirche Maria Geburt, Aschaffenburg.
- Interview mit Eviane Leidig auf feinschwarz. ↩
- Douglas Rushkoff, Prepper mit Milliarden: Das Mindset der Tech-Elite, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 2/2025, 80f. Vgl. Ders., „Survival oft he Richest“, Berlin 2025. ↩
- A.a.O., 85. ↩
- Vgl. Zweites Vatikanisches Konzil, Pastorale Konstitution „Gaudium et Spes“ über die Kirche in der Welt von heute, Nr. 3. ↩
- Vgl. Anthonius Scheer, Die Ostervigil – ein Übergangsritus? Eine Untersuchung über das Wesen der liturgischen Osterfeier, in: Concilium 14 (1978), 99-105. ↩
- Vgl. Arnold van Gennep, Übergangsriten. Frankfurt/Main 1986 sowie Victor W. Turner, Das Ritual. Struktur und Anti-Struktur, Frankfurt-New York 1989. ↩
- Vgl. Richard Rohr, Masken des Maskulinen. Neue Reden zur Männerbefreiung, München 1993 – und: Robert Moore / Douglas Gilette: König, Krieger, Magier, Liebhaber. Die Stärken des Mannes, München 1992. Zum Thema weibliche Archetypen: Anselm Grün und Linda Jarosch, Königin und wilde Frau. Lebe, was du bist, Münsterschwarzach 2017. Jeder Archetyp hat eine helle (positive) und dunkle (negative) Seite. So kann der König zum Tyrannen werden, oder die Prophetin zur Wichtigtuerin. Der priesterliche Archetyp wiederum hat nichts mit dem (katholischen) „Amtspriestertum“ zu tun, sondern bezeichnet allgemein-menschliche Erfahrungen: beispielsweise im Gebet direkten Zugang zu Gott zu haben, oder die Möglichkeit, für andere Menschen ein Segen zu sein. ↩
- Vgl. Richard Rohr, Endlich Mann werden. Die Wiederentdeckung der Initiation, München 2005. ↩
- Vgl. Bernhard Welte, Die Würde des Menschen und die Religion. Anfrage an die Kirche in unserer Gesellschaft, Frankfurt am Main 1977. ↩