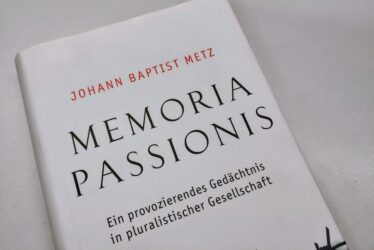Die EKD legt auf ihrer Synode in Dresden die lang erwartete neue Friedensdenkschrift vor. Die Friedensethikerinnen Nicole Kunkel und Therese Feiler diskutieren Wegweisendes und Leerstellen.
Worin liegt für Dich das Neue, vielleicht auch das Bessere, an der aktuellen Friedensdenkschrift?
Feiler: Als Kritikerin des „Gerechten Friedens“ in seiner alten, widersprüchlichen Form sehe ich drei neue, positive Entwicklungen. Erstens sind die vier „Dimensionen“ – Schutz vor Gewalt, Förderung von Freiheit, Abbau von Ungleichheit und friedensfördernder Umgang mit Pluralität – hierarchisiert worden. Der Schutz vor Gewalt gilt nun als basale Anforderung (S. 8).
Damit wird zweitens der Staat in die Verantwortung genommen. Die findet man schon in der Barmer Erklärung von 1934: es „sei die Aufgabe des Staates‚ unter Androhung und Anwendung von Gewalt in der noch nicht erlösten Welt für Recht und Frieden zu sorgen‘“ (S. 56). Diese Verlagerung auf einen eher staatspolitischen Standpunkt zeichnete sich schon 2023 im Debattenbeitrag Maß des Möglichen ab.
Drittens wird der Frieden Gottes als kein utopischer, sondern ein eschatologischer, verstanden (S. 44). Damit steht die Einladung, sich hic et nunc düsteren Realitäten zu widmen und nicht bloß in weltfremder Glaubenssubjektivität zu schwelgen. Das war überfällig.
Kunkel: Ich finde vor allem, dass es wirklich an der Zeit war, eine Denkschrift vorzulegen, die die aktuellen Problemlagen im Bereich der Friedensethik aufgreift. Besonders überzeugend erscheint mir der Fokus auf hybrider Kriegführung, durch die die Grenze zwischen Krieg und Frieden zunehmend verwischt. Ebenso werden Angriffe im digitalen Raum, Terrorismus und neue militärische Technologien thematisiert.
All das sind brennende Themen der Gegenwart, weil die Zivilbevölkerung heute weit stärker betroffen ist als früher. Die Denkschrift fordert hier zu Recht, Mechanismen der Resilienz anzustoßen, die in die Gesellschaft hineinwirken können. Auch die Einbeziehung von Klimafragen als kriegstreibende Faktoren halte ich für außerordentlich wichtig und zentral, auch wenn deren Behandlung durchaus ausführlicher hätte ausfallen dürfen.
Was bleibt an dieser Friedensdenkschrift trotz guter Absichten fragwürdig – und warum?
Kunkel: Ich finde den Titel der Denkschrift – „Welt in Unordnung“ – insgesamt irritierend. Das gilt umso mehr, als im Dokument die „fundamentale Unordnung des Herzens“ als „Sünde“ bezeichnet wird. Weiter ausgeführt heißt es dabei, dass es um „die Unfähigkeit oder die Unwilligkeit geht, das eigene Leben aus dem Zuspruch und dem Anspruch Gottes heraus zu gestalten“ (S. 28). Was als anthropologische Grundbestimmung des Menschen aus dogmatischer Perspektive durchaus seinen Platz hat, wirkt in einem politischen Dokument, das den Anspruch erhebt, auch in einer pluralen Welt Handlungsorientierung zu bieten, für mich deplatziert.
Außerdem empfinde ich den starken europäischen und transatlantischen Fokus – zentrale Themen der politischen Lage sind Russlands Krieg gegen die Ukraine und der Rückzug der USA aus der europäischen Sicherheitsarchitektur – bei gleichzeitiger Vernachlässigung der Rolle Chinas als befremdlich. Stattdessen findet sich eine ausführliche Debatte über die (Wieder-)einführung einer Wehr- bzw. Dienstpflicht.
Feiler: Mit Deiner Kritik würde ich d’accord gehen und sie mit den Grenzen des Formats „Denkschrift“ selbst verbinden, also der Position, aus der der Text spricht: die „der evangelischen Kirche“. Sie weiß zwar einerseits um die sehr unterschiedlichen Positionen ihrer Mitglieder. Die Freiheit des Gewissens vor Gott wird anerkannt, es soll gestärkt und zu Entscheidungen befähigt werden. Andererseits soll am Ende eine kohärente Aussage stehen, sogar Urteile werden angeboten, nicht ohne Autoritätsanspruch, und das über ein extensives Themenfeld.
Dadurch kann die Denkschrift Probleme aber immer nur antippen, Debatten verschieben, mit angezogener Handbremse fahren. Sie wird erst dann warm, sobald sie im Kerngeschäft steht: bei der Verkündigung dessen, worauf Kirche in all der Unordnung nun schaut und harrt. Insofern würde ich die dogmatischen Nuggets, die Du als eher deplatziert siehst, sogar als wirkliche Stärke der Schrift sehen.
Welche Passagen der Denkschrift erscheinen Dir aus Deiner wissenschaftlichen Arbeit heraus besonders problematisch oder verkürzt?
Feiler: Für die Evangelische Kirche in Deutschland fehlt mir das Thema der anhaltenden Migration, sofern sie die innere Sicherheit und damit den inneren Frieden gefährdet. Dabei geht es nicht „nur“ um Terrorismus. Gewalt durch Migranten, wie stumpf oder grell man die Zahlen lesen mag, ist der innenpolitische Zankapfel. Er betrifft die staatlichen Finanzen, den kulturellen Grundkonsens, das „Wir“, das de facto fast verloren ist. Die Debatte über Wehr- und Dienstpflicht ist m. E. ein Verlustsymptom. Es dürfte auch kein Zufall sein, dass Regierungswechsel in immer kürzeren Abständen stattfinden, in Deutschland, England, auch Frankreich.
Für solche Unterströmungen fehlt der Friedensschrift das Sensorium. Sie wartet mit einem dünnen Verweis auf „Sicherheitsexperten“ auf und stemmt sich gegen eine „Politik der Angst“, um dann rechtspopulistische Buhmänner zu markieren (S. 85). Aber das wird den Realitäten nicht ansatzweise gerecht. Auch die Anschläge auf Leib und Leben, denen rechte Politiker überdurchschnittlich oft ausgesetzt sind, geraten so aus dem „ Blick“. Im schlimmsten Fall kann das als schweigender Entzug der Schutzwürdigkeit gelesen werden, was katastrophal ist. Die Gegenbewegung ist durchaus da, wenn die Kirche z. B. „Räume friedlicher Verständigung“ (S. 26) und die Anerkennung des Anderen als Geschöpf Gottes anbietet. Nur wirkt das dann eben allgemein, kraftlos.
Kunkel: Das sehe ich etwas anders – ich nehme die Debatten um Migration eher als Triggerpunkte, denn als reale Gefahren war.
Aus meiner fachlichen Perspektive fallen mir aber vor allem die Ausführungen zu autoregulativen Waffensystemen (S. 89) negativ auf – die allerdings weitgehend unter dem unkritisch übernommenen Anthropomorphismus der Autonomie diskutiert werden. Die Einordnung dieser Systeme erscheint mir enorm verkürzt. So fehlt der Hinweis auf das zentrale Paradigma der bedeutungsvollen menschlichen Kontrolle („meaningful human control“), das sich mittlerweile in den internationalen Verhandlungen etabliert hat, vollkommen.
Die Forderungen der Denkschrift nach entweder einem Verbot oder einer Einhegung dieser Waffensysteme wirken vor dem Hintergrund dieser Debatten überholt. Ein Verbot scheint derzeit politisch nicht durchsetzbar, während die Diskussion über eine Einhegung seit über zehn Jahren im Rahmen der UN geführt wird und vor allem ein Problem der Rüstungskontrolle darstellt. Genau diese notwendige Tiefenschärfe fehlt in diesem Abschnitt jedoch. Das ist schade, weil es Expert:innen für dieses Thema auch im Bereich der evangelischen Friedensethik gibt.
Was bleibt für Dich – theologisch, kirchlich oder persönlich – als wichtigste Einsicht dieser Denkschrift zurück?
Kunkel: Zentral ist für mich, dass Kirche und Theologie auch in einer komplexen Welt zu gesellschaftlich relevanten Themen Stellung beziehen – und Frieden ist zweifellos eines der Themen. Besonders wichtig erscheint mir dabei die eschatologische Friedensausrichtung sowie die Bestimmung von Frieden als gerecht, womit die friedensethischen Traditionen der christlichen Kirchen aufgenommen werden. Beides sind zentrale Aspekte, die es lohnen, weiterhin in den gesellschaftlichen und politischen Diskurs eingebracht zu werden.
Dabei zeigt sich in der Denkschrift, wie herausfordernd es bleibt, theologische Kategorien wie Schuld, die Friedensvorstellungen eines umfassenden „Schalom“ und Gerechtigkeit in eine komplexe, plural verfasste Welt zu übersetzen. Dass die Denkschrift sich dieser Spannung stellt, ist ihr Verdienst – auch wenn die Übersetzungsleistung nicht vollständig überzeugt.
Feiler: Für mich klingt ein irritierender Sound nach, der sich aus dem oben Gesagten ergibt, auch wenn ich die Mühen aller Beteiligten sehr schätze. Statt eines 150-seitigen Mammut-Dokuments – sichtlich bemüht, oft Unvereinbares zu vereinbaren – würde ich mir in Zukunft eher kurze, pointierte Interventionen zu aktuellen Problemen wünschen. Streitfähigkeit auf Augenhöhe, geistesgegenwärtig: das ist evangelische Jagd nach Frieden.

Therese Feiler ist Gastwissenschaftlerin am Lehrstuhl für Systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der LMU München. Sie hat zur Logik des Krieges aus Sicht der bellum iustum-Tradition promoviert und arbeitet u.a. zu moderner Kriegsethik aus theologischer Perspektive.
(Foto: Therese Feiler)

Nicole Kunkel ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Systematische Theologie (Ethik und Hermeneutik) an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie beschäftigte sich in ihrer mehrfach preisgekrönten Dissertation mit der ethischen Beurteilung von autoregulativen Waffensystemen aus Sicht des gerechten Friedens, den sie als bedingten Pazifismus einordnet.
(Foto: Regine Peter)
Beitragsbild: Friedenssynode EKD 2019, Carolina Garcia Tavizon