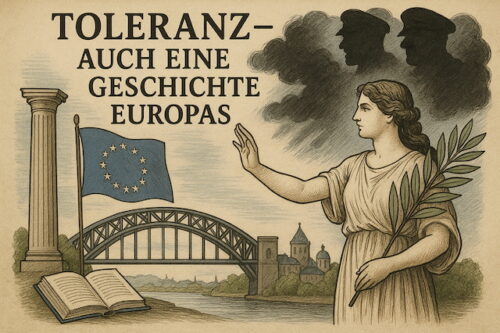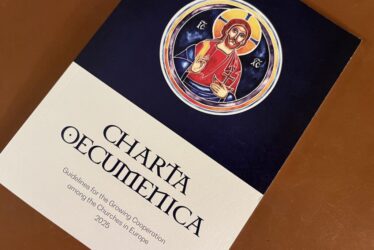Angesichts der bedenklichen politischen Entwicklungen, in deren Fahrwasser Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung, und rechtsextreme Parolen wieder salonfähig zu werden drohen – nicht nur in den USA, sondern auch in vielen Ländern Europas – hat ein Buch über Toleranz höchste Aktualität. Heinrich Schmidiger, Philosoph und emeritierter Rektor der Universität Salzburg hat es geschichtlich und philosophisch durchbuchstabiert. Felix Senn stellt die Publikation vor.
Als ich den Titel des Buches las, dachte ich: Wow, der traut sich was! Im Untertitel klingt das monumentale Alterswerk von Habermas an „Auch eine Geschichte der Philosophie“. Zudem stolpere ich sogleich über die Verbindung von Toleranz und Europa, zeigt doch Europa derzeit wieder immer mehr seine intolerante Seite. Klar, da war die Aufklärung mit ihrem Toleranz-Programm – ein fraglos europäisches Projekt. Aber das brachte viele intolerante Strömungen keineswegs zum Verstummen und konnte ausgrenzende politische Massnahmen und autoritäre Regime nicht verhindern.
… trotz aller Beteuerungen nach dem Zweiten Weltkrieg …
Im Gegenteil: Nirgends ging es im 20. Jahrhundert so brutal, ja tödlich intolerant zu und her wie in europäischen Ländern mit Nationalsozialismus und Faschismus, Stalinismus und Eisernem Vorhang. Und trotz aller Beteuerungen nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es so nie mehr werden dürfe, sind wir heute wieder mit Riesenschritten auf einem Weg in endgültig vergangen geglaubte Zeiten. Und vor der Aufklärung war Europa ohnehin alles andere als ein Vorbild für Toleranz. Stichworte wie Kreuzzüge, Ketzerverfolgungen und Hexenverbrennungen, Eroberung und Ausbeutung der Länder des Südens, Imperialismus und Kolonialismus, Ausrottung und Versklavung indigener Völker im Gefolge von Kolumbus (…) sprechen Bände.
… schonungslos ehrlich und sorgfältig abwägend …
All das machte mich neugierig, das Buch genauer zu lesen. Und siehe da: Sämtliche Themen, die oben angesprochen sind, kommen hier schonungslos ehrlich und sorgfältig abwägend zur Sprache. Das Buch verklärt keineswegs einfach ein tolerantes Europa, sondern zeigt selbstkritisch auf, wie dornig der Weg zu mehr Toleranz war und noch immer ist. Für den Autor ist klar, dass „am Anfang die Intoleranz“ (16) steht. Und nicht nur das, sondern: „… die Intoleranz scheint das anhaltende, kaum überwindbare Gegenüber der Toleranz zu sein – und zu bleiben“ (ebd.). Zudem unterscheidet Schmidinger deutlich zwischen Entwicklungen in Lebenswelt und Politik einerseits und im argumentativen Diskurs und der Wissenschaft andererseits, obwohl es natürlich zwischen beidem einen Zusammenhang und eine Wechselwirkung gibt (vgl. 14-16). Um dieser Wechselwirkung gerecht zu werden, entscheidet er sich für „eine Erzählung der Geschichte der Entwicklung des Toleranz-Gedankens“, dessen (scheinbar) unhintergehbaren Durchbruch er in der Aufklärung und insbesondere in der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 ortet.
Toleranz hat Grenzen
Dabei zeigen schon die Debatten in der Aufklärung selbst, dass Toleranz relativ schwach als „Dulden“ oder Nicht-Diskriminieren verstanden werden kann, dass sie sich aber in verschiedenen Zusammenhängen – aber nicht in jedem Fall – zu Anerkennung und Achtung weiterentwickeln muss. Wichtig ist auch die politisch derzeit höchst aktuelle Einsicht, dass Toleranz Grenzen hat und deshalb mit einem Paradox leben muss: Sie gibt sich nämlich dann auf, „wenn sie auch noch ihr Gegenteil, die Intoleranz, toleriert“ (46).
Vor diesem Hintergrund nimmt uns der Autor in seiner „Erzählung“ mit auf einen erhellenden Gang durch die Geschichte. Er geht dabei weit zurück bis in die Antike, zu den biblischen Wurzeln und zur griechischen Stoa. Dabei korrigiert er mit bemerkenswerten Argumenten das gängige Vorurteil, der Monotheismus fördere die Intoleranz, zeigt die frühen Anfänge des Antijudaismus auf und wie im frühen Christentum die Toleranz auf der Strecke blieb. Ein Blick auf die drei abrahamitischen Religionen zeigt, wie diese schon in den Anfängen gegenseitig zwischen Duldung, Ablehnung und Anerkennung changieren.
Mittelalterliche Grundimpulse
Auch wenn im Mittelalter die Kreuzzüge ein düsteres Zeugnis brutaler Intoleranz geben, so liegen doch in ebendiesem Mittelalter – nämlich in den grossen Religionsdialogen, den interreligiösen Traktaten und im Verständnis der Seelsorge – auch die Grundimpulse für den modernen Toleranzdiskurs. Nicht zuletzt vorbereitet durch die mittelalterliche Mystik und die devotio moderna, kann sich zumindest auf der Ebene philosophischer und theologischer Reflexion die Toleranz in der frühen Neuzeit immer besser durchsetzen. Zudem zwingen die Erschütterungen durch Reformation und Gegenreformation dazu, Frieden und Toleranz sowohl praktisch wie philosophisch zu stärken, damit die Gesellschaft nicht komplett auseinanderfällt. Damit ist der Weg bereitet für den Durchbruch von Toleranz, Gewissens- und Meinungsfreiheit sowie der Menschenrechte und der Religionsfreiheit in der bürgerlichen Aufklärungszeit.
Im 19. Jahrhundert kommen zentrale Knackpunkte aufs Tapet
Doch in der Folge bilden Nationalismus, Kolonialismus und nicht zuletzt der antiaufklärerische Katholizismus eine schwere Hypothek für das Projekt von Toleranz und Anerkennung. Deshalb beschränken sich im 19. Jahrhundert die Impulse dafür eher auf Literatur (Johann Wolfgang von Goethe) und philosophische Diskurse. Auf diesem Boden gedeihen grosse Europa-Visionen wie jene von Victor Hugo oder Heinrich Heine. Aber es kommen auch zentrale Knackpunkte aufs Tapet und auf die politische Agenda: Abschaffung der Sklaverei, Gleichberechtigung der Frauen (Olympe de Gouges, Harriet Taylor) und Ausbeutung der Arbeiterkasse (Karl Marx).
Wechselvolle Geschichte im 20. Jahrhundert
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bringen die beiden Weltkriege einen massiven Rückfall in vormoderne Zeiten. Immerhin verleiht dieser gravierende Bruch der Menschlichkeit und mit den Ideen der Aufklärung (Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit) in der Nachkriegszeit den Toleranzbestrebungen in der politischen Praxis und in der Wissenschaft neuen Schub. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948) wird in Kraft gesetzt, die Anerkennung der pluralistischen Gesellschaft gefördert; in der politischen und philosophischen Wissenschaft werden Anerkennungs- und Gerechtigkeitsdiskurse prominent vorangetrieben; die katholische Kirche überwindet im Zweiten Vatikanischen Konzil ihre intolerante Abschottungsstrategie und sucht den Dialog mit anderen Religionen und allen Menschen guten Willens; interkulturelle und interreligiöse Projekte wie das Projekt Weltethos (Hans Küng) bringen die Bemühungen um Toleranz wieder in Fahrt. Anhand des Romans von Thomas Mann „Joseph und seine Brüder“ zeigt Schmidinger exemplarisch auf, wie Europa trotz dieser bedenklichen und wechselvollen Geschichte dennoch als Toleranz-Projekt verstanden werden kann.
Wie fragil indes dieses Toleranz-Projekt ist, zeigt der Umstand, dass von den vier abschliessend benannten Bedingungen Schmidingers für das nachhaltige Gelingen des Projektes die erste – Frieden – mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine bereits nicht mehr gegeben ist und die zweite – Rechtsstaatlichkeit – in diversen europäischen Ländern politisch auf dem Spiel steht oder zumindest geritzt wird.
Gelungene Rekonstruktion der problematischen wie auch der guten Momente
Im Rückblick auf diesen Streifzug durch das Buch lässt sich mit Fug und Recht sagen, dass es dem Autor überzeugend gelungen ist, anhand des Stichworts Toleranz die europäische Real- und Geistesgeschichte in ihren problematischen wie auch guten Momenten zu rekonstruieren. Wer sich mit diesem Buch auseinandersetzt, wird reich belohnt und viel lernen über die Geschichte Europas, sowie über literarische, philosophische und theologische Zusammenhänge. Und er oder sie wird zweifellos sensibler für Toleranz und Intoleranz in Alltag und Politik. Deshalb empfehle ich dieses Buch wärmstens zur Lektüre.
Literaturangabe: Heinrich Schmidinger, Toleranz – auch eine Geschichte Europas, Schwabe-Verlag: Basel 2024, 298 Seiten. Der Autor war von 1993-2022 Professor für Christliche Philosophie an der Theologischen Fakultät der Universität Salzburg und von 2001-2019 Rektor der Universität Salzburg.
—

Felix Senn, Dr. theol., Dozent für systematische Theologie und Ausbilder mit eidg. Fachausweis, seit 2020 pensioniert und freischaffend. Zuvor war er von 1999-2015 Studienleiter bei theologiekurse.ch und von 2016-2020 Bereichsleiter Theologische Grundbildung am Theologisch-pastoralen Bildungsinstitut TBI in Zürich.
Beitragsbild: Erstellt mit Hilfe von ChatGPT