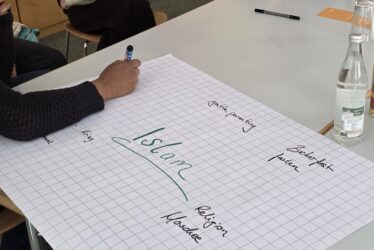Zum 70. Geburtstag am 01. November würdigt Tobias Specker SJ den islamischen Philosophen Souleymane Bashir Diagne und ordnet ihn in das Spektrum des moralischen Universalismus ein.
„Das Universelle wiedererfinden“, so formuliert der Philosoph Souleymane Bashir Diagne das Programm seines aktuellen Buches „Universaliser. L’humanité par les moyens d’humanité (Universalisieren. Die Menschheit mit den Mitteln der Menschlichkeit)“. Damit trifft der aus dem Senegal stammende muslimische Denker, der bis zum April 2025 Professor an der Philosophischen Fakultät und Direktor des Institute of African Studies an der Columbia University in New York war, einen aktuellen Nerv. Die poststrukturalistischen und postkolonialen Perspektiven der letzten Jahrzehnte stellten vor allem Differenz, Besonderheit und Unvergleichbarkeit in den Mittelpunkt. Aktuell wird hingegen angesichts der Schwächung internationaler Institutionen, der Infragestellung der Verbindlichkeit von Menschenrechten und des Erstarkens ethnischer und zum Teil auch religiös begründeter Nationalismen die Frage nach universellen Geltungsansprüchen wieder deutlicher formuliert. Die Bücher von Omri Böhm oder Hans Joas[1] zeigen es – und mit Souleymane Bashir Diagne kommt nun eine muslimische Stimme zur jüdisch und christlich geprägten Philosophie hinzu.
Universalität als Tätigkeitswort

Diagne hat sich bereits länger mit dem Thema des Universalismus auseinandergesetzt: So veröffentlichte Diagne 2018 den Gesprächsband „En quête d’Afrique(s): universalisme et pensée décoloniale (Auf der Suche nach (den) Afrika(s): Universalismus und dekoloniales Denken), 2021 das Buch „De langue à langue. L’hospitalité de la traduction (erschienen auf deutsch im Passagenverlag als: Von Sprache zu Sprache. Übersetzen als Gastfreundschaft)“ und 2024 das ausführliche Gespräch mit Françoise Blum unter dem Titel „Ubuntu“, ein Bantuwort, das „Menschlichkeit“ und „Gemeinsinn“ miteinander verbindet. Diagnes jüngstes Buch formuliert das Thema der Universalität interessanterweise als Tätigkeitswort – „universaliser“ -, womit bereits viel anklingt, was für sein Verständnis von Universalität wichtig sein wird.
Dekolonialisierung und Universalisierung
Man kann die Leitlinie von Diagnes Denken mit einem Zitat von Alioune Diop, dem senegalesischen Schriftsteller, Gründer der wichtigen Kulturzeitschrift „Présence Afrique“ und Inspirator eines wirklich weltkirchlichen Verständnisses auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wiedergeben: „Entwestlichen um zu universalisieren, das ist unser Wunsch. Um zu universalisieren, ist es wichtig, dass alle im schöpferischen Werk der Menschheit präsent sind.“[2] Mit dieser von Diagne zustimmend zitierten Aussage wird deutlich, dass für ihn Dekolonisierung und Universalisierung keine Gegensätze sind. Zum einen nimmt Diagne die Aufgabe eines postkolonialen Denkens als Dezentrierung eines über seine Partikularität unaufgeklärten Eurozentrismus wirklich ernst. Zum anderen grenzt er sich kritisch gegen die Behauptung einer unvergleichbaren Differenz der Kulturen ab und erweist sein zutiefst humanistisches Grundanliegen.
Die Aussage von Diop ist ein Zitat aus seiner Antrittsrede bei der Eröffnung des „Zweiten Kongresses der schwarzen Schriftsteller und Künstler“ in Rom 1959. Keinesfalls handelt es sich also um ein bloßes modisches und kurzlebiges Thema. In gleicher Weise bezeichnet das Thema der Universalität auch bei Diagne selbst einerseits eine aktuelle Beschäftigung, andererseits kann man es als ein Lebensthema bezeichnen.
Gabe, scharfe Kritiker ins Gespräch zu verwickeln
Das Thema der Universalität ist eine aktuelle Beschäftigung Diagnes, denn der Anlass für die Profilierung des Thema der Universalität ist Diagnes Wechsel 2008 an die Columbia University in Harlem, von der Diagne in seinen Mémoiren schreibt: „Wenn das postkoloniale Denken eine Religion wäre, wäre Columbia ihr erster Tempel.“[3] Als Diagne in einer offensiven Kritik als „Afro-centriste orientalisé“ bezeichnet wird, wird klar, dass er sich mit der Problematik von postkolonialer Kritik und universellen Ansprüchen auseinandersetzen muss. Es ist charakteristisch für ihn, dass er gemeinsam mit dem Autor der Kritik, Jean-Loup Amselle, 2018 den bereits erwähnten Gesprächsband zu „Universalismus und dekolonialem Denken“ herausgibt. Diagne hat eine Gabe, auch scharfe Kritiker in ein Gespräch zu verwickeln: So hat er 2019 auch einen Gesprächsband mit dem durchaus als islamkritisch zu bezeichnenden Mediävisten und Philosophen Rémi Brague herausgegeben: „La controverse: Dialogues sur l’islam (Die Kontroverse. Dialoge über den Islam)“.
Vermischung von Traditionen
Aber das Thema der Universalität ist auch Diagnes Lebensthema: Nicht ohne Stolz darf er sich selbst als Kind Saint Louis‘ bezeichnen. Diese Stadt im Norden Senegals vereint die Paradoxie, dass ihr Name einerseits unüberhörbar die Problematik eines französischen Universalanspruchs verkörpert. Andererseits steht die Stadt für eine lebendige métissage (Vermischung) der Traditionen Westafrikas, des Arabischen und des Französischen wie übrigens auch von Christentum und Islam: Diagne berichtet, die 1847 errichtete Hauptmoschee sei wahrscheinlich die einzige Moschee mit zwei Minaretten, von denen eines ein Glockenturm mit einer Uhr ist.
Islamische Philosophie und Mystik
Sind so Gegenwart und frühe Kindheit benannt, so sollte man, um die Lebensgestalt des Philosophen zu konturieren, zumindest stichpunktartig den Rest des Lebens umreißen. Diagne tut dies in seiner sehr lesenswerten Autobiographie „Le Fagot de ma mémoire (Das Bündel meiner Erinnerung)“ von 2021, indem er die Städte benennt, in denen er gelebt hat: Ziguinchor, die Stadt seiner frühen Schulzeit an einer katholischen Schule, Dakar als Stadt der Jugend, des Baccalaureat und der ersten Begegnung mit Léopold Senghor anlässlich der Verleihung des prix de l’humanité – und zwar für die ausgezeichnete Kenntnis des Lateinischen und Griechischen! – an den jugendlichen „Jules“, wie Diagne vertraut genannt wurde. Dann zieht Diagne nach Paris zum Besuch des Lycée und um die Studien an der Ecole Nationale Supérieure bei Louis Althusser und im Umfeld Derridas aufzunehmen. Anlässlich eines Studienaufenthaltes in Harvard beschäftigt er sich intensiv mit dem amerikanischen Pragmatismus (u.a. bei Hilary Putnam) und entdeckt die Sprache der formalen Logik. Es folgt die Promotion über die algebraische Logik des britischen Mathematikers George Booles in Paris bei Jean-Toussaint Desanti. Diese Promotion führt ihn zur Wissenschaftsgeschichte, die er 1982-2002 in Dakar lehrt. In dieser Zeit ist Diagne auch gesellschaftlich engagiert und berät u.a. den Präsidenten Abdou Diouf in Fragen der Bildungspolitik. Diagnes Auseinandersetzung mit der islamischen Philosophie, die in Dakar begonnen hat, gewinnt 2002 mit seinem Ruf an die Northwestern University in Evanston/ Illinois größeres Gewicht: Im Schatten von 9/11 bietet Diagne Seminare über islamische Philosophie und Mystik an, mit dem Ziel, wie er selbst formuliert, den Studierenden den Islam als eine intellektuelle und spirituelle Tradition zu erschließen, „in der man fragt, in der man diskutiert, in der man zweifelt, in der man analysiert, in der man interpretiert“[4]. Eine besondere Aufmerksamkeit und Sympathie findet bei ihm die Übersetzungsbewegung des 8.-10. Jahrhunderts, die mit dem sogenannten „Haus der Weisheit (bait al-ḥikma)“ verbunden ist, einem Netzwerk aus christlichen und muslimischen Gelehrten, in der die aristotelische und neoplatonische Tradition aus dem Griechischen in das Syrische und später in das Arabische übersetzt wird. Charakteristisch für Diagne ist, dass er die Tradition des kulturellen Brückenbaus, für die diese Fortschreibung der Antike in der arabischen Welt steht, selbst praktiziert und in einer eigenen, hochinteressanten Untersuchung, den indischen Philosophen Muhammad Iqbal mit seinem Zeitgenossen Henri Bergson zusammenhält.[5]
Mühe und geistiges Abenteuer des Übersetzens
Und so ist dies vielleicht die eigentliche Besonderheit Diagnes: Er glaubt zutiefst an die geistige Kraft und das humanistische Erbe der translatio studii, die sich der Mühe, aber auch dem geistigen Abenteuer des Übersetzens stellt und die nicht allein der griechisch-römischen Antike gehört, sondern ein Paradigma für den kreativen Geist der ganzen Menschheit darstellt. So formuliert Diagne in dem Buch über das Übersetzen eine programmatische Aussage, die auch als Überschrift dem Schaffen des Autors stehen kann, der am 8. November seinen siebzigsten Geburtstag feiert: „Dem relativistischen und separatistischen Modell einer Entkolonialisierung des Denkens stelle ich ein übersetzendes Modell gegenüber. Da Sprachen uns nicht in unvereinbare grammatikalische Philosophien einschließen, wird der Philosoph im Allgemeinen und der afrikanische Philosoph im Besonderen wie ein Übersetzer denken, von Sprache zu Sprache.“[6]
____
Tobias Specker SJ wurde 1971 in Goch am Niederrhein geboren und studierte Germansitik und katholische Theologie in Freiburg i.Br. und Bochum sowie Islamische Theologie an der Universität Frankfurt. Seit 2014/15 hat er zunächst als Juniorprofessor, seit 2021 als Professor, den Stiftungslehrstuhl „Katholische Theologie im Angesicht des Islam“ an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen inne. Seit August 2021 ist er zudem Superior der Jesuitenkommunität auf dem Campus Sankt Georgen.
Foto: Christof Haake
Titelbild: Shutterstock.com / Allexxandar
[1] Omri Böhm: Radikaler Universalismus: Jenseits von Identität. Berlin 2022. Hans Joas: Universalismus. Weltherrschaft und Menschheitsethos. Berlin 2025.
[2] „Désoccidentaliser pour universaliser, tel ets notre souhait. Pour universaliser, il importe que tous soient présent dans l’oeuvre créatrice de l’humanité.“ Universaliser, 26.
[3] „Si le Postcolonial était une religion, Columbia en serait le premier temple.“ Fagot, 142.
[4] Vgl. Fagot, 108. S.a. die Publikation von 2014 „Comment philosopher en Islam“ (Auf Deutsch 2020 im Passagenverlag als „Philosophieren im Islam“).
[5] So in „Islam Et Societe Ouverte. La Fidelite Et Le Mouvement Dans La Pensee De Muhammad Iqbal“ von 2001 und in der deutschen Aufsatzsammlung „Bergson Postkolonial“ von 2022.
[6] „Au modèle rélativiste et séparatiste d’une décolonisation de la pensée, j’oppose un modèle traductif. Parce que les langues ne nous enferment pas dans des philosophies grammaticales incommensurables, le philosophe en général, le philosophe africain en particulier, pensera en traducteur, de langue à langue.“ Langue, 132.