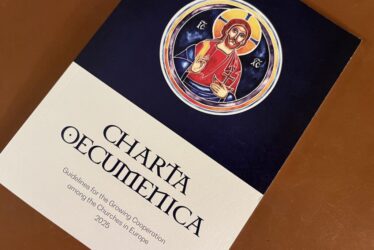Eine ganz eigene Art des Community Organizing verkörpert in Detroit der Aktivist John George. Wolfgang Beck hat ihn getroffen, um für eine kirchliche Struktur im fortschreitenden Niedergang nach Impulsen zu fragen und für ein Leben im kirchlichen Niedergang zu lernen (Teil 2).
Ordnung kann ein Hoffnungszeichen sein. Was theologisch im zweiten Schöpfungsbericht des Buches Genesis seine markante biblische Repräsentanz hat und meist als Indikator für spezifische Entstehungsschichten biblischer Traditionen fungiert, wird in Krisenregionen zu einem wichtigen Mechanismus der Ermutigung. Der Schöpfungsglauben mag darin zu einem „Orientierungswissen für das Hier und Jetzt“[1] zu werden. Wie kaum eine andere Stadt in der westlichen Hemisphäre gilt Detroit als Inbegriff von Krise und Niedergang. Wer lernen will, wie gutes Leben in einem vom Niedergang geprägten Umfeld möglich wird, wird sich hier umschauen müssen. Nicht Chicago, New York oder das Silicon Valley mit ihren glänzenden Erfolgsgeschichten sind die entscheidenden Lernorte. Gerade wenn Christ:innen, Theolog:innen ihr kirchliches Umfeld als anhaltenden Niedergang erleben, scheinen Orte hilfreicher, an denen Menschen in widrigen Umständen Wege zum gelingenden Leben finden. Das gilt für viele Stadtteile Detroits. Ein kleiner Stadtteil in den Außenbezirken fällt auf: Hier herrscht Ordnung!
Was schnell spießig klingt und kleinbürgerlich anmutet, ist in diesem Stadtteil von Detroit eine auffällige Besonderheit, fast eine Kuriosität. Denn diese Ordnung, die sich in sauberen Fußwegen und echten Schnittblumen auf den Tischen im Café ausdrückt, ist ein Statement. Es ist das Statement eines Mannes, John George, der als Aktivist einen ganzen Stadtteil umgekrempelt hat. Während in Detroit seit den 1950er Jahren ganze Straßenzüge von Anarchie, Vermüllung und Niedergang geprägt waren, wird die Ordnung im Stadtteil „Old Redford“ zum Programm. Zwar gibt es in Detroit seit ca. 10 Jahren Hoffnungszeichen: der restaurierte frühere Hauptbahnhof als markantes Wahrzeichen, coole Bars und Restaurants in der Innenstadt, eine Craft-Beer-Brauerei und sogar eine kleine Straßenbahn. Es braucht punktuelle Investitionen, um sich dem Niedergang entgegenzustellen. Aber immer noch sind es eher vereinzelte Projekte. Die äußeren Bezirke und Stadtteile erreichen sie kaum. Sie sind immer noch von Wegzug und Bevölkerungsrückgang, von Armut und Niedergang geprägt.
Wer mit John George in Detroit durch die Straßen seines kleinen Viertels geht, lernt eine andere, verstörende Geschichte kennen.
Er will einfach:
nicht weg.
Als er vor Jahren mit seiner Familie das zweite Kind erwartet und in eines der günstigen und selbst renovierten Einfamilienhäuser zieht, muss er den Niedergang der Nachbarschaft vor der eigenen Haustür jeden Tag mit ansehen. In der Hochphase der Crack-Krise wird es für ihn und die Kinder gefährlich. Einbrüche und Überfälle sind an der Tagesordnung. Aus der einst reichsten Stadt der Welt mit dem großen drei Autokonzernen Ford, GM und Chrysler ist da schon die Hauptstadt von Gewaltverbrechen, Drogenproblemen und Kriminalität geworden. Es sind nicht die „Höllenvorstellungen“[2] der Kriegsberichte, aber Zeugnisse der Härten eines ungezügelten, auf bloßen Wettbewerb aufbauenden Systems. Längst gibt keine Spielplätze und Parks, keine normalen Geschäfte mehr. Wer kann, verlässt die Gegend. John George will nicht weg. Er pflegt samstags seinen Vorgarten, während die anderen Häuser in den Straßen zunehmend verlassen sind. Ein Haus nach dem anderen stürtzt zusammen oder brennt ab. Da fällt der gepflegte Garten von John George auf. Irgendwann geht er dazu über, auch die Gärten der verlassenen Häuser in der Nachbarschaft zu pflegen.
Eine Gruppe,
die beginnt Häuser abzureißen.
Mit seiner Entscheidung zum Bleiben und seinem gepflegten Garten fällt er auf und zieht Neugierige an. Die kleine Gruppe, die sich nach und nach bildet, pflegt an jedem Samstag Gärten und Straßen. Denn herabfallende Äste und wilde Müllkippen werden zunehmend gefährlich. Die Gruppe schafft Ordnung und stemmt sich damit dem Verfall entgegen. Das gilt auch für die leerstehenden und verwahrlosten Häuser. Detroit verliert in fünf Jahrzehnten zwei Drittel seiner Einwohnerschaft. Und in der Crack-Krise gehen viele von ihnen in Flammen auf. Heute hat die Stadt ein eigenes Programm, um massenhaft Häuser abzureißen. Anfangs hat die Gruppe im John George das gleich selbst gemacht.
Da in der Hochphase des Niedergangs auch keine Polizeistreife mehr kommt, wenn ein Einbruch oder eine Gewalttat gemeldet wird, fahren sie als eine der Bürgerwehren Streife und zeigen Präsenz. Was in europäischen Ohren abstoßend klingt, wird hier zur Grundlage, um überhaupt vor Ort bleiben zu können. „Alles für die Kinder!“, so lautet der Grundsatz, den John George im Gespräch mehrfach wiederholt und sich längst auch auf Enkel bezieht.
Ein Café als Keimzelle des „Artist Village“
Längst arbeiten auch seine Frau und ein ganzes Team an den Projekten mit. In Gesprächen entsteht der Wunsch, dass es in der Nähe auch ein schönes Café geben sollte. Das Café entwickelt sich als Nachbarschaftstreff und bildet heute das Zentrum der Aktivitäten. Die praktische Nachbarschaftshilfe erhält eine Dynamik, die sich vor allem der beeindruckenden Energie des Mannes verdankt. Eine Straße, in der es noch ein altes Theater aus besseren Zeiten gibt, wird zum neuen Mittelpunkt des Stadtteils. Hier entsteht das Café. Es folgt ein Jazz-Club. Ein Restaurant. Eine cool eingerichtete Wohnung wird mittlerweile an Gäste und Touristen vermietet. Als überzeugter Anhänger der Demokratischen Partei entwickelt John George zusammen mit einem Künstler das „Obama-House“ mit Ateliers. Zahllose Kunstprojekte und Wandbilder machen das kleine Viertel mittlerweile zum „Artist Village“. Mittlerweile gibt es eine Autowerkstatt und einen großen neuen Supermarkt. Ein Gesundheitszentrum für Senioren siedelt sich an und derzeit wird ein Haus renoviert, damit eine Ärztin darin eine Praxis eröffnen kann. Die Rettung und Renovierung des kleinen Rathauses gelingt und eine neue Polizeistation wird gebaut. Auf einem der zahllosen leeren Grundstücke wird ein kleiner, kunterbunter Garten angelegt. Bisheriger Höhepunkt ist ein modernes Wohnprojekt mit kleinen, bezahlbaren Wohnungen. Ein weiteres Wohn-Projekt ist bereits in Planung.
Ordnung – vom Statussymbol zur lokalen Würdigung
Die Stadtteilarbeit, für die John George mit seiner ganzen Biografie einsteht, trägt den Namen „Detroit Blight Bustes“, was man als Detroiter Krankheitsbekämpfung übersetzen könnte. Name und Logo prangen auch auf vielen Mülleimern. Da ist es wieder, das Prinzip Ordnung. Wer mit John George durch den Stadtteil zieht, erlebt nicht nur, dass er permanent von Leuten gegrüßt und in Gespräche verwickelt wird. Als ich mit ihm an einer Bushaltestelle vorbeigehe und Verpackungsmüll auf dem Weg liegt, sammelt er ihn sofort auf und wirf ihn in einen dieser Mülleimer. Ein Mann an der Haltestelle ruft uns entschuldigend hinterher: „Das war ich nicht. Tut mir leid, dass ich es nicht in die Tonne geworfen habe.“ Das bunte Durcheinander der Kunstprojekte scheint zu diesem Ordnungsfimmel zunächst nicht recht zu passen. Doch bei genauerer Betrachtung ist es eine schwer errungene und erarbeitete Ordnung, die nach Art des zweiten biblischen Schöpfungsberichtes zum Ausgangspunkt von Neuem werden kann.
Ordnung als Luxus-Insignie
Die Erfahrung der totalen Verwahrlosung von Grundstücken und Straßenzügen in den letzten Jahrzehnten, macht plausibel, dass Ordnung hier zur Überlebensstrategie gehört. Und wer durch die Stadtteile von Detroit fährt beobachtet schnell: Ordnung ist sonst eine Luxus-Insignie der wohlhabenden Stadtteile und „gated communities“. Auch das erklärt, weshalb an diesem Ort, wo schon in der nächsten Straße der bekannte Niedergang ungebremst voranschreitet, ein kleiner „Ordnungsfimmel“ Hoffnung macht. Diese Ordnung demonstriert, dass da jemand unterwegs ist, der noch nicht alles aufgegeben hat. Für John George liegt in der Ordnung eine Würdigung der Menschen im Stadtteil; sie darf nicht den Wohlhabenden vorbehalten sein. Offensichtlich ist es eine Form von Ordnung, die andere zur Übernahme von Verantwortung animiert. John George plant die nächsten Schritte mit ungebremster Energie.
Chancen und Risiken jenseits der institutionellen Strukturen
Im Jazz-Club neben dem Café hält der Bezirksbürgermeister mittlerweile alle zwei Wochen eine Bürgersprechstunde ab und trägt dazu bei, dass die hier entstandene neue Ordnung wahrnehmbar wird. Natürlich ist der Blick auf das kleine Detroiter Wunder mit kritischen Anfragen an ein desolates US-amerikanische Sozialsystem und einen weitgehenden Ausfall staatlicher Systeme zu begleitend. Zugleich ist zu fragen, was sich darin auch kirchlich lernen ließe. Wenn in der zunehmenden kirchlichen Depression und dem eklatanten Niedergang diözesaner und pfarrlicher Strukturen Transformationsprozesse initiiert werden, entsteht schnell der Verdacht, dass damit vielleicht auch ein bloßes Restrukturieren und Abwickeln verdeckt werden soll. Mittlerweile gibt es schon zwei Generationen von Christ:innen in den deutschen Großkirchen, die als hauptamtliche Seelsorger:innen oder als ehrenamtlich Engagierte in einem Umfeld permanenter Krisen und des Schrumpfens leben: Zusammenlegungen von Pfarreien, Schließungen von Kirchengebäuden, Abwicklung von Verbänden und die nächsten Sparmaßnahmen. Zu diesem Niedergang gehören die romantisierenden Berichte, wie großartig das kirchliche Leben (für viele) früher war und wie gut besucht die Gottesdienste waren. Hinzu kommt die religionssoziologische Erkenntnis, dass sich diese Entwicklung nicht einfach stoppen lässt. Zusätzlich wird der Niedergang garniert mit den moralisch aufgeladenen Appellen, in diesem regressiven Umfeld neue Formen für die Präsenz der Frohen Botschaft Jesu zu suchen und zu gestalten. So entsteht die Frage: Wie finden Menschen in einem von Niedergang bestimmten Umfeld zu Wegen gelingenden Lebens? Wie leben Menschen, wenn der Niedergang sich als Kettenreaktion ereignet und damit selbst verstärkt?
Tun, was unumgänglich ist
um bleiben zu können.
An dem Beispiel des kleinen Detroiter Stadtviertels wäre zumindest zu sehen, was bei einem umfänglichen Vertrauen in lokale Akteure und deren Eigenverantwortlichkeit entstehen kann. In Aufbrüchen, wie den „Blight Busters Detroit“ um John George liegen auch problematische Elemente: Eine derart charismatische Gestaltungsmacht entzieht sich weitgehend den institutionellen Vorgaben und Kontrollmechanismen. Das macht sie anfällig für populistische Ansätze, für missbräuchliche Phänomene und andere Fehlentwicklungen, die von institutionellen Strukturen nicht vermieden, aber reduziert und eingehegt werden können. Der forciert fortschreitende Niedergang kirchlicher Strukturen in ihrer etablierten Form wird aber möglicherweise ähnliche Freiräume zu eröffnen haben. Sie sind der Ort der verrückten Typen, Ideen und Projekte wie den „Blight Busters Detroit“. Zugleich sind sie ein kirchliches Lernfeld „par excellence“, denn sie zeigen wie gelingendes Leben mitten im Niedergang möglich ist: durch vollständiges Vertrauen in das eigenständige Agieren lokaler Akteur:innen, die nicht von Zielvorgaben und Kontrollmechanismen entmutigt werden. Durch die Aufgaben und Notwendigkeiten vor Ort, die gegenüber den verblassten Traditionen priorisiert werden, verschieben sich Autoritäten. Es wird getan, was unbedingt nötig ist: Abreißen, was längst tot war. Aufräumen, wegräumen statt auf Anweisungen zu warten.
Durch künstlerische Freiräume, die von Humor und Kreativität bestimmt sind, um gegenüber der bestehenden Tristesse Alternativen aufzuzeigen. Und durch die Ermutigung von Menschen, die als „Typen“ vollen Einsatz entwickeln und schnell erahnen lassen, dass sie in den bestehenden Begrenzungen von kirchlichen Berufsprofilen, Ausbildungsordnungen und Assessment-Programmen nur wenig Chancen hätten. Insofern beinhaltet mancher Niedergang auch die Hoffnung, dass die nötigen Freiräume darin entstehen könnten.
An Lebenswegen im Niedergang lernen
Wo Niedergang zum bestimmenden Kennzeichen wird, entsteht Verzweiflung. Das gilt für Regionen, Parteien und nicht zuletzt auch für Kirchen bzw. die Menschen, die in ihnen leben. Pessimismus und grassierende Verzweiflung sind erwartbar, wo Idealbilder gelingenden Lebens zerbrechen und prägende Erinnerungen in Trümmern liegen. Im Raum der Kirchen ergeben sie sich durch fortschreitende Säkularisierungsprozesse, Abschiede von Sozialformen und Missbrauchsskandale. Hier wird Verzweiflung zur „dritten Erziehungsberechtigten“[3], zum Antrieb für innere Kündigungen, Sarkasmus und Zynismus. Für haupt- und ehrenamtliche Christ:innen wird seit Jahren und auf unabsehbare Sicht mit Schließungen, Sparmaßnahmen und allen Formen negativer Trends zu leben sein. Nicht erst wenn Skandale um Missbrauch und Finanzen diese Entwicklungen noch verstärken, stellt sich praktisch allen die Frage, warum sie sich das antuen und wie sie damit umgehen sollen. Wo es Ausnahmen und Leuchtturm-Projekte gibt, ist das tröstlich – aber lediglich für eine kleine Weile. Deshalb genügt es nicht, sich im Optimierungsparadigma dem unausweichlichen Niedergang entgegenzustemmen, in charismatisch inszenierten Formen der Selbst-Euphorisierung der Realität zu entziehen oder mit „Ressentiments“[4] gegenüber der Gegenwart in Sonderwelten zu flüchten. Es ist an der Zeit nach Formen gelingenden Lebens im Niedergang zu fragen, wenn die Abwicklung von Einrichtungen, Gemeinschaften, Ideen und Lebenskonzepten zur bestimmenden Aufgabe wird. Deshalb lohnt sich der Blick auf Menschen, die in einem Umfeld dominierenden Niedergangs Wege zu einem gelingenden Leben suchen. In Begegnungen mit Menschen wie Rev. Faith Fowler und John George, die im Niedergang und der Dominanz umfassender Krisen Wege zu gelingendem Leben suchen, ergibt sich allerdings kein Weg glanzvoller Lösungsansatz. Darin entsteht eher eine Gelassenheit als Form der „Anerkennung der Verhältnisse“[5].
___

Wolfgang Beck ist Professor für Pastoraltheologie und Homiletik an der PTH Sankt Georgen, Frankfurt/M. und Redaktionsmitglied von feinschwarz.net.
Foto: Christof Haake
Fotos: Wolfgang Beck
[1] Franca Spies, Das Materielle in Schöpfung in Inkarnation. Theologische Erkundungen im Dialog Karen Barads Agentiellem Realismus, Bielefeld 2025, 170.
[2] Heinz Bude, Adorno für Ruinenkinder. Eine Geschichte von 1968, München 2018,
[3] Heike Geißler, Verzweiflungen. Essay, Berlin 2025, 168.
[4] Cynthia Fleury, Hier liegt Bitterkeit begraben. Über Ressentiments und ihre Heilung, Berlin 2023, 38.
[5] Armin Nassehi, Der Ausnahmezustand als Normalfall. Modernität als Krise, in: Krisen lieben (Kursbuch 170, 2/2012), 34-49, 47.