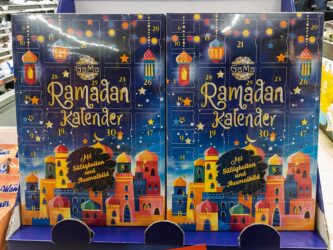Annette Edenhofer stellt die qualitative Studie mit Lehrer- und Erzieher*innen an den 26 katholischen Schulen im Erzbistum Berlin zum Zusammenhang von Berufszufriedenheit und Bildungsgestaltung unter katholisch förderlichen und hinderlichen Rahmenbedingungen vor und lädt zur Tagung am 30. September nach Berlin ein.
Im Forschungsbericht „25 Stunden Schule“ 1 wird der Frage vieler Kirchenworkshops nachgegangen. „Was genau soll katholisch sein? In den Interviews mit Lehrkräften und Erzieher:innen mit und ohne konfessioneller Bindung begegnet dazu Nachdenklichkeit:
„Also, das ist schwer zu sagen. Ich überlege: Kann man das festmachen an irgendwas oder ist es nicht irgendwie so ein seltsames Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren hier, dass das eine der größten Stärken ist, die wir an katholischen Schulen haben. Das Zusammenspiel und die Aufmerksamkeit dabei. Und da ist ja schon die Frage: Wie können wir das sichern für die Zukunft oder stärken, dass es sein Potenzial entfaltet?“
Trotz Kirchenkritik ist „katholisch“ für alle Befragten ein profundes kulturelles Plus im Schulalltag, ein Beziehungsplus unter Menschen mit spirituellen Bedürfnissen.
„Also, die christliche Religion ist ja doch sehr menschenzugewandt und lebensbejahend. Und das ist ja auch in der Bildung, denke ich, so. Da steht der Mensch im Kern in seinem Kontext ja doch im Mittelpunkt. Also wie der Mensch mit der Welt interagiert und für welche Aspekte er sich interessiert, darum denke ich, dass das ein förderlicher Aspekt ist.“
„Also, dieses Bedürfnis des Kindes nach Spiritualität und nach dem Glauben und nach Gott und so, das ist total schön, dass sie das dürfen. Und dadurch haben wir natürlich ein tolles Potenzial.“
Was ist denn eigentlich katholisch?
Wie und aus welchen Gründen wäre das katholische Potenzial zu entfalten? Einige Interviewpersonen wünschen sich mehr Auskunftsfähigkeit und deshalb theologische Fortbildungen.
„Entschuldigung, dann muss man aber mal was über den katholischen Glauben erfahren. Das müsste eigentlich eine Verpflichtung sein wie eine Präventionsschulung, ein Basiskurs: Was ist denn eigentlich katholisch?“
Die geteilte Unsicherheit aber ist innovativ. Denn die Marker ‚Weihrauch, Marienverehrung, Hochämter, Sakramente und Papst‘ müssen in postsäkularen Zeiten nicht nur binnenkatholisch Sinn ergeben, sondern auch im Gespräch mit anderen Religionen und Spiritualitäten ohne Gott. Katholisch, wörtlich: „gemäß allen“, zielt auf Transzendenzfähigkeit.2 Clubmentalitäten wären zu transzendieren, um sich global gottvoll für Mitmenschlichkeit zu vernetzen:
„Also an manchen Kommentaren im Lehrerzimmer merkt man halt schon, dass dann das Katholische manchmal im Weg steht – so für das offenere Weltbild. Das hat dann auch nichts mehr mit Bildung zu tun, genau zu wissen, dass nur katholisch toll sein soll. Was ist, wenn andere einen anderen Weg gehen?“
„Die sind nicht alle katholisch. Das finde ich auch gut, dass das gemischt ist, damit es eine offene Gesellschaft oder Diskussion ist, das ist es auch. Es gibt Menschen, die sind sehr gläubig, sehr streng gläubig, auch in verschiedene Richtungen. Und es gibt auch Kinder, die sind gar nicht getauft. Also es ist eine breite Mischung. Das finde ich aber auch schön.“
Drei Dimensionen von Transzendenzfähigkeit:
Diese und andere Eindrücke unserer Studie zusammen genommen, ergibt sich ein vollständiger Begriff von Transzendenz. So sieht der katholische Philosoph Charles Taylor drei Dimensionen idealer Transzendenzfähigkeit: erstens intrapersonale Persönlichkeitsreifung, den Überstieg von der Ichzentrierung zu selbstbestimmter, sozialsensibler Ichwerdung; zweitens den Überstieg aus dem Privaten ins politische Engagement, um das öffentlichen Leben und demokratische Institutionen lebendig zu halten; drittens die Transzendenzerfahrung mit Gott oder kosmischen Gehaltenseins als zusätzliche Ressource für stressfeste Mitmenschlichkeit. Die Gottesfrage wach zu halten ist Bildung, unabhängig von der existentiellen Entscheidung:
„Und wir alle stehen demütig vor dem Staunen, dass es da etwas Höheres gibt. Und dann kriegt auch jeder seinen Raum und jeder kriegt seinen Auftritt.“
Transzendenzfähigkeit nach Taylor ist Kontingenzbewältigung. Denn bei aller Selbstwirksamkeit lasse sich das Leben nie vollständig kontrollieren: Es läuft besser als gedacht: Was ein Glück! Welche Gnade! Es läuft schlechter als erwartet: Lasst uns gemeinsam lernen!, sei die konstruktive Reaktion. Wer ist schuld?, markiere dagegen toxische Transzendenz, den Überstieg als projektives Wegweisen von sich.3
„Ich mag die Kirchencommunity, weil ich diese sozialen Gruppen mag. Ich mag aber keine Cliquen, auch nicht katholisch. Das kann richtig gefährlich werden. Habe ich ein paar Mal erlebt. Wäre da beinah selber mal Mobbingopfer geworden. – Diese Sache auch mit Schuld und Schuldgefühlen ist bei Katholiken ja so eine Sache. Ich glaube, die hierarchische Aufstellung begünstigt da auch dieses Verhalten. Das könnte da vielleicht noch besser werden. Christliche Werte und gute Bildung helfen gegen Manipulation.“
Die dunklen und ungebrochen machtvollen Transzendenzreflexe deutet Taylor als evolutiv ererbte Gewaltdrift. Alle Kulturen und Religionen kompensierten Ohnmachtserfahrungen. Gewalt werde mit Gewalt abreagiert oder versucht, in Schach zu halten, und so immer neu aufgeladen. Gewaltvolle Selbsttranszendenz, subtil oder offen, geschehe durch Demütigung, Exklusion, Mobbing, in sexuellen Übergriffen und Angriffen auf Leib und Leben. Allein die Androhung verführe Menschen zur Kollaboration mit den eigenen Unterdrücker*innen und zum Wegmobben ihrer friedfertigen Persönlichkeitsanteile.4
Und wie könnte katholisch christlicher werden?
„Und mein damaliges Bild war geprägt von Missständen, von Skandalen. Und ich habe das dann automatisch auch auf die Schule transportiert. Habe gesagt: „Die Schule muss dann genauso skandalträchtig sein.‘ – Auch weil ich selber homosexuell bin. Da war mein erster Gedanke: ‚Ich muss mich verstellen. Ich kann mich da nicht outen!‘ Aber da haben viele gesagt: ‚Es gibt da ein Kollegium, da gibt es doch auch den einen oder anderen.‘ Und da habe ich gemerkt: ‚Ok, gut, die Kirche ist dann doch anders!‘ Aus der Sichtweise eines nichtreligiösen Menschen, der nicht regelmäßig zur Kirche geht, ist es immer noch einfacher, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, den man nicht kennt. Und in dem Fall war es die katholische Kirche, die ich nicht kannte.“
Mit Blick auf Licht und Schatten von Transzendenzstrategien erscheint das Label ‚katholisch‘ ambivalent: Engagierte Mitmenschlichkeit teilen auch Menschen ohne transzendenten Gottesglauben. Umgekehrt zelebriert der Rechtskatholizismus aktuell die eigene Höherwertigkeit, forciert die Freund-Feind-Dynamik – häufig in Allianz mit dem politischen Populismus. Katholisch kann offensichtlich beides, Frieden und Gewalt. Religion braucht Religionskritik.
„Die Religionen werden teilweise politisch eingesetzt, politisch missbraucht. Was passiert denn dann? Oder es gibt hier Kommunismus oder so, die gesagt haben: ‘Weg damit! Überhaupt keine Religion.‘ – Also, was bedeutet das denn dann? Menschen mit religiösen Traditionen? Warum hängen da Leute dran? Warum schießen sich Leute tot? Weil der andere die falsche Religion hat? Und das finde ich, Religionsunterricht ist ein total lebenspraktisches Fach.“
Und wie könnte katholisch christlicher werden? Jesus war nicht katholisch. Jesus war jüdischer Religionskritiker aus Glauben. Jesus ist Christus, der Gesalbte, als Souverän des Friedens. Das Projekt soll bis an die Enden der Erde gehen (Mt 28.19). Verschiedenste gute Möglichkeiten sind frei zu gestalten, auch das gewaltfreie Ringen um die Grenzen kontraproduktiver Gewalt. Die Bergpredigt animiert zu Konfliktfähigkeit, im Gespräch zu bleiben, auf Rache zu verzichten. Diese übermenschliche Transzendenzfähigkeit mache erst menschlich, sei aber ohne Vergebung nicht zu machen, heben einige Befragte hervor. Im Bruch sind Gegner*innen nicht zu verteufeln, sondern zu segnen. Dann kommt Gewalt aus der Welt.
„Gewaltfreie Kommunikation, ja! Vielleicht auch als Verpflichtung für alle Lehrkräfte. Entschuldigung, das könnte nicht schaden.“
So kritisiert Jesus die abstrafenden Exklusionspolitiken des eigenen Religionsestablishment und die römische Kolonialmacht. Der Clubkatholizismus heute käme bei Jesus schlecht weg. Auch die Befragten kritisieren katholische Exklusivität und Top-down als missbräuchliche Kirchenmacht:
„Ich möchte diese strikte, hierarchische, undemokratische Struktur nicht nur nicht verteidigen, ich finde die überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und ich finde, dass es viele Menschen gibt, die im katholischen Glauben und einer Tradition großgeworden sind, also für die das was Wichtiges wäre. Aber die Männerkirche! Ich finde, dass es viele Leute verprellt.“
Dagegen könnten sich Gläubige und agnostische Humanist*innen in der Friedenspraxis von Religionen und Weltanschauung für Kokreativität und gewaltfreier Konfliktfähigkeit verbinden: Sinnvolles Leben ist Wohlwollen in Wort und Tat. Aus der Perspektive des Glaubens ist Gott für jede Kreatur da, ob Gott für möglich gehalten wird oder nicht. Gott ist kreativ ohne Ende – ohne Ausgrenzung. Und sie entzieht sich jedem In-Besitz-Nehmen. Kata-holos, gemäß allen, freigiebig sein wie Gott selbst: Erzählen, nachfragen, streiten und suchen, nachdenken – innerhalb der katholisch diversen Welt und mit Menschen anderer Spiritualitäten. In achtsamer und kundiger Sprache könnte das Mehr der transzendenten Gottesbeziehung Kontur bekommen.5
„Man müsste die ganzen Themen, sei es interreligiöser Dialog, Pubertät, meinetwegen Gewalt oder alles, was es gibt, alles, alles, alles müsste man eigentlich am Evangelium spiegeln und da einen Zusammenhang herstellen. Ich glaube, die Bibel ist voll von Humanismus, nicht nur religiöser Prägung. Und das könnte dem Gläubigen oder dem Nichtgläubigen eine Antwort auf alle seine Fragen geben und müsste eigentlich viel mehr entwickelt noch werden.“
Transzendenz ist auch Wissenserweiterung, Lernbereitschaft für Mehrsprachigkeit. Spirituelle Sprache wäre in handlungstheoretische Begriffen zu übersetzen.
„Wenn ich auch zulasse, dass mich jemand hinterfragt, dass mich die Kids hinterfragen. Dass ich natürlich den Anspruch habe, fachlich klar zu sein, eh klar. Aber wenn jemand sagt: ‚Oh, das habe ich jetzt aber auch noch mal nachgeguckt, das stimmt aber nicht!‘ Dann bin ich nicht beleidigt. – Also ich lerne ja auch immer noch. Ich habe in jeder Phase meines Lebens neue Sachen angefasst, auch Sachen, die ich nicht so gut kann, was ich super, super spannend finde. Wie geht es mir mit den Menschen oder da vorne, der mir was beibringt, wo ich weiß, da habe ich Grenzen? – Ich sag mal ‘Yoga‘.“
Welten verbinden zu lernen, ist schöpferisch. Grundsätzlich wird das spirituelle Label „Bewahrung der Schöpfung“ von fast allen Befragten als multikulturell hervorragendes Bildungspotenzial gesehen.
„Und auch das Interesse oder der Aspekt der Verantwortung gehört, denke ich, auch ganz zentral zur Bildung dazu, Verantwortung sowohl für die Mitmenschen als auch für die Schöpfung, aber auch für sich selbst.“
Säkular gesprochen geht es ums Abwenden der globalen Klimakatastrophe, dem Raubbau mit der Natur, mit Menschen, Tieren, Pflanzen. PISA aber misst gerade ein schulspezifisches, humanökologisches Alarmzeichen. Mobbing steigt europaweit rasant an. Die Mehrheit der Befragten sieht Mobbing als Problem und erblickt die Lösung in Gewaltfreier Kommunikation (GFK) und Demokratiebildung.6
„Da müsste sich echt im Studium was tun. GFK müsste in die Ausbildung gehören. Das ist das A und O.“
„Gewaltfreie Kommunikation und Demokratiebildung, das müsste unter den Kollegen erst mal verbreitet werden.“
Meditation und Yoga werden dabei für probate Präventionsmethoden gehalten: Wer seine inneren Anteile kennt und aushält, müsste auch Demokratie besser können. Positiv verstärkend wäre hier das Traditionsbewusstsein, dass Achtsamkeitsübungen des Osten mit kontemplativen Traditionen des Christentums räsonieren. Allerdings nur wenn Rituale nicht abgespult, sondern geistvoll kultiviert werden, können sie inspirieren.7
„Die Unterscheidung ‚Buchstabe und Geist‘ ist nicht umsonst. Mich hat immer das Spirituelle in der Religion interessiert. Das gibt es auch im Islam. Sufismus fand ich immer faszinierend.“
Im Dienst an spiritueller Vernetzung kann religiöses Konfliktwissen zu Schuld und Sünde helfen, wenn es nicht selbst schwarzpädagogisch missbraucht wird. Ohne Sündenbewusstsein, ohne Selbstkritik an hülsenhafter und übergriffiger Religionskommunikation, ohne Verantwortung für vermeidbare Gewaltakte, keine GFK, kein Unterbrechen von Mobbing. Der missbrauchte Begriff „Erbsünde“ spiegelt konstruktiv die von Taylor beschriebene evolutionäre Drift der Gewaltansteckung durch Gewalt. Verletzliche Menschen sind frei, aber verführbar. Organisationen kaschieren ihren Machtmissbrauch. Dennoch können sie lernen. Dieses Wissen um die Ambiguität vom Kreativitätspotenziale und Gewaltanfälligkeit macht ganzheitliche Bildung erst nachhaltig.8
„Jeder soll funktionieren und keine Schwäche zeigen. Hier verändert sich gerade was: Die Kollegen verlieren irgendwie Vertrauen und holen dann die Keule raus. Und es gibt giftige Konkurrenz. Ich kann nichts dafür, dass sich die meisten Kinder freuen, mich zu sehen.“
„Das ganze Thema Missbrauch ist sehr, sehr beschämend oder verstörend. Also, wie hier mit den Opfern umgegangen wird, wie die Täter immer wieder gedeckt werden, verschoben werden an andere Orte. Also von daher gibt es da schon große, große Differenzen zum Christlichen.“
„Also für mich hatte ich das Gefühl, dass vielleicht auch durch die Missbrauchsfälle katholische Schule sich durchaus anders denkt und sich sehr bemüht, genau dieses Bild auch loszuwerden.“
Jesus ist das Mobbingopfer des religiösen und politischen Establishments. Seine Peers lassen ihn hängen. Unter Druck sinkt ihr Mut. Kreuztragen hätte geholfen. Aber es ist belastend, gewaltfrei an der Seite der Opfer zu sein. Im Gewaltverzicht wird man selbst angreifbarer. So unterschätzt man die eigene Macht: Gandhis Widerstand konnte die Kolonialherrschaft der Briten beenden, auch inspiriert durch die Bergpredigt. Die große christliche Erzählung der Auferstehung von den Toten durch Gewaltfreiheit handlungstheoretisch als Akt von Peacemaking übersetzen zu können, würde ein katholisches Profil durch zweisprachige Auskunftsfähigkeit fruchtbar machen.9
Die Interviewpersonen loten Bildung spirituell tief aus. Interessant aber ist, dass die Frage nach guter Bildung kaum durch Religion beantwortet wird. Dagegen wird die Frage nach dem Spezifikum des christlichen Profils mit den positivsten Auswirkungen auf Bildungsqualität geschildert. Hier liegt der Schluss nahe, dass der Bildungsaspekt von Religion zu stärken wäre. Denn geglaubt werden kann nur, was vernünftig und gewaltfrei beschreibbar ist. Auch die Grenzen des Verstehens sind das: Hoffnung wider alle Hoffnung ist unglaublich realitätsdicht. Wenn sie scheitert, hat sie dennoch Sinn.10 Dagegen stiftet Religion als Moralanstalt Unsinn.
„Aber auch polnische und russische Kinder, die nicht orthodox, sondern katholisch sind, haben teilweise sehr engstirnige Ansichten, finde ich, für das Alter, also lassen sich nur schwer öffnen. – Auch Diskussionen, also Dinge, die ich vielleicht für selbstverständlich halte, die dann aber abgeblockt werden, weil jemand sagt: ‚Nee, das ist aber nicht so, also Sex vor der Ehe, das darf man nicht.‘ ‚Warum darf man das denn nicht?‘ ‚Das steht in der Bibel!‘ – ‚Nein, tut es nicht!‘ Also, solche Sachen, da ist dann erst mal so diese Aufklärungsarbeit zu leisten und nicht sicher zu wissen, dass es auch ankommt oder zu riskieren, dass es dann im Anschluss Diskussionen mit den Eltern gibt.“
Gott ist divers.
Das größte Wunder ist, Liebe in lieblosen Kontexten, nicht kulturelle Gleichschaltung. Nach Augustinus ist der Schöpfergott „trans“: „Innerer als mein Innerstes, höher als mein Höchstes.“ (Confessiones, III,6,11). Und Gott ist divers, weder Mann noch Frau, aber ansprechbare Person, lehrt der Prophet Hosea im 8 Jh. v. Chr. (Hos 11,9). Damit steht eine LGBTQAI*-Fahne auf dem Schulhof für schöpfungstheologische Vielfalt und nicht für den sündigen Abfall von binärer Geschlechtergerechtigkeit. Jugendliche werden nicht zu Libertinage verführt, sondern gesehen, wie sie sind. Dafür optiert der Mehrheit der Befragten.11
In der notwendigen Transzendenz der überholten Naturrechts des 19 Jh. lässt sich auf dem aktuellen Stand der anthropologischen und theologischen Forschung sagen: Die Erdlinge der Genesis sind in Vielfalt geschaffen (Gen 1,27). Sie sollen sich lieben, wie sie sind. Ja, nicht jedes erotische Begehren ist gewaltfrei. Weder Liberalisierung noch Traditionalismus schützen vor dem Recht das Stärken.12 Das GFK-Kriterium des Evangeliums ist die Goldene Regel: „Was Du nicht willst, was man Dir tut, füg auch keinem andern zu“. Katholische Höherwertigkeit ist toxisch für Bildung. Katholisch in Vielfalt ist göttlich. Dieses Beziehungsmaß könnte katholisch noch besser Schule machen. Viele unserer Befragten glauben daran. Sie reklamieren partizipative Schulentwicklung, eben „gut katholisch“, gemäß allen mit allen.
„Unsere Bildung muss schülerorientiert sein und sie müssen zu Wort kommen, was sich dann auch mit demokratischen Werten natürlich deckt. Das ist einerseits für mich das katholische Profil, also die Kinder in Mittelpunkt stellen und von ihnen hören, was sie von Gott verstanden haben. Und wir machen das nicht hier für uns alleine, sondern wir helfen den Schwachen. Wir sehen, gehen raus und sehen, wo Armut, Krankheit, Leid ist, und rennen nicht davor weg und gucken hin und helfen, sind hilfsbereit gastfreundlich, offen.“
Wie kann katholisch religiöse Bildung zu Transzendenz befähigen: zu ganzheitlicher Persönlichkeitsentwicklung und Engagement für Demokratie? Und warum gewinnt ‚katholisch‘ in postsäkularen Zeiten gerade durch interspirituelle Gespräche – mit anderen Religionen und humanistischen Konzeptionen ohne Gott? Der Forschungsbericht „25 Stunden Schule“ bietet Impulse für den Ideenaustausch zur Zukunft religiöser Bildung im Raum Schule, aber auch für alle anderen Felder katholischer Religionskommunikation.
Herzliche Einladung zur Fachtagung „Katholisch förderlich, katholisch hinderlich – wie weiter?“, am Dienstag, dem 30.09.25, 10-17 Uhr, Katholische Hochschule für Sozialwesen, Berlin (KHSB), Anmeldung bis 15.09.25, hier: https://oc.khsb-berlin.de/de/node/1009734
___

Annette Edenhofer, Dr., Professsur für Religionspädagogik, Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB).
Glaube, Liebe, Hoffnung aus Berlin. Gespräche zu Themen aus Kirche, Gesellschaft und Politik:
Beitragsbild: Jan Schneider, unsplash.
- Edenhofer, Annette / Uhlemann / Ingrid /Link, Juliane, „25 Stunden Schule”. Bericht zu Bildungsqualität und Berufszufriedenheit an den katholischen Schulen im Erzbistum Berlin, BIRP Working Paper 2, hg. v. Andreas Leinhäupl, KHSB / BIRP 2025. ↩
- Im aktuellen Konzept der Ausbildung für katholische Religionslehrer*innen im Erzbistum Berlin ist Transzendenzfähigkeit als zentrale Kompetenz hervorgehoben, vgl. Forschungsbericht S. 133. ↩
- Vgl. Taylor, Charles, Ein säkulares Zeitalter, Frankfurt/M. 2010, S. 1039-1055. ↩
- Vgl. a.a.O., S. 1090-1096. ↩
- Vgl. Edenhofer, Annette, „Mehr Dienst als Macht. Grundkompetenzen für eine kritikfähige und inklusive Kirche am Ort „(Hoch-)Schule“, feinschwarz 21.06.2022. ↩
- Vgl. Edenhofer, Annette, „Durchquerung der Angst in Zeiten der Klimakatastrophe“, feinschwarz 14.05.2024. ↩
- vgl. Pohlmann, Johanna im Interview mit Ulrike Graf, „Lassen sich Selbst-Reflexion und Selbst-Mitgefühl in diversen – analogen, hybriden, digitalen – Lern- und Beziehungsraumen entwickeln und stärken?, in: Persönlichkeitsbildung in Zeiten von Digitalisierung, hg. v. Ulrike Graf et al., S. 187-200; vgl. Bericht, S. 135-138. ↩
- Taylor S. 1063-1097. ↩
- Für Jesus als Mobbingopfer vgl. Edenhofer, Annette, War Jesus der erste Minimalist?, Stuttgart 2022, S. 75-105; für Gandhi vgl. Edenhofer, Annette, Die Schule der Feindesliebe. Martha Nussbaums Ethik des Übergangszorns, Innsbruck, 2020, S, S. 260-278. ↩
- Vgl. Bericht, S. 127. ↩
- Vgl. Gülker, Silke, „Umgang mit der Vielfalt sexueller Identitäten an katholischen Schulen. Ergebnisse einer explorativen Befragung“, ICEP, Juni 2024. ↩
- Vgl. zu gewaltvoller Sexualität in libertäre und rigide regulierter Kultur, vgl. Taylor, Säkulares Zeitalter, S. 1072. ↩