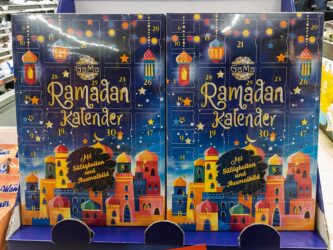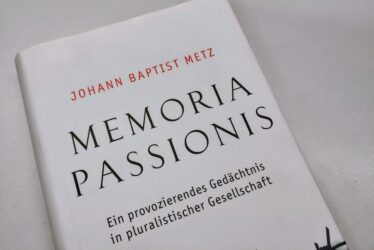Alle zwei Jahre verleiht die Marga-Bührig-Stiftung zwei Preise für neue Forschungsarbeiten von Frauen. Melanie Mumenthaler berichtet von der diesjährigen Preisverleihung.
Leidenschaft für das Leben und für die Gerechtigkeit – dies bezeichnete Marga Bührig als die Grundwerte ihres Lebens, die sie an nachfolgende Generationen weitergeben wollte. 1997 gründete sie dafür eine Stiftung, die ab 1998 jedes Jahr (seit 2008 alle zwei Jahre) einen Förderpreis vergibt. Dieser zeichnet feministisch- und befreiungstheologische Arbeiten aus.
Am Abend des 17. Oktobers – es wäre Marga Bührigs 110. Geburtstag gewesen – fand die diesjährige Preisverleihung im Literaturhaus Basel statt. Es war ein starker Jahrgang mit vielen bei der Jury eingereichten Forschungsarbeiten. Zwei Preisträgerinnen wurden für ihre Arbeiten ausgezeichnet – die eine mit dem Nachwuchspreis, die andere mit dem Förderpreis.
Aktualität und Relevanz für gesellschaftliche Fragen
Die Jury setzt sich jeweils zusammen aus Theologinnen unterschiedlicher Konfessionen, aber auch aus interessierten Laiinnen. Denn Ziel des Förderpreises ist neben der Förderung akademischer feministisch-befreiungstheologischer Forschung auch deren Bekanntmachen für interessierte Nicht-Theolog:innen. Ferner sind die Aktualität und die Relevanz für gesellschaftliche Fragen Kriterien für den Preis.
Diese Gratwanderung zwischen akademischer Forschung, Aktualität und gesellschaftlicher Relevanz haben die ausgezeichneten Arbeiten geschafft. Beide Preisträgerinnen forschen in ihren jeweiligen Gebieten aus einem leidenschaftlichen Interesse für eine gerechtere Gesellschaft und verbinden persönliches Engagement mit wissenschaftlicher Exzellenz. Sie entsprechen damit ganz den Kriterien für den Förderpreis und dem von Marga Bührig intendierten Stiftungszweck.
Nachwuchspreis
Der Nachwuchspreis ging an Sarah A. Ntondele für ihre Masterarbeit «Unter dem Walnussmangobaum. Auf dem Weg zu einer intersektional-womanistischen Theologie im deutschen Kontext».
«wir treffen uns immer / in der ferne / zwischen / avenui und kreuzberg / unter einem alten / walnußmangobaum»[1]
Der Titel von Ntondeles Arbeit bezieht sich auf ein Gedicht der deutschen Schwarzen Lyrikerin May Ayim. Auch in der Konzeption ihrer Arbeit liess sich Ntondele von der Lektüre von Ayims Gedichten inspirieren.
Erfahrung schwarzer Frauen in Deutschland heute
Ntondele analysiert in ihrer Arbeit die Erfahrung schwarzer Frauen in Deutschland heute. Sie macht darin den Ansatz der womanistischen Theologie, der in den USA entwickelt wurde, für den deutschen Kontext fruchtbar. Mit einem intersektionalen Ansatz reflektiert sie auch eigene Verflechtungen in Machtdynamiken und deckt diese auf, so Claudia Janssen in ihrer Laudatio.
Ntondele stellt die Frage, wie schwarze (deutsche) Menschen eine eigene Identität bilden können,wenn Identität sich aus der Begegnung mit dem Anderen herausbildet.Wie konstituiert sich also eine schwarze Identität in einer Gesellschaft, die schwarze Körper systematisch abwertet und auf ein niederes Menschsein zurückwirft?
Eigene Bilder und Denkmuster überdenken
Die Jury schreibt in ihrer Begründung der Verleihung des Marga Bührig-Nachwuchspreises:
«Die Arbeit fordert heraus, eigene Bilder und Denkmuster zu überdenken, und ermutigt dazu, die Vielfalt der Stimmen, vor allem die, die sonst überhört werden, wahr- und ernst zu nehmen. Die Autorin zeigt ein hohes Mass an wissenschaftlichem Potenzial und verkörpert das Thema ihrer Arbeit auch in ihrer Haltung und Herangehensweise. Ihre Arbeit ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie theologische Forschung gesellschaftliche Veränderung anstossen kann: gut lesbar, sensibel und mit einer klaren politischen Relevanz. […] Die Arbeit hat grosses Potenzial zur Weiterentwicklung, etwa in Form einer Dissertation und sie macht Mut, theologisch weiter zu fragen, zu forschen und zu erzählen.»
Sarah Ntondele nahm die Würdigung und den Preis mit Freude entgegen. Das Thema ihrer Arbeit wird sie auch im Rahmen ihrer Dissertation begleiten.
Förderpreis
Der Förderpreis wurde verliehen an Dr. Paulina Hauser für ihre Dissertation «Menschenrechtsverletzungen an Frauen. Eine sozialethische Analyse aus globaler Perspektive».
strukturelle und symbolische Veränderung
Die Jury überzeugte die in der christlichen Sozialethik verortete Arbeit Hausers, da diese einerseits aktuelle und wichtige Fragestellungen bzgl. Menschenrechtsverletzungen an Frauen thematisiert und andererseits ein Konzept von Geschlechtergerechtigkeit entwirft, das strukturelle und symbolische Veränderung fordert. Es wurde damit eine Arbeit ausgezeichnet, die es im akademischen Kontext nicht immer ganz einfach hat, wie die Preisträgerin erwähnte. Umso anerkennungswürdiger ist es – so die Jurypräsidentin Dr. Christine Feld –, dass die Arbeit mit ihrer Aktualität und dem Streben nach mehr Gerechtigkeit an das Handeln und Denken der Kirchen aller Konfessionen appelliert.
Menschenrechtsverletzungen, die weltweit an Frauen begangen werden
In ihrer Laudatio benannte Dr. Christine Feld die Menschenrechtsverletzungen, die weltweit an Frauen begangen werden, und die Paulina Hauser in ihrer Dissertation präzise und analytisch herausarbeitet:
Dazu gehören: „missing women“, Femizide, Ehrenmorde, Mitgiftmorde, Säureattacken, sexualisierter Gewalt, Genitalverstümmelung, Zwangsehen, Sklaverei, Migration und Flucht und strukturelle Benachteiligungen im Zugang zu Bildung, Gesundheit und politischer Teilhabe.
Dass diese Menschenrechtsverletzungen an Frauen keine Einzelfälle sind, sondern verankert in politischen, strukturellen und kulturellen Mustern, zeige Hauser eindrücklich auf. Menschenrechtsverletzungen an Frauen lassen sich nur verstehen, wenn sie im Kontext gesellschaftlicher Rahmenbedingungen und als Teil einer Weltgesellschaft betrachtet werden, die auf Ungleichheit aufbaut.
ethische Spannungsfelder, in denen sich auch Kirche bewegt
Die Autorin benennt ethische Spannungsfelder, in denen sich auch Kirche bewegt. So z.B. das Verhältnis zwischen Universalität und Partikularität, zwischen dem Anspruch der Menschenrechte, die für alle gelten, und unterschiedlichen kulturellen Werten und Traditionen. Hier plädiert Hauser klar für die Universalität der Menschenrechte. Auch das Spannungsverhältnis zwischen Gleichheit und Differenz sowie das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit kommen zur Sprache.
Aus dieser Analyse heraus entwirft Paulina Hauser ein Konzept von Geschlechtergerechtigkeit in zwei Dimensionen: Die strukturelle Dimension, die nach der Umgestaltung von Institutionen, Gesetzen, Bildungs- und Arbeitsbedingungen fragt, die mehr Gerechtigkeit versprechen,sowie die symbolische Dimension, die Bilder und Traditionen im Blick hat, die Frauen abwerten.
Hauser fordert eine Kirche, die einen institutionellen Wandel vollzieht.
In ihrer theologischen Reflexion zeigt Hauser die Ambivalenzen der Theologie auf, insbesondere der katholischen Theologie, die einerseits die Gleichwertigkeit der Geschlechter proklamiere, aber das Erleben und die Verletzlichkeit von Frauen wenig theologisch reflektiere. Hauser wünscht sich und fordert eine Kirche, die einen institutionellen Wandel vollzieht und Frauen in alle Ämter und Entscheidungsprozesse einbezieht,sowie eine konsequente Genderreflexion auf allen Ebenen der patriarchalen Auslegungen und Strukturen praktiziert.
«Theologie und Kirche muss von den Erfahrungen der Frauen lernen. Sie soll zu einem Ort werden, an dem Unterdrückung benannt, Heilung ermöglicht und Solidarität gelebt wird.
So öffnet sich Sozialethik zu einer befreiungstheologischen Praxis, tief verwurzelt im Glauben und offen für die Welt. Eine glaubwürdige Theologie muss immer auch eine Theologie der Befreiung, der Teilhabe und der Hoffnung sein.» sagte Christine Feld zum Abschluss der Laudatio.
befreiungs- und feministischtheologische Fragestellungen für viele Forscher:innen ein Anliegen
Die Jury hatte in diesem Jahr viel zu lesen – so die Präsidentin des Stiftungsrats Prof. Dr. Luzia Sutter Rehmann. Nach bald 30 Jahren Bestehen der Stiftung zeigt sich, dass befreiungs- und feministischtheologische Fragestellungen für viele Forscher:innen ein Anliegen sind, auch wenn es, wie die Preisträgerin Paulina Hauser betonte, immer noch nicht nur selbstverständlich ist, sich diesen Forschungsfragen zu widmen. Beide Preisträgerinnen werden sich dennoch auch in Zukunft weiter mit ihren Themen beschäftigen. Dass die Themen auf Interesse stossen, zeigte auch die Anzahl Gäste, die an der Preisverleihung teilnahmen.
Am Tag nach der Preisverleihung besuchten auch rund 20 Personen das Seminar mit Paulina Hauser. Gemeinsam vertieften sie sich in ihre Arbeit und ihr Engagement – ganz in Marga Bührigs Sinn einer leidenschaftlichen Suche nach mehr Gerechtigkeit.
Beitragsbild: Die Preisträgerinnen Sarah A. Ntondele und Paulina Hauser; Foto: © Raphaela Graf
[1] AYIM, May, blues in schwarz weiss / nachtgesang. gedichte, Münster 2022, 151.